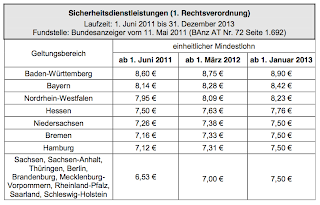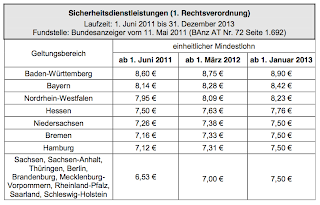Zumindest aus der öffentlichen Berichterstattung sind die gewaltigen Überschwemmungen in diesem Hochsommer und ihre massiven Folgeschäden verschwunden, die betroffenen Menschen und die Regionen, in denen sie leben, sind nun wieder auf sich allein gestellt. Ein schnell von Bund und Ländern zusammengezimmertes finanzielles Hilfspaket in Milliardenhöhe wurde diese Tage seitens des verabschiedet und auf seine administrative Reise geschickt. Die Rechtsverordnung für den Aufbaufonds mit einem Volumen von acht Milliarden Euro ist mittlerweile beschlossen worden. Der Aufbauhilfefonds wird von Bund und Ländern gemeinsam finanziert. Dabei wird der Bund die Kosten für den Wiederaufbau der zerstörten Bundesinfrastruktur in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro alleine tragen. An den weiteren Hilfen beteiligen sich Bund und Länder jeweils zur Hälfte.
Vor Ort geht es jetzt vor allem erst einmal ums Aufräumen und Reparieren. Und hier kommen auch die Arbeitslosen ins Spiel: »In Stendal und Umgebung in Sachsen-Anhalt sind die Arbeitslosen unterwegs, Gummistiefel, Handschuhe und nicht zuletzt Mückenspray hat das Jobcenter gestellt. Das ist die Grundausrüstung, um Sandsäcke wegzuschleppen und zu entleeren, Spielplätze zu entschlammen und Treibgut zum Müll zu transportieren – für 1,25 Euro die Stunde«, erfahren wir aus dem Artikel „Langzeitarbeitslose beseitigen Flutschäden“ von Barbara Dribbusch. Die Teilnahme sei freiwillig, betont das örtliche Jobcenter. Sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in Thüringen sollen Langzeitarbeitslose dabei helfen, die Flutschäden nach dem Hochwasser zu beseitigen. Allerdings seien die Zahlen bislang nicht sehr hoch: Mitte Juli zählte man in Sachsen-Anhalt 250 Arbeitslose in der Aufbauhilfe und in Thüringen wurden bis Mitte Juli 150 sogenannte Arbeitsgelegenheiten, auch Ein-Euro-Jobs genannt, in den Hochwasserregionen eingerichtet. Allerdings hätten sich viele Freiwillige in den Jobcentern gemeldet. In der Stadt Stendal und Umgebung hat man örtlich aktuellere und auch höhere Zahlen: Dort ackern inzwischen 300 Ein-Euro-Jobber in der Fluthilfe. Die 1,25 Euro in der Stunde gibt es zusätzlich zu den Hartz-IV-Leistungen. Fast die Hälfte der Helfer sei über 50 Jahre alt, berichtet Dribbusch in ihrem Artikel.
In den vergangenen Wochen wurde immer wieder über dieses Thema mal berichtet und die Wahrnehmungswelten scheinen hier zweigespalten: Die einen fordern schneidig die Abordnung der Hartz IV-Empfänger an die „Flutfront“, das sei doch selbstverständlich, können die dann doch mal einen Gegenleistung erbringen für die staatlichen Leistungen aus dem Grundsicherungstopf. Die anderen hingegen sehen hier erneut Elemente einer „Zwangsarbeit“ für Arbeitslose, vor allem für Langzeitarbeitslose zu billigsten Bedingungen. Beide Zugänge zum Thema sind – vorsichtig gesprochen – „unterkomplex“.
Der entscheidende Punkt am Beispiel Hilfe in den von der Flut betroffenen Gebieten: Viele Arbeitslose wollen helfen, aber zugleich ist die Art und Weise, wie sie – wenn überhaupt – eingesetzt werden, ein weiteres Beispiel dafür, dass der Bereich der öffentlich geförderten Beschäftigung in den vergangenen Jahren systematisch heruntergeregelt worden ist auf die billigste und zugleich auch umstrittenste Maßnahme: den Arbeitsgelegenheiten, landläufig als „Ein-Euro-Jobs“ bekannt. Dabei würde es auch anders gehen, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, wenn wir einen Blick zurück werfen auf die vorangegangene Flutkatastrophe im Jahr 2002. Genau das bringt Barbara Dribbusch auf den Punkt, wenn sie schreibt:
»Die Bedingungen sind allerdings schlechter als in der Aufbauhilfe nach dem desaströsen Hochwasser im Jahre 2002. Damals hatte der SPD-Sozialminister Walter Riester ein 50-Millionen-Euro-Programm für die Beschäftigung von 5.000 Arbeitslosen unterzeichnet. Diese waren im Rahmen der Strukturanpassungsmaßnahmen Hochwasserhilfe für einige Monate bei den Trägern sozialversicherungspflichtig angestellt und besser bezahlt worden als die heutigen Ein-Euro-Jobber im Rahmen der sogenannten Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung. In Österreich fördern der Staat und die Arbeitsämter derzeit Erwerbslose, die nach den Flutschäden Aufbauhilfe leisten. Sie bekommen einen Monatslohn von 1.700 Euro brutto.«
Im Jahr 2013 ist die öffentlich geförderte Beschäftigung im Wesentlichen entkernt worden auf das Instrument der „Arbeitsgelegenheiten“, das dadurch aber immer stärker und verständlicherweise in die Kritik gerät, was aber nicht wirklich hilfreich ist, denn die Arbeitsgelegenheiten können durchaus Sinn machen für ganz bestimmte Personengruppen unter den Langzeitarbeitslosen, aber eben nicht als fast alleiniges Instrument der öffentlich geförderten Beschäftigung.
Parallel zu der Fluthilfeproblematik muss an dieser Stelle ein anderes Thema angesprochen werden: Ende Juli ging es einige Tage wieder mal rund im Blätterwald und in den sozialen Netzwerken. Was war passiert? „Asylbewerber in Schwäbisch Gmünd: Kofferschleppen für 1,05 Euro die Stunde„, so konnten wir es beispielsweise auf Spiegel Online lesen. Der Sachverhalt ist schnell erzählt: Der Bahnhof von Schwäbisch Gmünd wird bis Anfang 2014 für sieben Millionen Euro modernisiert, denn im kommenden Jahr wird dort die baden-württembergische Landesgartenschau stattfinden.
»Die Arbeiten bringen für die Reisenden allerhand Beschwernisse mit sich: Die Unterführung, in der die Bahn-Passagiere ihr Gepäck auf einem Förderband abstellen können, ist gesperrt. Aufzüge gibt es nicht. Als Provisorium hat die Bahn eine Stahlbrücke errichtet, die über die Gleise führt. Doch die Treppen sind steil, gerade für ältere Fahrgäste mit viel Gepäck und Mütter mit Kinderwagen ist der Weg sehr beschwerlich geworden. Einige Fahrgäste haben sich bei der Bahn deswegen beklagt.
Bahn, Stadt und Landkreis haben nun auf ungewöhnliche Art Abhilfe geschaffen: … Asylbewerber (helfen) den Reisenden beim Koffertragen. Zehn Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern, Afghanistan und Pakistan, die in einer Unterkunft in Schwäbisch Gmünd leben, haben sich freiwillig zum Dienst gemeldet. In Zweierteams tragen sie in zwei Schichten von 6.15 Uhr bis 18 Uhr das Gepäck der Bahnfahrer. Sie haben rote T-Shirts mit der Aufschrift „Service“ bekommen, tragen Namensschilder und Strohhüte, die vor der heißen Sonne schützen sollen. Der Lohn ist bescheiden: Sie verdienen gerade einmal 1,05 Euro die Stunde.«
Allerdings weist der Artikel selbst darauf hin, warum das mit dem Lohn so ist: »Das ist der Maximallohn für Asylbewerber – mehr lässt das deutsche Asylbewerberleistungsgesetz nicht zu.«
- Es geht hier um den § 5 AsylbLG. Dort findet man zu dem in diesem Paragrafen normierten „Arbeitsgelegenheiten“ im Absatz 2 die folgende Formulierung: »Für die zu leistende Arbeit nach Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz und Absatz 1 Satz 2 wird eine Aufwandsentschädigung von 1,05 Euro je Stunde ausgezahlt.« Schluss und Punkt – das heißt aber eben auch, dass man an diese Vorschrift und die dort fixierte Höhe der Aufwandsentschädigung vor Ort gebunden ist, auch wenn man etwas anderes zahlen möchte, wird dies nicht möglich sein, denn vor dem Hintergrund des ansonsten bestehenden Arbeitsverbots für Asylbewerber kann man nur zu den Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG greifen.
Die Stadt Schwäbisch Gmünd selbst hat im Zusammenhang mit der Berichterstattung an den Bund appelliert, den Kommunen in dieser Frage mehr Freiheiten vor Ort zu geben. Und die Stadt ist mit den Realitäten konfrontiert: »250 Asylbewerber leben derzeit in einer Gemeinschaftsunterkunft in Schwäbisch Gmünd – Tendenz steigend.« Die Stadt hat das Projekt als Experiment verstanden und nochmals: die Teilnahme war freiwillig. Es wurde von den Kunden am Bahnhof sehr positiv angenommen. Aber dem Experiment war nur eine kurze Lebensdauer vergönnt: „Bahn lässt Asylbewerber keine Koffer mehr tragen„, so meldete es Spiegel Online kurz nach Beginn der Berichterstattung über das Experiment. Die Großkopferten bei der Bahn hatten sofort kalte Füße bekommen und befürchteten negative Image-Effekte für das eigene Unternehmen, wenn sich der Shitstorm im Anschluss an die ersten Berichte ausbreiten sollte. »Arbeitsverhältnisse zu diesen Konditionen könne die Bahn nicht unterstützen … In der Stadt Schwäbisch Gmünd herrscht Unverständnis über die Entscheidung der Bahn … Die Asylbewerber seien sehr enttäuscht gewesen, als sie vom Aus erfuhren.«
Unverständnis gab es nicht nur auf Seiten der Stadt, in dem Artikel wird auch Bernd Sattler vom Arbeitskreis Asyl zitiert und damit sicher keiner, der irgendwelche dunklen Geschäfte mit den betroffenen Menschen treibt. Er argumentiert besonnen und pragmatisch:
»Für die Flüchtlinge sei der Job am Bahnhof eine Gelegenheit gewesen, der großen Langeweile in der Gemeinschaftsunterkunft zu entfliehen. Kritik an dem Projekt könne allenfalls auf einem Missverständnis beruhen, sagte Sattler. „Wir müssen pragmatische Lösungen finden, um die Asylbewerber zu integrieren. Projekte wie das Koffertragen am Bahnhof ermöglichen ihnen soziale Kontakte. Anders können wir das gar nicht leisten.“ Er verwies darauf, dass Flüchtlinge in Schwäbisch Gmünd bereits in der Behindertenhilfe und in Altenpflegeeinrichtungen tätig seien. „Die Asylbewerber fühlen sich dadurch enorm aufgewertet und werden als gleichberechtigte Kollegen wahrgenommen.“ Außerdem habe die Beschäftigung bereits mehreren Asylbewerbern geholfen, deren Aufenthaltserlaubnis im Zuge einer Härtefallentscheidung verlängert wurde.«
Aber für die Lordsiegelbewahrer des Kampfes gegen „Rassismus“ (bzw. das, was man als solchen ex cathedra definiert), zählt eine solche differenzierte Position nicht. Hier und denen geht es um das Grundsätzliche. Wer dies einmal kurz und bündig nachvollziehen möchte, der möge sich das Video mit dem Beitrag des ARD-Politikmagazins „Kontraste“ vom 15.08.2013 anschauen: „Bevormundung: Keine Ein-Euro-Jobs für Asylbewerber“: »Dürfen Asylbewerber als 1-Euro-Jobber für Bahnkunden die Koffer tragen? Die Stadt Schwäbisch-Gmünd meinte „Ja“, doch als das Projekt publik wurde, lösten die Bilder einen Empörungssturm aus. Von Rassismus und Ausbeutung war die Rede, das Projekt wurde eingestellt. Die Asylbewerber, die sich über diesen Job freuten, wurden gar nicht erst gefragt.« Ulla Jelpke von der Bundestagsfraktion der Linken spricht gar von einem „Rückfall in den Kolonialismus“ und meint damit wohl eher erst einmal ihre Bilder von Kolonialismus, die sie in ihrem Kopf hat und von denen sie nicht lassen möchte. Mit den Betroffenen gesprochen hat sie jedenfalls nicht, das könnte ja auch durchaus einige Irritationen am eigenen Weltbild auslösen.
Um es deutlich zu sagen: Natürlich sind 1,05 Euro – zusätzlich zu den Leistungen, die die Asylbewerber bekommen – kein auch nur ansatzweise ordentlicher Lohn. Aber – wie dargestellt – das findet seine Begründung in der bundesgesetzlichen Vorgabe des AsylbLG. Und aus der persönlichen Sicht der betroffenen Asylbewerber kann eine solche defizitäre Tätigkeit von großer positiver Bedeutung sein, wenn denn die Alternative das staatlich verordnete Nichtstun ist.
Staatlich verordnetes Nichtstun verweist abschließend auf eines der Probleme, die über den Fall Schwäbisch Gmünd eine basale Schwachstelle des Asylbewerbersystems in Deutschland adressiert: Das Arbeitsverbot. »Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Geht es nach Wolfgang Bosbach, bleibt es den Flüchtlingen auch in Zukunft verboten zu arbeiten. Andernfalls würde man die Schlepper unterstützen, sagte der CDU-Politiker«, so der Artikel „Bosbach will Arbeitsverbot für Asylbewerber behalten„.
An dieser Stelle nur ein Gedankengang: Es kommen Menschen her, die Asyl beantragen und deren Asylprüfung kann durchaus sehr lange Zeit in Anspruch nehmen. Man belegt sie mit einem Arbeitsverbot und sperrt sie zusammen mit vielen anderen Menschen aus anderen Ländern, Kulturen und Religionen zusammen – und dann wundert man sich, dass es Probleme gibt? Die dann wiederum auf alle „Asylbewerber“ etikettiert werden. Auf dass sich die Vor-Urteile verfestigen.
Die es – wie hier gezeigt wurde – auch auf der Seite der angeblichen Gutmenschen gibt, die für sich in Anspruch nehmen, für die „schwarzen Kofferträger“ zu sprechen und dabei doch nur über und das auch noch ohne sie tun.
Beide Positionen sind mehr als „unterkomplex“.