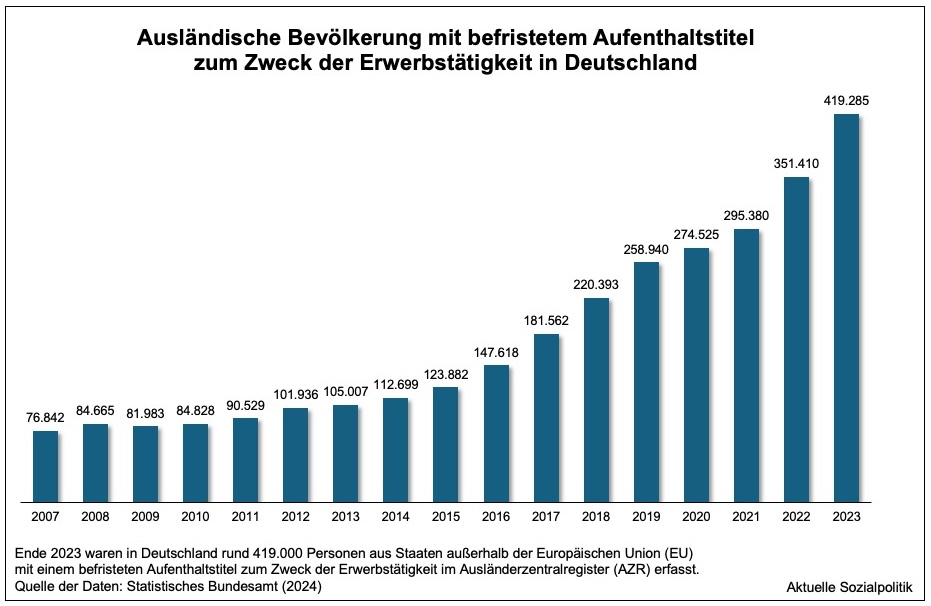Am 1. Mai 2004 traten zehn Staaten der EU bei. Neben den beiden Mittelmeerstaaten Malta und Zypern waren das acht Staaten aus Ost- und Südosteuropa: Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien sowie Ungarn, die auch als EU-8-Staaten bezeichnet werden. Am 1. Januar 2007 kamen Bulgarien und Rumänien (EU-2) dazu und am 1. Juli 2013 Kroatien.
Vor zwanzig Jahren gab es neben der Freude über die Aufnahme der ehemaligen Ostblockstaaten in die EU gerade in Deutschland eine teilweise hyperventilierende Debatte, die befeuert wurde von der Sorge über eine steigende Arbeitslosigkeit und sinkende Löhnen der Menschen in Deutschland. »Die Osterweiterung wird die EU grundlegend verändern. Mit Billiglöhnen und Niedrigsteuern fordern die Beitrittsländer die etablierten Club-Mitglieder heraus. Deutschland muss sich darauf einstellen – oder es wird zu den Verlierern des neuen Europa zählen«, so beispielsweise die Einschätzung von Michael Fröhlingsdorf und anderen in dem Artikel Der Preis des neuen Europa, der im Heft 18/2004 des SPIEGEL veröffentlicht wurde. »Plötzlich … gehören jene Staaten zur EU, die sich in den vergangenen Jahren als größte Konkurrenten gerade des Standorts Deutschland profilierten. Die mit Billiglöhnen, flexiblen Arbeitern und Dumping-Steuern Unternehmen mitsamt ihren Arbeitsplätzen abwarben.« Da war sie in den Raum gestellt, die damals alle bewegende Frage: »Wird Deutschland … zu den Verlierern der großen EU-Erweiterung zählen, weil die Arbeit in bisher unbekanntem Ausmaß abwandert?«