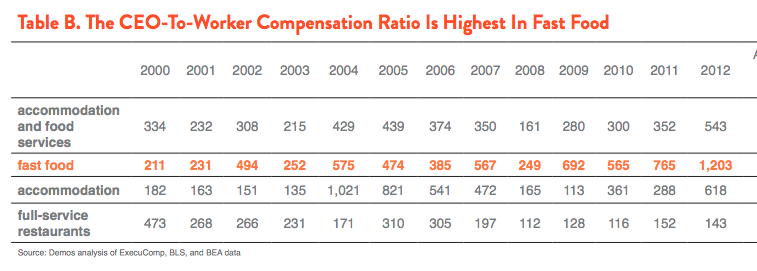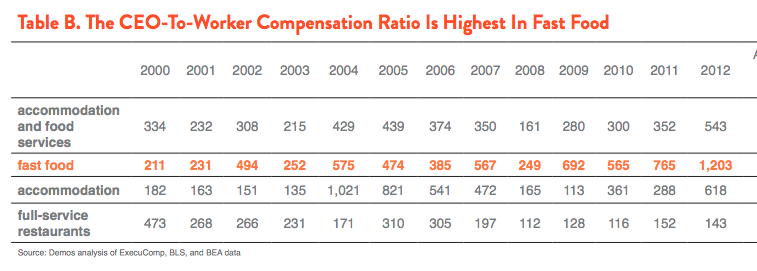Sicher hatten manche die Hoffnung, dass das Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung mal wieder eine Entscheidung präsentiert, nach der eine bestehende Regelung verfassungswidrig sei und korrigiert werden müsse. Und bei dem hier anzusprechenden Sachverhalt geht es immerhin um die Höhe einer existenziellen Leistung für mehrere Millionen Menschen, konkret wurde vor dem Gericht die Bestimmung der Höhe der Regelleistungen im Grundsicherungssystem beklagt, umgangssprachlich als Hartz IV-System bekannt. Immerhin viereinhalb Jahre nach dem letzten großen Hartz IV-Urteil – das Gericht hatte im Februar 2010 ein Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums formuliert, das die physische Existenz wie auch die „Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben“ umfasst (BVerfG, 1 BvL 1/09 vom 9.2.2010) – war das BVerfG wieder mit diesem wichtigen Thema befasst. Und die Hoffnung vieler Kritiker an einer möglichen Verfassungswidrigkeitsfeststellung basiert auf den mehr als fragwürdigen „Modifikationen“ bei der Ermittlung der konkreten Höhe der Regelleistungen, manche werden das auch deutlicher „Manipulationen“ nennen.
Aber die Überschrift der Pressemitteilung des höchsten Gerichts verdeutlicht bereits, dass diese Hoffnung nicht erfüllt wird: Sozialrechtliche Regelbedarfsleistungen derzeit noch verfassungsgemäß.
Das BVerfG schreibt zu dem heutigen Beschluss:
»Die Anforderungen des Grundgesetzes, tatsächlich für eine menschenwürdige Existenz Sorge zu tragen, werden im Ergebnis nicht verfehlt. Insgesamt ist die vom Gesetzgeber festgelegte Höhe der existenzsichernden Leistungen tragfähig begründbar.«
Wie immer bei der richterlichen Sprache achte man aber genau auf die konkrete Wortwahl.
Die ersten Berichte in den Online-Ausgaben der Zeitungen bringen das auf den Punkt:
Hartz-IV-Sätze „noch“ hoch genug, so die FAZ. Und die Süddeutsche Zeitung wird noch deutlicher:
Verfassungsrichter geben Hartz IV die Note Vier.
Wie so oft betont das BVerfG bei sozialpolitisch konkreten Fragen den zumeist sehr weit ausgelegten Ermessensspielraum des Gesetzgebers, so auch im vorliegenden Fall: Das BVerfG spricht von einem »Entscheidungsspielraum sowohl bei der Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse als auch bei der wertenden Einschätzung des notwendigen Bedarfs«. Und das Gericht liefert auch gleich eine Zuständigkeitsabgrenzung mit:
»Das Grundgesetz verpflichtet den Gesetzgeber … nicht, durch Einbeziehung aller denkbaren Faktoren eine optimale Bestimmung des Existenzminimums vorzunehmen; darum zu ringen ist vielmehr Sache der Politik.«
Und an anderer Stelle schreiben die Verfassungshüter:
»Dem Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers entspricht eine zurückhaltende Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht; es setzt sich bei seiner Prüfung nicht an die Stelle des Gesetzgebers. Das Grundgesetz selbst gibt keinen exakt bezifferten Anspruch auf Leistungen zur Sicherung einer menschenwürdigen Existenz vor.«
Wie ist es denn nun aber mit dem Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums, von dem das Gericht im Jahr 2010 in seiner Entscheidung gesprochen hat? Nun, wie meistens mit den Grundrechten:
»Entscheidend ist aber, dass die Anforderungen des Grundgesetzes, tatsächlich für eine menschenwürdige Existenz Sorge zu tragen, im Ergebnis nicht verfehlt werden.«
Also „im Ergebnis“ darf die Sorge für eine menschenwürdige Existenz „nicht verfehlt“ werden. Das lädt zur Exegese und Interpretation ein, neue Promotionsthemen tun sich hier auf.
Aber schauen wir einmal genauer hin, was genau denn das BVerfG nun entschieden hat. Dazu erst einmal der Hinweis auf die zentralen Kritikpunkte an der von der Bundesregierung im Nachgang zum Hartz IV-Urteil aus dem Februar 2010 vorgenommenen „Modifikationen“ am Berechnungsverfahren zur Bestimmung der konkreten Höhe der Regelleistungen (vgl. dazu ausführlicher aus der Vielzahl an Stellungnahmen, die dem Gericht zugeleitet worden sind: Deutscher Caritasverband: Regelbedarfe müssen erhöht werden):
- Früher wurden als Referenzgruppe für die Regelbedarfsstufe 1 (alleinstehende Erwachsene) die unteren 20% der nach ihrem Einkommen geschichteten Ein-Personen-Haushalte (ohne Empfänger/-innen von Leistungen des SGB II und SGB XII) herangezogen, nach der Neuregelung des Verfahrens sind es nur noch die untersten 15%.
- Kritker bemängeln, dass die verdeckt armen Menschen (also Menschen, die ihren Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung nicht wahrnehmen und somit mit einem Einkommen unterhalb des soziokulturellen Existenzminimums leben, aus der Referenzgruppe nicht herausgenommen werden.
- Auch Haushalte, die Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) beziehen, also Studierende, sind in der Referenzgruppe enthalten, sollten aber herausgenommen werden, denn sie haben aufgrund ihrer Lebenssituation und vielfältiger Vergünstigungen spezifische Bedarfe und Ausgaben, die in der Regelbedarfsbemessung nicht als repräsentativ gelten können.
- Die Kritiker stellen darauf ab, dass der Anteil für Strom im Regelbedarf zu niedrig bemessen ist. Er muss auf Grundlage des tatsächlichen Stromverbrauchs von Grundsicherungsempfängern ermittelt werden. Legt man der Berechnung des Stromanteils im Regelbedarf den tatsächlichen durchschnittlichen Verbrauch der Referenzgruppe zugrunde, muss der Regelbedarf in der Stufe 1 deutlich erhöht werden, so der Deutsche Caritasverband.
Auch das Bundesverfassungsgericht hat sich mit diesen und weiteren Kritikpunkten auseinandergesetzt und kommt in seiner Entscheidungen zu folgenden Ergebnissen – die zugleich verdeutlichen, wie unsicher das Gericht ist:
»Entscheidet sich der Gesetzgeber bei der Berechnung des Regelbedarfs für ein Statistikmodell, das Leistungen nach Mittelwerten bestimmter Ausgaben bemisst, muss er Vorkehrungen gegen mit dieser Methode verbundene Risiken einer Unterdeckung treffen. Fügt er Elemente aus dem Warenkorbmodell in diese statistische Berechnung ein, muss er sicherstellen, dass der existenzsichernde Bedarf tatsächlich gedeckt ist. Als Pauschalbetrag gewährte Leistungen müssen entweder insgesamt den finanziellen Spielraum sichern, um entstehende Unterdeckungen bei einzelnen Bedarfspositionen intern ausgleichen oder Mittel für unterschiedliche Bedarfe eigenverantwortlich ansparen und so decken zu können, oder es muss ein Anspruch auf anderweitigen Ausgleich solcher Unterdeckungen bestehen. Für einen internen Ausgleich darf nicht pauschal darauf verwiesen werden, dass Leistungen zur Deckung soziokultureller Bedarfe als Ausgleichsmasse eingesetzt werden könnten, denn diese gehören zum verfassungsrechtlich geschützten Existenzminimum.«
Und – tut der Gesetzgeber das? Nach Auffassung des BVerfG ja, aber:
»Nach diesen Maßstäben genügen die vorgelegten Vorschriften für den entscheidungserheblichen Zeitraum in der erforderlichen Gesamtschau noch den Vorgaben des Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG.« Also noch ist das vereinbar, denn: »Die Festsetzung der Gesamtsumme für den Regelbedarf lässt nicht erkennen, dass der existenzsichernde Bedarf evident nicht gedeckt wäre. Der Gesetzgeber berücksichtigt nun für Kinder und Jugendliche auch Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.« Mit dem letzteren sind die Leistungen aus dem „Bildungs- und Teilhabepaket“ gemeint, die man nach dem letzten Urteil des BVerfG eingeführt hat.
Hinsichtlich der erwähnten zentralen Kritik an der Zusammensetzung der Referenzgruppe ist das Ergebnis in der Entscheidung des BVerfG für die Kritiker sicher frustrierend:
»Die Entscheidung, bei der EVS 2008 nur noch die einkommensschwächsten 15% der Haushalte als Bezugsgröße heranzuziehen (statt wie bei der EVS 2003 die unteren 20%), ist sachlich vertretbar. Der Gesetzgeber hat auch diejenigen Haushalte aus der Berechnung herausgenommen, deren Berücksichtigung zu Zirkelschlüssen führen würde, weil sie ihrerseits fürsorgebedürftig sind. Dass er die sogenannten „Aufstocker“, die neben den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts über weiteres Einkommen verfügen, nicht herausgenommen hat, hält sich im Rahmen des gesetzgeberischen Einschätzungsspielraums. Der Gesetzgeber ist auch nicht dazu gezwungen, Haushalte in verdeckter Armut, die trotz Anspruchs keine Sozialleistungen beziehen, herauszurechnen, da sich ihre Zahl nur annähernd beziffern lässt. Schließlich ist nicht ersichtlich, dass es die Höhe des Regelbedarfs erheblich verzerrt hätte, in die Berechnung Personen einzubeziehen, die Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz erhielten.«
»Der Gesetzgeber ist von Verfassungs wegen nicht gehindert, aus der Verbrauchsstatistik nachträglich einzelne Positionen – in Orientierung an einem Warenkorbmodell – wieder herauszunehmen. Die Modifikationen des Statistikmodells dürfen allerdings insgesamt kein Ausmaß erreichen, das seine Tauglichkeit für die Ermittlung der Höhe existenzsichernder Regelbedarfe in Frage stellt; hier hat der Gesetzgeber die finanziellen Spielräume für einen internen Ausgleich zu sichern. Derzeit ist die monatliche Regelleistung allerdings so berechnet, dass nicht alle, sondern zwischen 132 € und 69 € weniger und damit lediglich 72 % bis 78 % der in der EVS erfassten Konsumausgaben als existenzsichernd anerkannt werden. Ergeben sich erhebliche Zweifel an der tatsächlichen Deckung existenzieller Bedarfe, liegt es im Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, geeignete Nacherhebungen vorzunehmen, Leistungen auf der Grundlage eines eigenen Index zu erhöhen oder Unterdeckungen in sonstiger Weise aufzufangen.«
- Beim Haushaltsstrom (der derzeit als Pauschale in den Regelleistungen enthalten ist), ist der Gesetzgeber im Falle außergewöhnlicher Preissteigerungen bei dieser gewichtigen Ausgabeposition verpflichtet, die Berechnung schon vor der regelmäßigen Fortschreibung anzupassen.
- Das gilt auch für den Mobilitätsbedarf, wo der Gesetzgeber Ausgaben für ein Kraftfahrzeug nicht als existenznotwendig berücksichtigen muss, aber sicherzustellen hat, dass der existenznotwendige Mobilitätsbedarf künftig tatsächlich gedeckt werden kann. Was immer das konkret bedeuten mag.
- Das BVerfG hat sich offensichtlich auch mit den Niederungen der Haushaltsgeräte befasst: »Zudem muss eine Unterdeckung beim Bedarf an langlebigen Gütern (wie Kühlschrank oder Waschmaschine), für die derzeit nur ein geringer monatlicher Betrag eingestellt wird, durch die Sozialgerichte verhindert werden, indem sie die bestehenden Regelungen über einmalige Zuschüsse neben dem Regelbedarf verfassungskonform auslegen. Fehlt diese Möglichkeit, muss der Gesetzgeber einen existenzsichernden Anspruch schaffen.«
Und dann war da doch noch die Kritik an den Leistungen für Kinder und Jugendlichen. Auch hier gilt: Das BVerfG hat „keine verfassungsrechtlich durchgreifenden Bedenken“:
»Gegen die Festsetzung der Regelbedarfe für Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres und Jugendliche zwischen dem 15. und 18. Lebensjahr mit Hilfe von Verteilungsschlüsseln bestehen keine verfassungsrechtlich durchgreifenden Bedenken. Die Höhe der Leistungen ist nach der verfassungsrechtlich gebotenen Gesamtschau derzeit nicht zu beanstanden … Die teilweise gesonderte Deckung von existenzsichernden Bedarfen, insbesondere über das Bildungspaket und das Schulbasispaket, ist tragfähig begründet. Es liegt im Ausgestaltungsspielraum des Gesetzgebers, solche Leistungen teilweise in Form von Gutscheinen zu erbringen. Allerdings müssen die damit abgedeckten Bildungs- und Teilhabeangebote für die Bedürftigen auch tatsächlich ohne weitere Kosten erreichbar sein; daher ist die neu geschaffene Ermessensregelung zur Erstattung von Aufwendungen für Fahrkosten als Anspruch auszulegen.«
»Das BVG hat heute die rigorose Pauschalierung der Regelsätze gekippt. Damit ist die seit Rot-Grün verfolgte Philosophie des Vorrangs der absoluten Massenverwaltungstauglichkeit vor der Lebensrealität der Menschen und ihren individuellen Bedarfen endlich juristisch beendet. In zentralen Punkten wie bei der Anschaffung langlebiger Gebrauchsgüter, den Kosten für Mobilität oder den Preissprüngen bei den Energiekosten ist das Bundesverfassungsgericht der Kritik des Paritätischen gefolgt und hat das derzeitige Modell der Regelsatzbemessung an diesen Punkten für untauglich erklärt. Stattdessen ist den tatsächlichen individuellen Bedarfen wieder Rechnung zu tragen.«