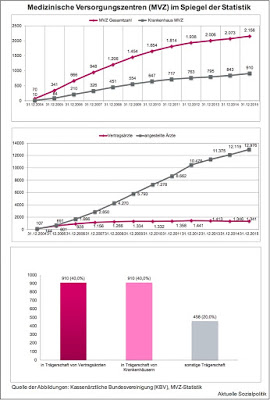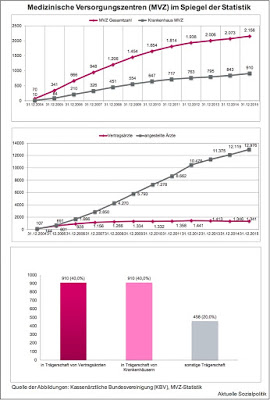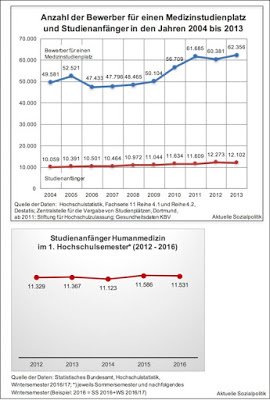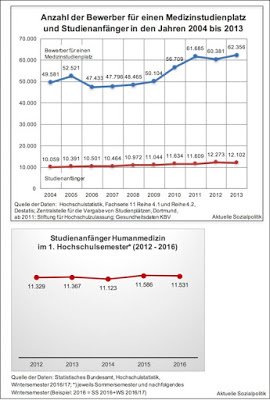Es ist aus gewerkschaftlicher Sicht schon ein Kreuz mit der Pflege. Dort herrscht unter den vielen Betroffenen seit Jahren eine (zunehmende) Unzufriedenheit ob der Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern und in den Einrichtungen und Diensten der Altenpflege. In einer Vielzahl von Befindlichkeits- und Meinungsäußerungen vor allem in den sozialen Netzwerken taucht immer wieder die bewusst an den Brexit erinnernde Wortspielerei „Pflexit“ auf, also der Austritt aus dem Berufsfeld Pflege, weil man so nicht weiterarbeiten möchte. Und ebenfalls immer wieder stößt man auf den „Pflegestreik“, als mahnender, auffordernder Appell in den öffentlichen Raum gestellt. Aber da ist derzeit zumindest der Wunsch Vater oder Mutter des Gedankens und des Begriffs. Denn genau das, also ein Arbeitskampf in der Pflege, ist offensichtlich ein mehrfach vermintes Gelände. Die Quantität des Aufrufens eines möglichen Pflegestreiks steht in keinem Verhältnis zu tatsächlichen Aktivitäten.
Der eine oder andere wird sich an dieser Stelle an das Jahr 2015 erinnern. Im Sommer 2015 gab es einen nur scheinbar kleinen, lokal begrenzten Tarif-Konflikt, der möglicherweise als Initialzündung in die Sozialgeschichte eingehen wird: Gemeint ist der zehntätige Streik von Pflegekräften an der Berliner Charité – immerhin Europas größte Universitätsklinik, bei dem es nicht um mehr Geld, sondern um mehr Personal ging (vgl. dazu und den Ergebnissen den Beitrag Nur ein Stolpern auf dem Weg hin zu einer historischen tariflichen Einigung über mehr Pflegepersonal im Krankenhaus? Die Charité in Berlin und die Pflege vom 6. März 2016). Und das Jahr 2017 begann am 1. Januar 2017 in diesem Blog mit dem Beitrag Und jährlich grüßt das Arbeitskampf-Murmeltier im Krankenhaus? Darin wurde von ambitionierten Ankündigungen der Gewerkschaft Verdi im Saarland hinsichtlich eines möglichen Arbeitskampfes in den Krankenhäusern berichtet.
Und schon sind wir bei einem der großen Hindernisse für einen Pflegestreik angekommen – die Gewerkschaft Verdi, die für sich reklamiert, die Pflegekräfte zu vertreten, ist bei diesen nicht wirklich fest verankert, was man bekanntlich immer wieder an der Kennzahl Organisationsgrad bemisst. Der wird in unterschiedlichen Veröffentlichungen immer wieder in einem Spektrum von 5 bis 16 Prozent taxiert, ohne dass man dafür wirklich prüf- und belastbare Quellen finden kann. Auf alle Fälle ist er schlecht. Und wenn nur wenige Pflegekräfte in der Gewerkschaft organisiert sind, dann ist auch ein (möglicher) Streik, der von der Gewerkschaft organisiert werden muss, ein praktisch unmögliches Unterfangen.
Diese schlechte Ausgangslage für einen Arbeitskampf wird dann auch noch durch weitere auf den ersten Blick unüberwindbar daherkommende Hindernisse potenziert. Beispielsweise die oftmals unterschätzte Tatsache, dass zahlreiche Einrichtungen, in denen Pflegekräfte tätig sind, in konfessioneller Trägerschaft sind – und für die gilt das kirchliche Sonderarbeitsrecht mit seinem faktischen Streikverbot, was bedeutet: Auch wenn die Beschäftigten dort gerne streiken würden, sie dürfen es nicht. Was das praktisch bedeutet, haben wir beim großen Arbeitskampf der Sozial- und Erziehungsdienste, in der Öffentlichkeit oftmals verkürzt als „Kita-Streik“ tituliert, der 2015 ausschließlich auf den Schultern der Fachkräfte in den kommunalen Einrichtungen lag, weil die anders als Erzieherinnen in katholischen oder evangelischen Kitas streiken durften.
Und natürlich muss man auch die für einen Streik nicht wirklich förderlichen Ausgangsbedingungen der Arbeit an sich in Rechnung stellen, denn die Pflegekräfte arbeiten ja nicht in einer Schraubenfabrik, wo man das Band abstellen kann, sondern in Einrichtungen, in denen Menschen auf eine umfassende Pflege und Betreuung angewiesen sind. Dort einen Streik zu organisieren wäre weitaus schwieriger und anspruchsvoller als in „normalen“ Arbeitsbereichen.
Nun wird sich der eine oder andere erinnern, dass es gleichwohl einen größeren Arbeitskampf in diesem sensiblen Feld gegeben hat – der Ärztestreik 2006. Es war der erste Ärztestreik in Deutschland seit über dreißig Jahren und der erste Streik der an Universitätskliniken und kommunalen Krankenhäusern angestellten Ärzte überhaupt. Hier auch besonders relevant: Während der Verhandlungen kam es zum Bruch des Ärzteverbandes Marburger Bund mit der Gewerkschaft Verdi. Bereits im September 2005 kam es zur Auflösung des Vertretungsmandates des Marburger Bundes für Verdi und zum Rückzug des Marburger Bundes aus den gemeinsamen Tarifverhandlungen mit dem Ziel, diese eigenständig zu führen. In kurzer Zeit wuchs die Mitgliederzahl des Marburger Bundes erheblich an.
Im Juni 2006 wurden hunderte Betten an verschiedenen Unikliniken, zum Teil ganze Stationen geschlossen. Seinen Höhepunkt erreichte der Ärztestreik am 16. Juni 2006 mit der bundesweiten Arbeitsniederlegung von über 13.800 Ärzten in 41 Unikliniken und Landeskrankenhäusern. Damit trat ein Großteil der insgesamt 22.000 Universitätsmediziner in den Ausstand. Das für die Krankenhausärzte (und den Marburger Bund) erfolgreiche Ergebnis war der erste ärztespezifische Tarifvertrag der Bundesrepublik. Vgl. dazu auch rückblickend beispielsweise diesen Artikel: Ärztestreiks: „Ich bin doch nicht blöd!“: »Deutschlands Klinikärzte ziehen in den Streik gegen sinkende Einkommen und Berufsfrust. Am Ende gewinnen sie haushoch.«
Für die Gewerkschaft Verdi war das ein schwerer Schlag, bis dahin galt die Devise, dass eine Gewerkschaft alle Beschäftigtengruppen im Krankenhaus vertreten soll, also von den Ärzten über die Pflegekräften bis hin zu den anderen Beschäftigtengruppen. Nun hatten sich die Ärzte – auch unter bewusster Hervorhebung der Argumentation, Verdi hätte sich für ihre spezifischen Interessen zu wenig engagiert – aus der „Solidargemeinschaft“ der Arbeitnehmer ausgeklinkt und „ihr Ding“ erfolgreich durchgezogen. Damit wurde der Marburger Bund neben der Pilotengewerkschaft Cockpit oder der Lokführergewerkschaft GDL ein bekanntes Beispiel für Sparten- bzw. Berufsgewerkschaften. Vgl. zu den wirklich streikfähigen Spartengewerkschaften den Beitrag Die kleinen egoistischen Wilden? Beiträge zur Versachlichung der Debatte über Berufs- und Spartengewerkschaften vom 11. Mai 2015.
An dieser Stelle wird nun der eine oder andere innehalten und sich daran erinnern, dass mittlerweile aber die gewerkschaftliche Landschaft anders aussieht, zumindest auf der rechtlichen Ebene, denn eines der abgeschlossenen Bauvorhaben der großen Koalition der vergangenen vier Jahre war die Schaffung eines Tarifeinheitsgesetzes (vgl. dazu kritisch den Beitrag Von der Tarifeinheit zur Tarifpluralität und wieder zurück – für die eine Seite. Und über die Geburt eines „Bürokratiemonsters“ vom 22. Mai 2015). Mit diesem Regelwerk sollte die (angebliche) „Bedrohung“ durch Spartengewerkschaften (sowohl für die Arbeitgeber wie sich für die DGB-Gewerkschaften) gebrochen werden. Das Gesetz beschneidet die Rechte von kleinen Berufsgewerkschaften wie der GDL, dem Ärzteverband Marburger Bund und der Pilotenvereinigung Cockpit. Und das geht so: Wenn es für eine Berufsgruppe Tarifverträge von zwei Gewerkschaften gibt, dann soll künftig nur noch der Vertrag der Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern im Betrieb gelten. Bei der Bahn wird das Gesetz die größere Bahn-Gewerkschaft EVG stärken. In Kliniken kann Verdi darauf pochen, dass Ärzte nach den Verdi-Regeln vergütet werden und nicht nach den Verträgen des Marburger Bundes.
Im Grunde geht es scheinbar um die Rückkehr zu dem Prinzip „Ein Betrieb – ein Tarifvertrag“, wobei man anmerken muss, dass das dann wenn überhaupt nur für die Arbeitgeber hinsichtlich der ihnen gegenüberstehenden Gewerkschaft gelten würde, denn die Arbeitnehmer sind in praxi weiter mit dem Prinzip „Ein Betrieb – mehrere und gar keine Tarifverträge“ konfrontiert, wenn man hier an Leiharbeit und vor allem an Werkverträge denkt.
Dieses von vielen Seiten heftig kritisierte Gesetz ist ein Ergebnis des Drucks von Arbeitgeberverbänden wie auch der großen DGB-Gewerkschaften (vor allem der IG Metall) auf die – sozialdemokratische – Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles, die das dann auch exekutiert hat. Allerdings wurde im Laufe der Auseinandersetzung klar, dass hier das Streikrecht massiv tangiert wird, daraufhin wuchs auch im gewerkschaftlichen Lager der Widerstand gegen das neue Gesetz – so dass mittlerweile die Gewerkschaft Verdi, die ja in „ihrem“ Bereich der Pflege eigentlich profitieren könnte/sollte von der Neuregelung, das Tarifeinheitsgesetz nicht nur ablehnt, sondern sich wie andere Organisationen auch entschlossen hat, vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe dagegen zu klagen.
Und nunmehr steht die Entscheidung des BVerfG kurz bevor. Im Januar 2017 wurde vor Gericht verhandelt – immerhin zwei Tage lang, was darauf hin deutet, dass die Verfassungsrichter eine Menge Fragen hatten. Dazu der am 24.01.2017 veröffentlichte Beitrag Lex Bahn auf dem Prüfstand von Tanja Podolski:
»Einige Gewerkschaften sind schon gescheitert, nun versuchen Verdi, der Beamtenbund dbb, die Luftverkehrsgewerkschaften Ufo und Vereinigung Cockpit sowie die Ärztegewerkschaft Marburger Bund in Karlsruhe gegen das Tarifeinheitsgesetz vorzugehen (Az. 1 BvR 1571/15 u.a.). Von insgesamt elf anhängigen Verfassungsbeschwerden werden stellvertretend fünf verhandelt. Zwei Tage hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) dafür angesetzt … Für kleine Spartengewerkschaften bedeutet dieses Gesetz, dass ihr Einfluss in Unternehmen so gut wie ausgeschaltet werden kann. Eine Konkurrenzvereinigung, die nicht an den Verhandlungen beteiligt war, hat lediglich noch ein Anhörungsrecht beim Arbeitgeber und kann den Vertrag nachzeichnen.«
Man darf gespannt sein, wie das hohe Gericht entscheiden wird. »Gegen das Tarifeinheitsgesetz geklagt haben auch die Lokführergewerkschaft GDL und der Deutsche Journalisten-Verband (DJV). Drei Eilanträge gegen das im Sommer 2015 in Kraft getretene Gesetz hatten die Verfassungsrichter im Oktober 2015 abgewiesen – die Nachteile seien nicht derart schwerwiegend oder gar existenzgefährdend, dass sie eine einstweilige Anordnung rechtfertigen würden. Bereits gescheitert mit ihren Verfassungsbeschwerden gegen das Tarifeinheitsgesetz sind … die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft (DFeuG) sowie die Neue Assekuranz Gewerkschaft (NAG). Das heißt aber nicht, dass die aktuellen Verfassungsbeschwerden nicht trotzdem Erfolg haben können.«
Juristisch betritt das Gericht nach Worten seines Vizepräsidenten Ferdinand Kirchhof in dem Verfahren Neuland. Zu klären seien daher „zahlreiche komplizierte und neue Fragen», sagte er zum Auftakt. In dem Bereich gebe es „bislang kaum verfassungsrechtliche Rechtsprechung“. Denn der Gesetzgeber habe sich bei der Regelung der Konkurrenz im Arbeitnehmerlager bisher zurückgehalten.
Podolski weist darauf hin, dass in der Praxis die Unternehmen das Tarifeinheitsgesetz bisher kaum angewendet haben. Sie zitiert Thomas Ubber, einen Rechtsanwalt bei der Kanzlei Allen & Overy, der regelmäßig für die Deutsche Bahn und die Lufthansa tätig ist: »Das Gesetz greift eben nur, wenn beide konkurrierenden Tarifverträge nach dem 20. Juli 2015 abgeschlossen wurden. Schon jetzt zeigt sich aber, dass das Entstehen neuer Spartengewerkschaften durch das Gesetz ausgebremst wurde. Künftig wird sich das Tarifeinheitsgesetz sicherlich in einigen Branchen auswirken, besonders in Verkehrsbetrieben und in Krankenhäusern.«
Und in dieser Gemengelage werden wir mit so einer Meldung konfrontiert: Plan für Pflegegewerkschaft: Der Vorsitzende des Marburger Bunds (MB), Rudolf Henke, und der Präsident der Pflegekammer Rheinland-Pfalz, Markus Mai, haben Einigkeit demonstriert in den Fragen von Pflegekammern, einer generalistischen Berufsausbildung in der Pflege und einer starken Gewerkschaft für die Pflege. Beim Empfang anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Ärztegewerkschaft sagte Henke, der auch CDU-Bundestagsabgeordneter ist: „Was die Pflege braucht, ist eine ordentliche Gewerkschaft, die die Pflege tarifpolitisch ordentlich vertritt, zusätzlich zu Pflegekammern.“
Und der hier entscheidende Passus, den man dem Artikel entnehmen kann:
»Sollte der MB mit seiner Klage vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegen das Tarifeinheitsgesetz scheitern, gebe es einen Plan B. Das Gesetz von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) schreibt vor, dass Arbeitgeber künftig nur Tarifverträge mit der größten Gewerkschaft in einem Betrieb schließen dürfen. Dagegen klagt der MB, der als Ärztegewerkschaft oftmals kleiner ist als Verdi, weil in Krankenhäusern deutlich mehr Pflegende arbeiten als Mediziner, wenngleich Verdi im Gros der Häuser einen relativ schwachen Organisationsgrad aufweist. Verliert der MB, ist eine Erweiterung des MB auf Pflegende offenkundig vorstellbar.«
Offene Unterstützung bekommt der Marburger Bund vom Präsidenten der Pflegekammer Rheinland-Pfalz, Markus Mai: „Die Pflege braucht eine starke Gewerkschaft, der sie auch vertraut. Vertrauen drückt sich auch in Mitgliederquoten aus. Derzeit gibt es keine starke Gewerkschaft in der Pflege.“ Notfalls müsse man überlegen, alternative Wege in der Pflege zu gehen.
Das muss man auch vor dem Hintergrund sehen, dass die Gewerkschaft Verdi bislang die Aktivitäten, in den Bundesländern Pflegekammern einzurichten, teilweise massiv bekämpft hat (vgl. diese Übersicht über den aktuellen Stand der Errichtung von Pflegekammern in den Bundesländern).
Bereits »im März hatte Andreas Westerfellhaus, Präsident des Deutschen Pflegerats, auf die Frage, ob eine Pflegegewerkschaft aus einer Berufsgruppe heraus oder in Kooperation mit dem MB entstehen solle, geantwortet: „Die Frage lautet doch, ob es nicht Sinn macht, mit anderen Berufsgruppen im Gesundheitswesen gemeinsam aufzutreten.“ Er sei dafür, dass die unterschiedlichen Berufsgruppen im Gesundheitswesen sich stärker untereinander solidarisieren. „Ärzte, Pflegende und andere Berufe sind die Leistungsträger in den Krankenhäusern. Warum sollten sich diese Berufe nicht viel stärker solidarisieren auch in einer gemeinsamen gewerkschaftlichen Vertretung? Mehr von uns sind besser“, sagte Westerfellhaus.«
Das wird die Gewerkschaft Verdi sicher auch so sehen, natürlich im Sinne einer Organisation unter ihrem Dach, die ja gerade durch die Abspaltung der Krankenhausärzte aufgebrochen wurde.
Wie dem auch sei – hier werden zwei offene Grundsatzfragen angesprochen: Zum einen die sicher unstrittige Notwendigkeit, dass der gewerkschaftliche Organisationsgrad der Pflegekräfte unbedingt gesteigert werden muss, sonst kann es keine Bewegung geben hinsichtlich eines mittel- bis langfristig zu organisierenden „großen Pflegestreiks“, der eigentlich kommen müsste. Zum anderen aber die Frage nach der „richtigen“ gewerkschaftlichen Vertretung der Pflegekräfte. Hier zeigt sich zum einen ein fundamentales Problem der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit ihrer Vielzahl an Berufsgruppen, die dort organisiert werden (müssen), was teilweise bei einigen Berufsgruppen zu Resignation und Abwendung geführt hat und führt, weil man die eigenen Interessen nicht mehr richtig vertreten sieht. Das Ausweichen in eine eigene Sparten- oder Berufsgewerkschaft wäre für die einen oder anderen sicher eine bedenkenswerte Perspektive, vor allem wenn es sich um „Engpassberufe“ handelt, die den ganzen Laden lahmlegen können. Diese Option wird durch das Tarifeinheitsgesetz grundsätzlich beschnitten bzw. zerstört.
Auf der anderen Seite muss man natürlich die Signale aus dem Marburger Bund auch kritisch sehen. Bislang hat man ja gerade in der bislang durchaus erfolgreichen Exklusion der Krankenhausärzte aus der Gemeinschaft der Beschäftigten seine Existenzberechtigung gezogen und auch dementsprechend als Ärzte-Gewerkschaft agiert. In dem Moment, wo nun möglicherweise durch die anstehende Entscheidung des BVerfG die Existenzgrundlage entzogen wird, kommt man auf die Idee, die Reihen „aufzufüllen“ mit den Pflegekräften, um dann in der notwendigen Konkurrenz mit Verdi auf der betrieblichen Ebene als stärkste Gewerkschaft dazustehen und weiter tarifpolitisch agieren zu können. Ob die Pflegekräfte dieses Ansinnen goutieren werden, kann hier nicht eingeschätzt werden. Möglicherweise lassen sich einige leiten von der Überlegung, dass ein gemeinsames Vorgehen mit den Ärzten die Wahrscheinlichkeit, zu besseren Abschlüssen zu kommen, deutlich erhöhen könnte. Allerdings besteht auch die Gefahr, dass der sowieso schon niedrige Organisationsgrad in der Pflege durch die nunmehr vom Gesetzgeber über das Tarifeinheitsgesetz induzierte Konkurrenz um Mitglieder zwischen den Organisationen weiter stabilisiert und eine potenzielle Arbeitskampffähigkeit der Arbeitnehmer noch länger in den Sternen stehen wird.