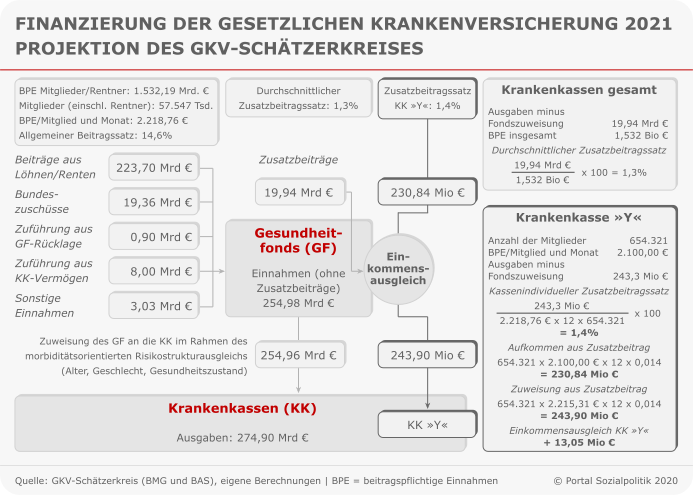Man muss einführend an die historische Entwicklung der Krankenhausfinanzierung erinnern: »Bis zum Jahr 2003 wurden allgemeine Krankenhausleistungen über krankenhausindividuelle Pflegesätze vergütet, die je Tag des Krankenhausaufenthaltes zu zahlen waren. Diese tagesbezogenen Pflegesätze wurden unabhängig davon berechnet, wie hoch der Behandlungsaufwand für einzelne Patientinnen und Patienten tatsächlich war. Die Krankenversicherung zahlte damit bei gleicher Behandlungsdauer für leicht erkrankte Patientinnen und Patienten genauso viel wie für schwer kranke Patientinnen und Patienten, die in der gleichen Fachabteilung eines Krankenhauses behandelt wurden. Die Vergütung erfolgte somit tagesbezogen und nicht leistungsorientiert. Die stationäre Verweildauer war im internationalen Vergleich sehr hoch«, erläutert das Bundesgesundheitsministerium unter der Überschrift Krankenhausfinanzierung. Und das wollte und hat man geändert: »Der Gesetzgeber hat deshalb beschlossen, diese Vergütungsform durch ein „durchgängiges, leistungsorientiertes und pauschalierendes Vergütungssystem“ … zu ersetzen.« Dieses Fallpauschalensystem ist seit Jahren immer wieder Gegenstand umfangreicher Kritik, vor allem hinsichtlich der Folgen für die Versorgung wie auch für die Arbeitsbedingungen des Personals in den Kliniken. Hinsichtlich der Pflege und der Pflegekräfte wurde in den zurückliegenden Jahren vor allem darauf hingewiesen, dass die fallpauschalierende Systematik des Finanzierungssystems einen enormen Personalabbau-Druck ausgeübt hat, was dann immer als „Effizienzsteigerung“ verkauft wird, eine Begrifflichkeit, die irgendwie netter daherkommt als zu sagen, was ist: Mit weniger Personal mehr Fälle in immer schnellerer Zeit umzusetzen.
Aber es ist nicht so, dass man in der Politik nun gar nicht auf diese beklagenswerte Entwicklung des Missbrauchs des Pflegepersonals als Steinbruch für Kostensenkungsstrategien reagiert hat: Über die Jahre haben sich die negativen Effekte gerade in der Pflege kumuliert und irgendwann war der Punkt erreicht, dass man gegensteuern musste angesichts der verheerenden Auswirkungen in einem Bereich, der zunehmend von massiven Fachkräftemangel charakterisiert ist. Also hat der Gesetzgeber gleichsam die Notbremse gezogen und versucht, die Pflegekosten aus dem „durchgängig pauschalierenden Vergütungssystem“ wieder herauszunehmen.
mehr