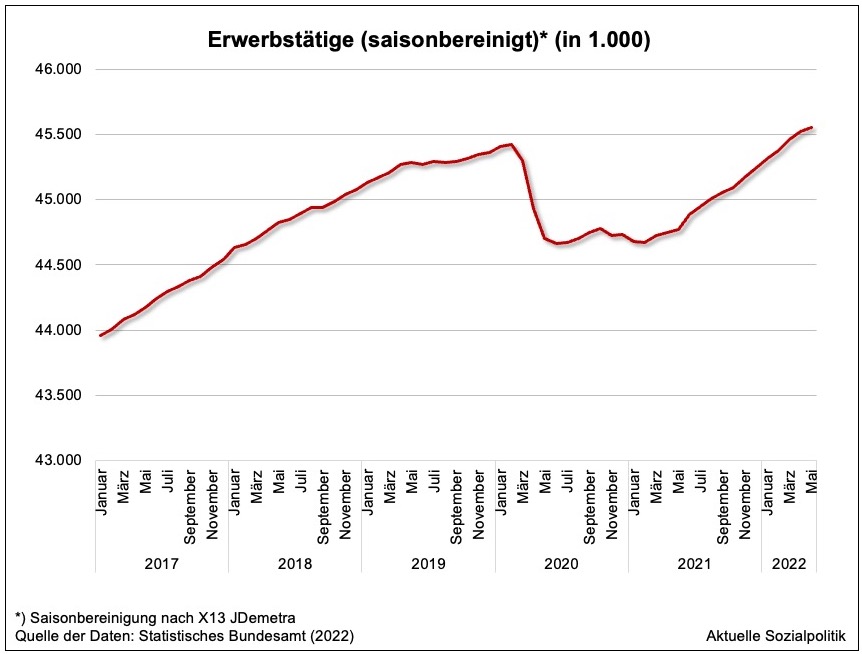Wer erinnert sich noch an den Mai 2019? Damals erschienen Artikel mit solchen Überschriften: Kommt die Stechuhr für alle? Dort ging es um das Plädoyer von Giovanni Pitruzzella, Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof (EuGH), in einem Verfahren, in dem die Frage nach der Dokumentation von Arbeitszeiten im Mittelpunkt stand: »Was Pitruzzella in Bezug auf einen Streit zwischen einer spanischen Gewerkschaft und der Deutschen Bank SAE vorlegt, wird in Expertenkreisen schon als „arbeitszeitrechtliches Manifest“ tituliert. Es könnte der Anfang vom Ende der Entgrenzung der Arbeit sein.«
Nun mag der eine oder andere vielleicht einwenden, was denn wir mit dem spanischen Arbeitszeitrecht zu tun haben. Neben der Tatsache, dass das spanische Recht der Arbeitszeiterfassung große Ähnlichkeiten mit dem deutschen aufweist (so muss bis auf wenige Ausnahmen die Arbeitszeit nur dann festgehalten werden, wenn sie über acht Stunden täglich hinausgeht), war es vor allem das dann vom EuGH verkündete Urteil: EU-Staaten müssen Arbeitgeber zur Arbeitszeiterfassung verpflichten, so das Urteil des EuGH vom 14. Mai 2019 (C-55/18). Und zwar alle Mitgliedstaaten der EU. Vgl. dazu auch den Beitrag Wieder einmal ein Paukenschlag aus dem EuGH: Arbeitgeber müssen verpflichtet werden, ein System einzurichten, mit dem die tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann, der am 14.05.2019 in diesem Blog veröffentlicht wurde.