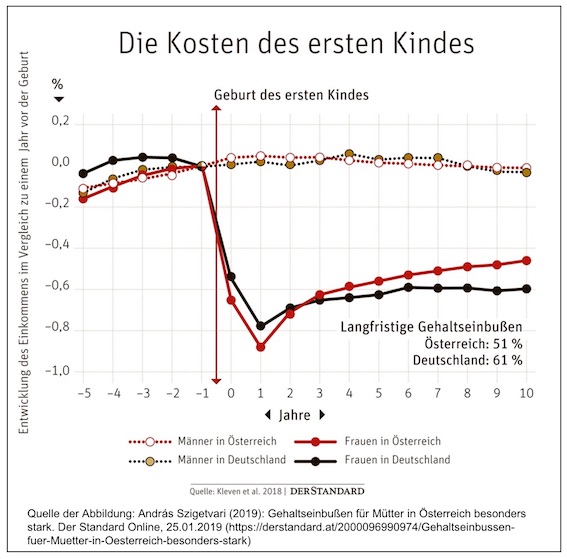Blicken wir zurück in das Jahr 2018, die Große Koalition hatte damals nach längeren Geburtswehen die Regierungsarbeit aufgenommen. Der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage im Bundestag unter der Überschrift „Umstände der Abweisung von Frauen an Frauenhäusern“ (Bundestags-Drucksache 19/1624 vom 12.04.2018) konnte man das hier entnehmen:
»Um von Gewalt betroffenen Frauen und Kindern den gesicherten Zugang zu Schutz und Beratung in Frauenhäusern zu ermöglichen, plant die Bundesregierung in Umsetzung des Koalitionsvertrages zwischen CDU, CSU und SPD die Einberufung eines Runden Tisches von Bund, Ländern und Kommunen. Ziel der Beratungen ist der bedarfsgerechte Ausbau und die adäquate finanzielle Absicherung der Arbeit von Frauenhäusern und entsprechenden ambulanten Hilfs- und Betreuungsmaßnahmen.
Der Frage, wie eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Hilfesystems zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt aussehen muss, geht auch das derzeit vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderte Modellprojekt Bedarfsanalyse und -planung zur Weiterentwicklung des Hilfesystems zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt nach. In dem Modellprojekt geht es darum, gemeinsam mit den Ländern Instrumente zu entwickeln und in der Praxis zu erproben, mit denen die Länder ihr Hilfesystem künftig besser den Bedarfen der von Gewalt betroffenen Frauen anpassen können. In die Beratungen des Runden Tisches sollen die Ergebnisse aus dem Modellprojekt mit einfließen.«
Eine Einordnung dieser Ausführungen der Bundesregierung konnte man dem Beitrag Frauenhäuser. Ein weiteres Beispiel aus dem Mangel-Land Deutschland, der hier am 17. Juni 2018 veröffentlicht wurde, entnehmen: »Soll oder muss man das übersetzen? In dieser Legislaturperiode wird sich (wieder) nichts tun, denn das dauert so seine Zeit mit Modellprojekten und Runden Tischen. Dann kann man einer Verbesserung der Situation der Frauenhäuser und damit der betroffenen Frauen in die nächsten Wahlprogramme aufnehmen. Erneut werden wir Zeugen des leider sehr bekannten Mechanismus des „am ausgestreckten Arm verhungern“ lassen.«
mehr