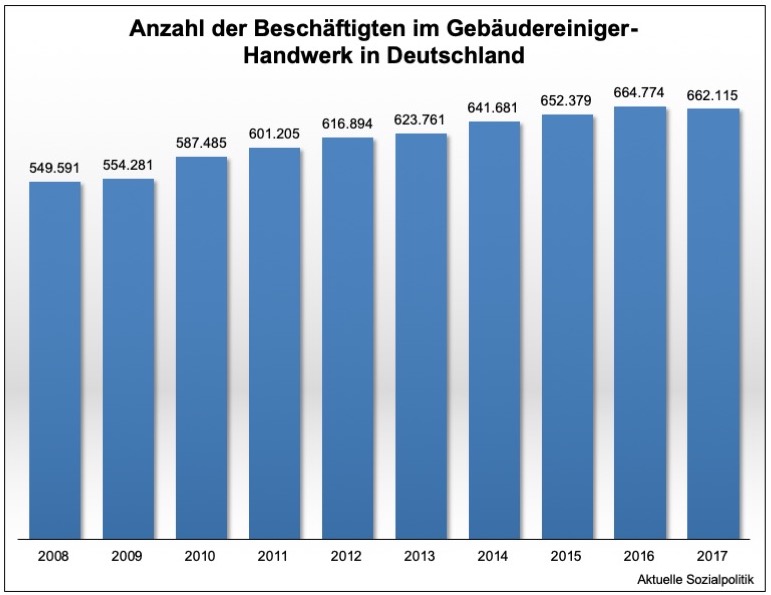In den vergangenen Monaten und Jahren ist in der pflegepolitischen Diskussion immer wieder gerade mit Blick auf die Langzeit- bzw. Altenpflege darauf hingewiesen worden, dass der extrem niedrige gewerkschaftliche Organisationsgrad der Beschäftigten mit ein Grund dafür sei, dass die von vielen ebenfalls seit Jahren angemahnten Verbesserungen der Arbeitsbedingungen nur schleppend vorankommen bzw. sogar eine weitere Verschlechterung nicht verhindert werden konnte.
Und schon vor Jahren wurde darauf hingewiesen, dass gerade in der Altenpflege mit ihren vielen eher kleinteiligen Einrichtungen und Diensten und dem zunehmenden Anteil an privat-gewerblichen Trägern ein gewerkschaftliches Machtvakuum zu beklagen sei, was auch dazu beigetragen habe, dass (im Zusammenspiel mit der Sonderrolle der den freigemeinnützigen Sektor der Altenpflege dominierenden kirchlichen Träger, die eigene Regelungswerke haben) es in diesem Bereich eine tariflose Zone geben würde, bei der man noch nicht einmal von einer „tarifpolitischen Erosion“ sprechen kann, die seit den 2000er Jahren zunehmend kritisch diskutiert wird, denn es gibt kaum, geschweige denn flächendeckende Tarifverträge.