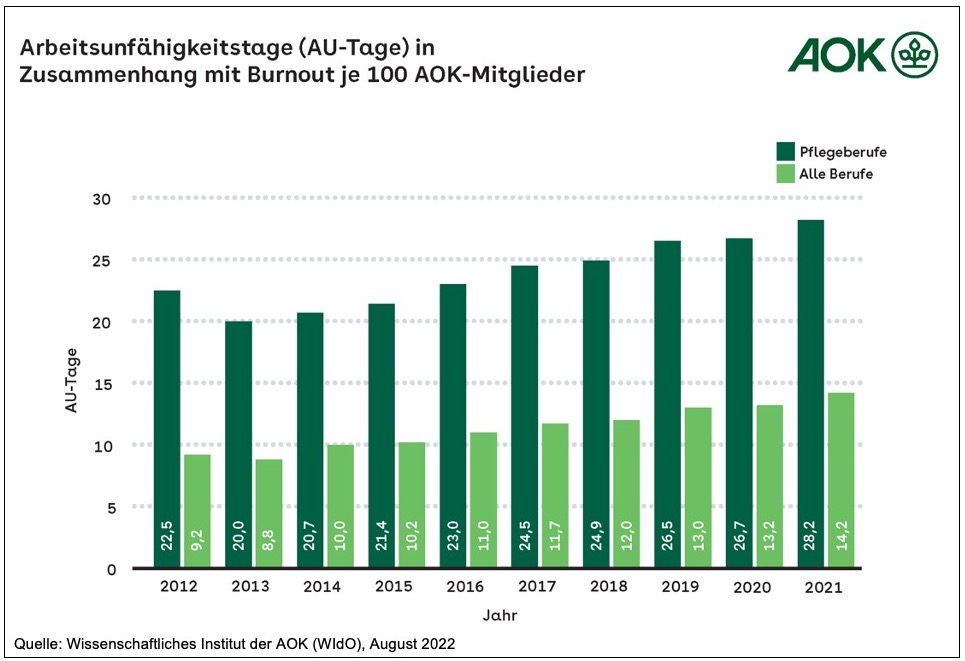»Wir wollen das Vertrauen der Pflegekräfte durch Sofortmaßnahmen zurückgewinnen und den Alltag der Pflegekräfte schnellstmöglich besser machen. Deshalb sorgen wir mit dem Sofortprogramm Pflege für mehr Personal, eine bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege. Stationäre Einrichtungen und Krankenhäuser erhalten finanzielle Anreize, um mehr Pflegekräfte einzustellen und auszubilden: Jede zusätzliche Pflegekraft in Krankenhäusern wird finanziert. In der stationären Altenpflege sorgen wir für 13.000 neue Stellen.« So konnte man es auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums lesen unter dem Punkt „3. Stellen schaffen (Sofortprogramm Pflege)“ bei den Erläuterungen, wie man sich die Pflegestrategie der Bundesregierung vorzustellen hat.
Das war im Jahr 2018 – und ursprünglich sollten es eigentlich nur 8.000 Stellen sein für die stationäre Altenpflege, die hatte man dann nach den ersten Reaktionen – angesichts der Tatsache, dass wir mehr als 13.000 stationäre Pflegeeinrichtungen in Deutschland haben – auf die 13.000 augehübscht. Und das sollten nicht „irgendwelche“ Stellen sein.