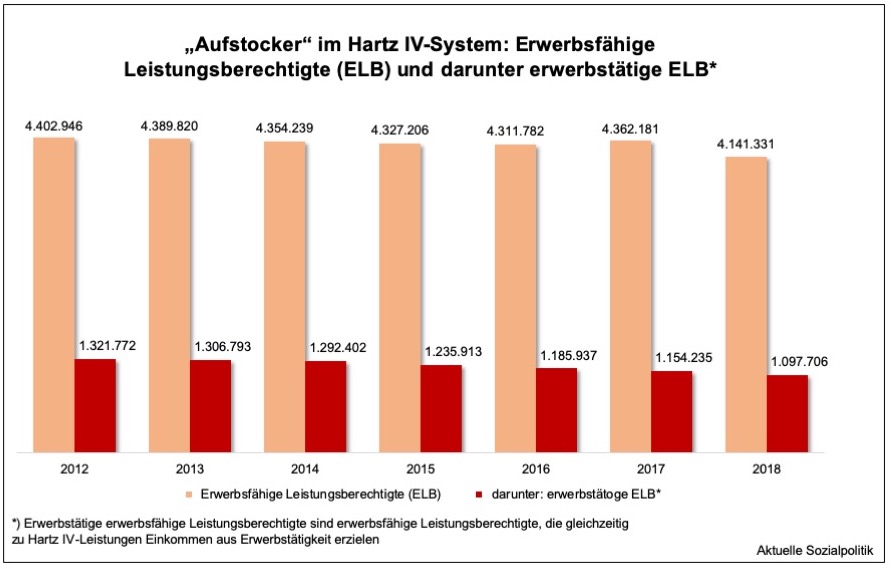Permanent geistert das Schlossgespenst einer „zu locker“ gewährten und „zu großzügig“ dotierten Sozialhilfe durch die Medien und manche Politiker greifen die damit verbundenen Bilder und Vorurteile gerne auf, um große Teile der Bevölkerung in Stellung zu bringen gegen den (angeblichen oder tatsächlichen) „Missbrauch“, der da mit den von der Allgemeinheit finanzierten Sozialleistungen betrieben wird. Der große Resonanzboden erklärt sich auch durch die Vorgabe, dass Sozialhilfe bzw. Grundsicherung (Hartz IV) nur diejenigen bekommen (sollen), die „bedürftig“ sind und dann auch nur, wenn sie zugleich alles tun, um diesen Zustand zu beenden.
Und eine offensichtlich besonders erschreckende Vorstellung scheint für einige zu sein, wenn sich das Schlossgespenst zu einer sogar „bedingungslos“ gewährten Leistung auswächst (zugleich projizieren andere regelrechte Heilserwartungen in ein immer wieder in den Raum gestelltes „bedingungsloses Grundeinkommen“). Aber davon sind wir – das kann man begrüßen oder beklagen – weit weg. Denn gerade die Sozialhilfeleistung des SGB II, umgangssprachlich als Hartz IV bezeichnet, ist eine „bedürftigkeitsabhängige“ Sozialleistung und damit weit entfernt von einer Bedingungslosigkeit der Leistungsgewährung.