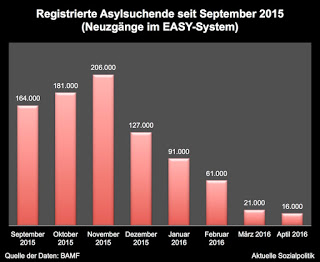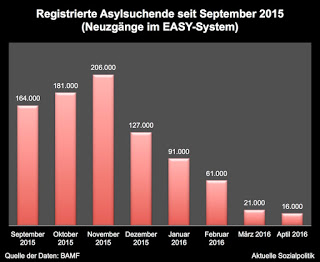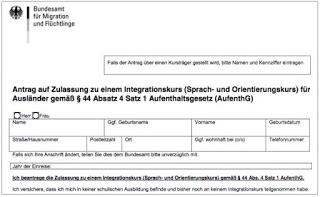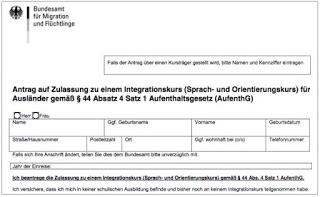Es müsste ja eigentlich allen klar sein: Eine auf alle Fälle unverzichtbare, wenn auch nicht hinreichende Bedingung für eine gelingende Integration der Menschen, die als Flüchtlinge oder aus ganz anderen Gründen zu uns gekommen sind, ist das Erlernen und die Anwendbarkeit der deutschen Sprache. Dafür gibt es die Integrationskurse, die aus einem Sprachkurs und einem Orientierungskurs bestehen. Die sind von wirklich existenzieller Bedeutung für die Integrationsaufgabe. Und eigentlich müsste man die immer knappen Ressourcen nach allem, was wir wissen, gerade im Bereich der Sprachkurse fokussieren und dort Bedingungen ermöglichen, die dem Anliegen förderlich sind. Was auch bedeutet, dass die Menschen, die in diesen Kursen als Lehrkräfte unterrichten, entsprechend der Bedeutung dieser Kurse gute Arbeitsbedingungen bekommen, damit sie ihrer wichtigen Aufgabe nachgehen können.
Dem ist allerdings in vielerlei Hinsicht nicht so. Darüber wurde hier auch schon öfter berichtet, vgl. beispielsweise den Beitrag 1.200 Euro im Monat = „Top-Verdienerin“? Lehrkräfte in Integrationskursen verständlicherweise auf der Flucht oder im resignativen Überlebenskampf vom 2. September 2015, Auf der Flucht im doppelten Sinne. Ein Update zu den Sprachlehrkräften sowie den Chancen und Risiken dahinter vom 14. September 2015, Sonntagsreden und die wirkliche Wirklichkeit oder Lehrer und andere Lehrer vom 17. Februar 2016 oder auch Die Annäherung an die Wahrheit liegt zwischen (rhetorischer) schwarzer Pädagogik und (naiver) „Wird schon werden“-Philosophie. Die Forderung nach einer Sprachlernpflicht für Flüchtlinge und die Wirklichkeit der „Schweizer Käse“-Angebote vom 28. März 2016. Kurzum: Ein bewegtes Thema und viele Probleme in den Niederungen der Praxis. Wobei wir die nicht nur in Deutschland haben (was man immer auch vor dem Hintergrund der großen Zahl an Flüchtlingen sehen muss, die zu uns gekommen sind), sondern auch aus anderen Ländern werden ähnliche Probleme gemeldet, beispielsweise aus Österreich (vgl. dazu den Beitrag Auch auf der anderen Seite der Grenze gibt es Deutschkurse am Fließband und skandalöse Arbeitsbedingungen für die Lehrkräfte in Sprach- und Integrationskursen, die doch von so großer Bedeutung sind vom 30. April 2016).
Aber nun soll alles besser werden für die Sprachlehrkräfte, die vor allem – in der Regel als „Selbständige“ beschäftigt – über eine teilweise skandalös niedrige Vergütung klagen.
Offensichtlich hat man auch ganz oben die Problematik erkannt und ist zu Veränderungen bereit. Denn nun erreichen uns solche Botschaften: Regierung plant mehr Lohn für Deutschlehrer, hat Martin Greive seinen Artikel überschrieben. Die Ausgangslage stellt sich so dar:
»Die Klassen in den Volkshochschulen sind derzeit so voll wie selten zuvor. Bis zu 550.000 Flüchtlinge könnten in diesem Jahr laut Bundesinnenministerium einen Integrationskurs belegen. Entsprechend hoch ist der Bedarf an Deutschlehrern. Tausende durchlaufen derzeit Fortbildungen und erhalten vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die Zulassung, Deutsch zu unterrichten. Doch am Ende stehen davon nur wenige tatsächlich in der Klasse. Der Grund dafür: die miese Bezahlung.«
Natürlich geht es wieder einmal vor allem um das liebe Geld. Das Bundesinnenministerium, dem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) unterstellt ist, schlägt vor, Deutschlehrer künftig deutlich besser zu bezahlen – und verlangt dafür mehr Mittel von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU).
Offensichtlich haben wir es mit einem veritablen Angebots-Nachfrage-Problem zu tun, dass sich die Beamten im Bundesinnenministerium genötigt sind, eine finanzielle Aufstockung anzumahnen – die noch nicht beschlossen ist, wir befinden uns derzeit immer noch in der Phase der Vorschläge bzw. der Forderungen mit Haushaltswirksamkeit:
»Insgesamt hat das BAMF im vergangenen Jahr 5600 Lehrern eine Zulassung erteilt, Flüchtlingen Deutsch beizubringen. Allerdings seien nach Schätzungen „nur circa zehn Prozent der im Jahr 2015 zugelassenen Lehrkräfte bislang als unterrichtende Lehrkraft dem Bundesamt gemeldet worden“, heißt es in dem Bericht. Es sei durchaus möglich, dass Lehrkräfte die Fortbildung nutzten, um dann „in besser bezahlte Bildungsbereiche abzuwandern“.«
Wo genau das Problem liegt? In dem, was gemeinhin als „Rahmenbedingungen“ der Arbeit bezeichnet wird. Und die sind wirklich desaströs, wie man der folgenden allgemeinen Beschreibung entnehmen kann: Die meisten Sprachlehrer müssen auf selbständiger Basis arbeiten und tragen die gesamte soziale Absicherung entsprechend auf ihren eigenen Schultern.
»Gerade im Vergleich zu Lehrern an Schulen werden sie auch noch schlecht bezahlt. Im vergangenen Jahr betrug ihr durchschnittliches Mindesthonorar gerade mal 20,35 Euro pro Unterricht. In der Zwischenzeit ist diese Vergütungsuntergrenze zwar auf 23 Euro angehoben worden. Damit kommt ein Sprachlehrer mit 30 Unterrichtseinheiten auf einen Verdienst von 2800 Euro brutto im Monat.«
Wohlgemerkt – 2.800 Euro brutto für einen Selbständigen, nicht für einen fest angestellten Arbeitnehmer. Und wie will man diese Situation nun ändern?
„Um auf dem Arbeitsmarkt weiterhin ein attraktives und konkurrenzfähiges Angebot zu machen, könnte eine nennenswerte Anhebung der Vergütungsuntergrenze für Honorarlehrkräfte auf 35 Euro vorgenommen sowie eine Verpflichtung zur Einhaltung der gewählten Honoraruntergrenze für zugelassene Integrationsträger begründet werden“, schreibt das Bundesinnenministerium, so Martin Greive in seinem Artikel.
Das wäre »eine Anhebung um 52 Prozent. Bei 30 Unterrichtseinheiten würde das Gehalt der Lehrer so spürbar steigen, auf 4200 Euro brutto im Monat.«
Bezahlt werden die Sprachlehrkräfte von den Trägern der Integrationskurse, beispielsweise den Volkshochschulen (von denen etwa 40 Prozent der Integrationskurse abgedeckt werden), die da eine wichtige Rolle spielen. Nur die müssen natürlich eventuell höhere Gehälter gegenfinanzierten können. Auch daran hat das Bundesinnenministerium gedacht und schlägt deshalb vor: »Der Kostenerstattungssatz solle von aktuell 3,10 auf vier Euro je Kursteilnehmer steigen.«
Nichts ist umsonst im Leben und so auch hier: Eine entsprechende Anhebung würde zu diesen Mehrausgaben führen:
»Für 100.000 Integrationsteilnehmer würden sich zusätzliche Ausgaben in Höhe von 52 Millionen Euro ergeben. Rechnet man diesen Betrag auf die bis zu 550.000 Flüchtlinge hoch, die in diesem Jahr laut Ministerium an Sprachkursen teilnehmen könnten, käme man im Extremfall auf einen zusätzlichen Bedarf in Höhe von 286 Millionen Euro allein in diesem Jahr.«
Das hört sich nach einem ordentlichen Sprung an, wenn denn die – wohlgemerkt zum jetzigen Zeitpunkt nur als Forderungen einzustufenden – Zahlen realisiert werden würden.
Und was sagen die Betroffenen dazu? Zumindest die, die sich als Interessenvertreter der Betroffenen verstehen und zu Wort melden?
In dem Kontext dieser Frage sicher sehr interessant ist die Tatsache, dass am 12. April 2016 ein Offener Brief der in Integrationskursen tätigen DaF-/DaZ-zertifizierten Lehrkräfte sowie von Angehörigen des Bonner Offenen Kreises (BOK), eines Zusammenschlusses von Deutschlehrkräften, der schon seit Jahren gegen die inakzeptablen Arbeitsbedingungen von Kursleitenden in Integrationskursen und deren skandalöse Mangelfinanzierung durch den Bund ankämpfen, veröffentlicht wurde.
Die Briefeschreiber stellen fest: »Ohne eine umfassende sprachliche Vorbildung, die im Übrigen unserer Ansicht nach eine Ausweitung der Sprachkurs-Förderung über das für den Arbeitsmarkt unzureichende B1-Niveau hinaus auf mindestens B2 beinhalten sollte, wird eine Integration in Arbeit und Gesellschaft nicht gelingen.«
Und was fordern die nun?
Sie »fordern eine Festanstellung auf LehrerInnen-Niveau oder bei Freiberuflichkeit die Anerkennung der Arbeitnehmerähnlichkeit – dementsprechend 60 Euro pro Unterrichtseinheit plus
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.«
Das ist nun eine ordentliche Hausnummer weit weg von den aktuell seitens des Bundesinnenministeriums geforderten 35 Euro pro Stunde.
Wr dürfen gespannt sein, wie das ausgeht.