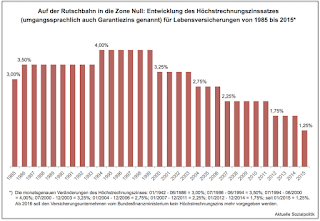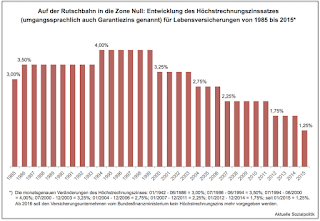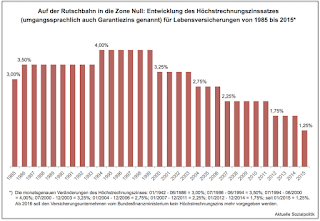
Schon seit geraumer Zeit gibt es in einem Teil der Medien
eine (zunehmend) kritische Berichterstattung über die Tiefen und Untiefen der
privaten Altersvorsorge vor allem im Umfeld der Diskussion über die
„Riester-Rente“. Gerade die Lebensversicherung steht seit längerem und immer
öfter unter Berichterstattungs-Beschuss. Die Kapital-Lebensversicherung ist –
bzw. war – eine der wichtigsten Säulen, gerade bei denen, die gar keine
Alternative haben zu einer privaten Absicherung, weil sie beispielsweise als
Selbständige gar nicht eingebunden sind in die soziale Absicherung durch die
umlagefinanzierte Rentenversicherung. Und das Finanzprodukt (Kapital-)Lebensversicherung
ist erneut in die Schlagzeilen geraten. Vor einiger Zeit schon verunsicherten
Meldungen, das immer mehr Versicherungen eine Abkehr von
Lebensversicherungspolicen mit Garantiezins ankündigen – nach Generali und
Talanx folgte im September auch der Branchenriese Ergo. Und da ist er schon,
der „Garantiezins“. Denn der soll nun endgültig fallen mit Beginn des neuen
Jahres. Um nur einige der Schlagzeilen zu zitieren: Warum
der Garantiezins ausgedient hat, Trumpfkarte
verloren, Eine Hiobsbotschaft für die Altersvorsorge oder auch Ist
die Lebensversicherung jetzt am Ende?: »Die Bundesregierung will bei neuen
Lebensversicherungen keinen Garantiezins mehr vorgeben. Weil der als
Hauptargument für die Policen galt, steht der Altersvorsorgeklassiker vor dem
Aus.« Auch der Bund der Versicherten (BdV) stößt in dieses Horn: Bundesregierung
will klassische Lebensversicherung beenden, so hat man dort eine
Pressemitteilung überschrieben. Der Vorstandssprecher des BdV, Axel Kleinlein,
wird mit diesen markigen Worten zitiert: „Die Bundesregierung spielt mit dem
Vertrauen der Bürger in Lebensversicherungen, private Renten, Riester-Renten,
Rürup-Renten und betriebliche Altersvorsorge.“ Alle diese Wege der
Altersvorsorge sind bisher stark geprägt von den klassischen Verträgen mit
Garantiezins.
Es geht hier nicht um irgendeine Kleinigkeit. Ein Großteil
der mehr als 90 Millionen laufenden Lebensversicherungsverträge basiert auf dem
Modell einer Kapital-Lebensversicherung mit Garantiezins. Der eigentlich Höchstrechnungszins
heißt, was den einen oder anderen jetzt irritieren mag, denn aus Sicht der
meisten Kunden ist der Garantiezins ein Mindestzins in dem Sinne, dass man
diesen Zins mindestens bekommt, wobei viele nicht wissen, dass die
Mindestzinsen nur für den sogenannten Sparanteil eines Vertrages gelten. Daher
sind klassische Verträge nur dann rentabel, wenn die zusätzlich gegebene
Überschussbeteiligung ein zusätzliches Plus bringt.
»Der Höchstrechnungszins ist bei der klassischen Lebens- und
Rentenversicherung der Zinssatz, den Versicherungsunternehmen ihren Kunden
maximal für das angesparte Geld versprechen dürfen. Für Versicherer ist der
Zins also eine gesetzlich vorgegebene Obergrenze, die den Wettbewerb um allzu
kühne Zinsversprechen unterbinden sollte«, während aus Sicht der Kunden dieser
Zinssatz eine andere Bedeutung hat, da er sie informiert, »wie viel der
Versicherer ihm mindestens für das Ersparte zusichern, also garantieren, muss.
Die Garantie ist also die Untergrenze«, kann man diesen
Erläuterungen
entnehmen. Die garantierte Rendite – wohlgemerkt nur auf den Sparanteil der
Beiträge innerhalb der Lebensversicherung (also die 80 bis 90 Prozent, die nach
Abzug der Vertriebs- und Verwaltungskosten übrig bleiben; unter
Berücksichtigung dieser Randbedingungen kommt man dann bei ausgewiesenen 1,25
Prozent „Garantiezinsen“ auf eine faktische Rendite in Höhe von noch
mickrigeren 0,5 Prozent) – ist angesichts der Niedrigzinsen am Kapitalmarkt von
einst 4 Prozent auf mittlerweile 1,25 Prozent gesunken. Und nun soll er ganz
fallen, für Neuverträge ab dem 1. Januar 2016.
Zu den Hintergründen verweist das Bundesfinanzministerium
auf die schärferen Eigenkapitalvorschriften
Solvency
II, die ab dem kommenden Jahr gelten, mit denen die Versicherungsbranche
krisenfester gemacht werden soll. Danach müssen Versicherer für langfristige
Versprechen an Kunden wie den Garantiezins mehr Eigenmittel zurücklegen.
Interessant an dieser Stelle die zum Vorstoß der
Bundesregierung
abweichende
Positionierung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV):
„Zur Gewährleistung langlaufender Lebensversicherungsprodukte mit
Zinsgarantien, die nicht gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert sind, ist auch
in Zukunft eine Vorgabe für den höchstzulässigen Rechnungszins nötig“, so Peter
Schwark, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des GDV. Die Aussage überrascht,
denn sie steht dem Trend der Branche entgegen, stärker garantielose Policen
anzubieten. Auch die Versicherungsmathematiker der einflussreichen
Deutschen Aktuarvereinigung machen sich für
eine
Beibehaltung
der Vorgabe bei klassischen Lebensversicherungsprodukten stark – allerdings
mit einem Veränderungsvorschlag zum heutigen System:
»In den ersten 15 Jahren soll der Höchstrechnungszins ein
fester Zinssatz sein, der sich am Kapitalmarkt orientiert; in der Zeit danach
ein vorsichtigerer Wert, der der langfristigen volkswirtschaftlichen Erwartung
mit einem Sicherheitsabschlag folgt und ebenfalls bereits anfänglich festgelegt
wird. So können auch weiterhin fest garantierte Zinsen in marktangemessener
Höhe die Basis für eine erfolgreiche Altersversorgung und eine ergänzende
Überschussbeteiligung sein.«
Über die Motive vor allem der GDV, für den einen oder
anderen überraschend gegen die geplante Streichung des Garantiezinssatzes zu
argumentieren, kann man natürlich nur spekulieren. Den meisten, gerade in
Deutschland extrem risikoaversen und sicherheitsorientierten Kunden sind
Garantiezusagen wichtig – und die Berücksichtigung dieses psychologischen
Moments wird wahrscheinlich hinter der Positionierung stehen, denn bei den
(potenziellen) Kunden kommt jetzt vor allem die für die Verkaufe der Produkte
unangenehme Botschaft an, da gibt es „nichts“ mehr zu holen.
Grundsätzlich wird es Versicherern auch künftig möglich
sein, Lebensversicherungen mit einer garantierten Verzinsung anzubieten, worauf
der GDV beispielsweise hinweist. Allerdings müssen sie dann zusehen, dass sie die
Eigenkapitalvorschriften, die sich aus Solvency II ergeben, erfüllen – und die
sind teuer. Nicht nur deshalb verabschieden sich immer mehr Versicherer schon
seit längerem – wie bereits angedeutet – von dem Produkt Lebensversicherung mit
Garantiezins. Stefan Kaiser hat seinen Artikel zu dieser Entwicklung so
überschrieben:
Gut
für die Versicherer, schlecht für die Kunden: »Die deutschen
Lebensversicherer bieten immer häufiger Policen ohne Garantiezins an. Das soll
die Renditechancen der Anleger erhöhen – nutzt aber vor allem den Anbietern.«
Die Allianz beispielsweise ist von sich selbst begeistert bzw. genauer von der neuen
garantiezinsfreien Police „
Perspektive„.
Mittlerweile hat das Unternehmen noch vier weitere Produkte ohne garantierte
Verzinsung aufgelegt, die teilweise auch an die Entwicklung von Aktienindizes
geknüpft sind. Insgesamt machen solche Policen mittlerweile 63 Prozent des Neugeschäfts
mit Privatkunden aus, berichtet Stefan Kaiser in seinem Artikel. Zu kritisieren
ist vor allem die für den Kunden die Intransparenz der neuen Produkte, die noch
schlimmer ist als bereits bislang. Er wird mit heutigen Renditeversprechen
geködert und muss sich verlassen, dass das Unternehmen das auch realisieren
kann über einen jahrzehntelangen Zeitraum. Da muss man schon sehr viel
Gottvertrauen in Ergo & Co. haben. Stefan Kaiser dazu: »Tatsächlich haben
die neuen Produkte für die Versicherer den Vorteil, dass diese die genaue
Verzinsung für die Kunden erst am Ende festlegen müssen. Sie entscheiden dann
je nach Marktlage. Garantiert ist dem Kunden zum Beginn des Ruhestandes in der
Regel nur das eingezahlte Kapital – ohne jegliche Rendite.«
Strategisch gesehen geht es den Versicherungsunternehmen vor
allem um einen vollständigen Risikotransfer auf die Versicherten. Also für die
ist das natürlich ein schlechtes Geschäft, vor dem man sich vor allem mit Blick
auf die Nutzung für die Altersvorsorge hüten sollte.
Nun könnte der eine oder andere einwenden mit Blick auf die
Lebensversicherungen und den Niedergang sowie die nun anstehende Beerdigung des
Garantiezinssatzes, dass das alles schlimm ist, aber „nur“ die Neufälle
tangieren wird und diejenigen, die schon vor Jahren abgeschlossen haben, sind
dann fein raus aus, weil sich ja bei ihnen nichts ändern wird. Auch hier aber
gießen zumindest die Verbraucherschützer eine Menge Wasser in den Wein. Der BdV
befürchtet
auch Nachteile für Altverträge: „Zwar sind die Garantien schon bestehender
Verträge ziemlich sicher, die neuen Maßnahmen der Bundesregierung werden aber
negativ auf die Überschüsse durchschlagen“, so Axel Kleinlein. Sinkende
Überschüsse könnten dann zu einer noch unrentableren Altersvorsorge führen.
Denn, so der BdV: Die Überschüsse in den Beständen der klassischen Tarife
dienten bisher als Verkaufsargument für den Vertrieb von Neuverträgen mit
Garantiezins. Das fällt jetzt in der neuen Welt weg.
Und wieder stehen wir skeptisch-enttäuscht vor der Szenerie
einer ja auch staatlicherseits seit langem geforderten und geförderten
stärkeren privaten Altersvorsorge. Bekanntlich wurde ein Teil der
Sicherungsfunktion der guten alten umlagefinanzierten Rentenversicherung auf
Kosten der vor allem den Versicherungsunternehmen dienenden Säule der privaten
Altersvorsorge abgebaut – ohne dass es wirklich und gerade bei denen, die
besonders darauf angewiesen wären, zu einer tatsächlichen Kompensation der
Ausfälle kommen wird. Würde es sich nur um Sahnehäubchen handeln, die im
schlimmsten Fall wegfallen, dann wäre die Lage anders zu bewerten. Wir sprechen
hier aber von der existenziellen Sicherungsfunktion eines
Alterssicherungssystems.
Aber auch wenn man – rein hypothetisch mal hier gedacht –
die Entwicklung vor allem seit der „Riester-Rentenreform“ der damaligen
rot-grünen Bundesregierung Anfang des neuen Jahrtausends rückgängig machen. Das
würde den vielen Selbstsändigen und darunter vor allem den vielen
soloselbständigen Kümmerexistenzen nicht helfen. Wieder einmal sehen wir die Mega-Aufgabe
eines Umbaus des Alterssicherungssystems, der alle ausweichen, auch die
derzeitige Große Koalition. Aber das wird uns einholen, das ist gewiss.