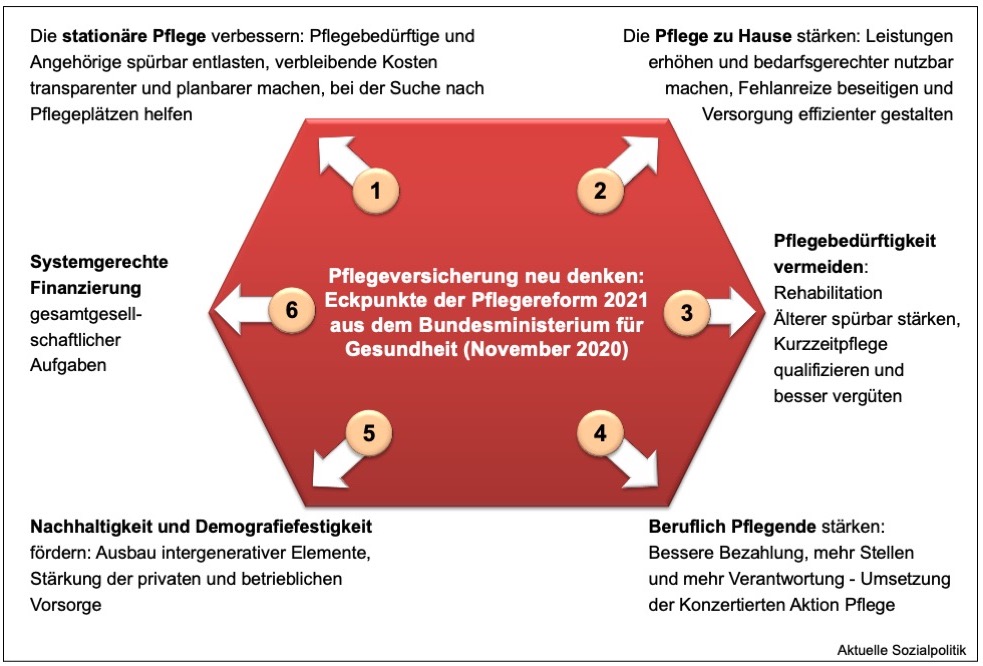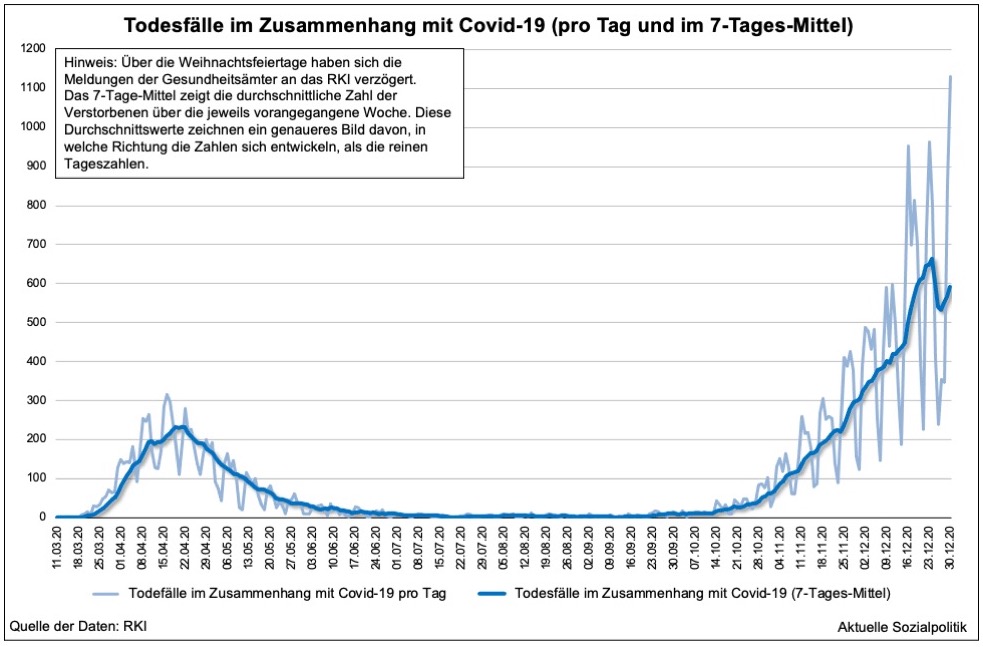Sergei Brin und Larry Page haben am 4. September 1998 Google als Unternehmen ins Leben gerufen. Die Geschäftsidee des Start-Ups, das in den ersten Wochen in einer Garage im Silicon Valley residierte, war clever: Neben den Suchtreffern gibt es kleine Werbeanzeigen, die thematisch zur Suche passen. Den Preis für die beste Anzeigenposition regelt ein automatisches Bieterverfahren. Damit ließ sich nicht nur schnell, sondern auch viel Geld verdienen. Doch die Google-Gründer wollten sich von der Konkurrenz aus IBM, Microsoft oder Apple unterscheiden. Man wollte die Welt verbessern. Das inoffizielle Firmenmotto: Nicht böse sein – „Don’t be evil“. Der Slogan richtete sich nicht nur an die Kunden, sondern vor allem an die eigenen Mitarbeiter – das haben die Gründer auch beim Börsengang betont. Sie seien bereit, auch auf Gewinne zu verzichten (vgl. dazu den Beitrag „Don’t be evil“ von Marcus Schuler). Was daraus geworden ist, wissen wir alle: Aus dem ehemaligen Start-Up ist ein milliardenschwerer Konzern geworden, der seit Jahren angesichts seiner krakenhaften Expansion mit einer damit einhergehenden enormen Konzentration globalen Marktmacht zunehmend kritisch beobachtet wird. Und wie auch Apple mal in den Anfangstagen mit dem Image des kreativen und irgendwelchen besseren Motiven verpflichteten Außenseiters gegen den damaligen Riesen IBM werbewirksam zu Felde gezogen ist (vgl. die berühmte Super Bowl-Werbung von Apple im Jahr 1984), hat sich auch Google zu einem „klassischen“ und mit allen harten Bandagen kämpfenden gewinnmaximierenden Konzern transformiert.
Das gilt auch für den Umgang mit den eigenen Leuten, wobei man gerade am Beispiel von Google die maximale Ambivalenz der neuen Giganten der Digitalökonomie als Arbeitgeber studieren kann: Auf der einen Seite gilt das Unternehmen als einer der beliebtesten Arbeitgeber, von einem der im Vergleich zu anderen Unternehmen und Branchen überschaubaren wenigen Jobs haben viele geträumt und tun es auch heute noch angesichts vieler Rahmenbedingungen für den einzelnen Mitarbeiter (allerdings gab es schon vor Jahren immer wieder kritische Berichte: »Lässig, kauzig, ein großer Abenteuerspielplatz: Internetgigant Google pflegt ein besonderes Image und lockt damit viele Bewerber. Doch Einsteiger sind verblüffend schnell wieder draußen. Fungiert die Firma bloß als Drehtür?« so die Fragestellung in dem Artikel Rein, raus, tschüs aus dem Jahre 2013). Auf der anderen Seite zeigt Google eben auch die Merkmale, die wir von anderen Vertretern wie Amazon & Co. kennen: Mitbestimmung über Betriebsräte oder gar Verhandlungen mit Gewerkschaften? Das ist bzw. wäre Teufelszeug. Das kommt nicht in die US-amerikanische Tüte.