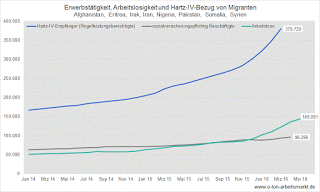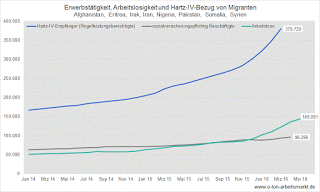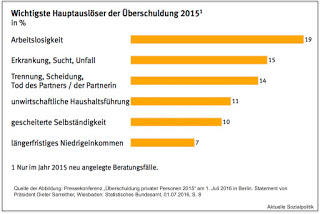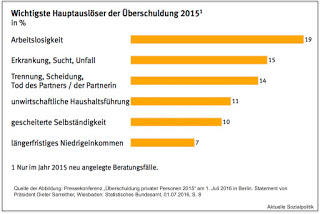Normalerweise ist es ja so, dass man es gerne sieht, wenn die eigene Beurteilung eines Sachverhalts zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt wird, so dass man sagen kann, das kam jetzt nicht überraschend. Aber wenn es sich um sozialpolitische Sachverhalte handelt, dann wird diese Neigung gegen Null gefahren, wenn man bedenkt, dass es sich oftmals um Verschlechterungen, Kürzungen oder Streichungen von Leistungen handelt, auf die Menschen angewiesen sind, die sich in Not befinden oder die sich eben nicht selbst helfen können. Oder die einer bürokratischen Maschinerie ausgeliefert sind. Davon können wir ausgehen, wenn wir über die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), umgangssprachlich auch als Hartz IV-System bezeichnet, sprechen.
Und hier hat es vor kurzem wieder einmal gesetzgeberische Aktivitäten gegeben, die auf den ersten Blick Hoffnung begründen, wenn sie denn Wirklichkeit geworden wären. Es geht um das 9. SGB II-Änderungsgesetz, das nunmehr auch sowohl im Bundestag wie auch im Bundesrat verabschiedet worden ist. Der Startpunkt liegt schon einige Jahre zurück: Im November 2012 hatte die Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) die Einrichtung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Vereinfachung des passiven Leistungsrechts im SGB II beschlossen. Über den Weg der Rechtsvereinfachung, so der explizite Auftrag, sollte Bürokratie abgebaut und in Folge die Verwaltung, also die Jobcenter, entlastet werden. Hört sich gut an. Und die Arbeitsgruppe hat auch gearbeitet. Von Juni 2013 bis Juni 2014 hat sie eine ganze Reihe an Vorschlägen erarbeitet (124 gingen in die Arbeitsgruppe und 36 sind dann von allen getragen wieder rausgekommen). Wie ein guter Schinken musste das Ergebnis abhängen, wurde angereichert um zwischenzeitlich aufgelaufene Veränderungswünsche der Politik bei arbeitsmarktpolitischen Instrumenten und ist dann nach einigen koalitionsinternen Querelen gute zwei Jahre später in den Gesetzgebungsprozess eingespeist worden.
Aber was ist herausgekommen? Man kennt das Muster: Da startet man mit einer guten, ehrenwerten Absicht (Recht vereinfachen, Bürokratie abbauen, die Verwaltung entlasten) und landet am Ende bei Gegenteil (das Recht wird komplizierter, die Bürokratie schlägt neue und zusätzliche Kapriolen und die Verwaltung kollabiert). Leider keine übertriebene Kurzfassung dessen, was Union und SPD da abgeliefert haben.
Dabei hört sich das alles doch so vielversprechend an: „Ziel dieses Gesetzes ist es …, dass leistungsberechtigte Personen künftig schneller und einfacher Klarheit über das Bestehen und den Umfang von Rechtsansprüchen erhalten und die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Jobcentern anzuwendenden Verfahrensvorschriften vereinfacht werden“, konnte man dem Gesetzentwurf entnehmen.
Im Rahmen einer Sachverständigenanhörung im Arbeits- und Sozialausschuss des Deutschen Bundestages, die am 30. Mai 2016 in Berlin stattgefunden hat (vgl. dazu Experten bezweifeln eine Entlastung der Jobcenter), zu der auch der Verfasser geladen war, wurden wie üblich schriftliche Stellungnahmen abgegeben. In meiner Stellungnahme (vgl. dazu Deutscher Bundestag, Ausschuss für Arbeit und Soziales, Ausschussdrucksache 18(11)645 vom 26. Mai 2016, S. 127-133) findet man am Ende der Ausführungen dieses Fazit:
»In der Gesamtschau ist das teilweise allein aufgrund des Detaillierungsgrades extrem komplizierte 9. SGB II-Änderungsgesetz zurückzuweisen. Es macht viele Dinge komplizierter, belastet Leistungsberechtigte zusätzlich und verschärft die heute schon vorhandene Unwucht zuungunsten der Leistungsberechtigten und führt vor allem nicht nur nicht zu einer erkennbaren Entlastung der Jobcenter-Mitarbeiter, sondern wird deren Belastung in der Summe weiter erhöhen.« (S. 132)
Das war wie gesagt Ende Mai und auch zahlreiche andere Sachverständige bzw. Organisationen hatten sich äußerst kritisch zu den damals noch geplanten, mittlerweile verabschiedeten Änderungen im SGB II positioniert. Keiner kann also sagen, man habe es nicht wissen können.
Und im August 2016 berichtet Kristiana Ludwig in ihrem Artikel Nachhaltig überlastet: »Ein neues Gesetz sollte die Mitarbeiter in Jobcentern eigentlich entlasten. Stattdessen habe es für mehr Arbeit gesorgt, kritisieren sie. Die Arbeitslosen frustriert es.«
Knapp »einen Monat, nachdem viele der neuen Regeln in Kraft getreten sind, erheben Jobcenter-Mitarbeiter schwere Vorwürfe gegen die Ministerin: Ihr Gesetz habe das Gegenteil bewirkt und die Überlastung der Mitarbeiter noch verschärft.«
Auslöser für diesen Artikel ist ein Brief, den die Personalräte der Jobcenter an den zuständigen Ausschuss des Bundestages sowie an die Arbeitsministerien der Bundesländer geschrieben haben. Das Original findet man hier:
Die Jobcenterpersonalräte nach § 44h Abs.4 SGB II: Stellungnahme zum 9. ÄndG SGB II / Rechtsvereinfachungen und Mehraufwand, Hannover, 24.08.2016
Ludwig berichtet in ihrem Artikel von einigen der Kritikpunkte der Personalräte: Jobcenter sollen Hartz-IV-Empfänger künftig auch dann noch beraten, wenn sie bereits einen Job gefunden haben. Sie sollen die Menschen ausführlicher über ihre Rechte aufklären und sich auch um Azubis kümmern, deren Lohn nicht zum Leben reicht. „Wir finden es gut, die Beratung zu verbessern, aber wir brauchen mehr Mitarbeiter, um das zu schaffen“, wird Moritz Duncker aus dem Vorstand der Jobcenterpersonalräte zitiert.
Das muss man vor dem Hintergrund einer seit längerem im bestehenden System gegebenen Unterausstattung der Jobcenter mit Personal sehen. Das Bundesarbeitsministerium höchstselbst hatte vor drei Jahren die Unternehmensberatung Bearing Point beauftragt, den Personalbedarf in denjenigen Abteilungen der Jobcenter zu untersuchen, die das Arbeitslosengeld auszahlen. 200 bis 600 Vollzeitstellen hätten damals in dieser Sparte bundesweit gefehlt, so der damalige Befund (vgl. den Forschungsbericht des BMAS Personalbemessung Leistungsgewährung in den gemeinsamen Einrichtungen SGB II vom Januar 2015). Zwar wurden diese Stellen mit Zeitverzögerung Schritt für Schritt besetzt, aber seit dem gab es keine neue Personalbemessung, während sich die Aufgaben natürlich in der Zwischenzeit verändert haben und teilweise auch ausgeweitet wurden bzw. gerade werden, wenn wie an dieser Stelle mal an die vielen Flüchtlinge denken, von denen immer mehr nach ihrer Anerkennung in das Hartz IV-System kommen und dort versorgt werden müssen. Hinzu kommt jetzt die Umsetzung der Neuregelungen durch das 9. SGB II-Änderungsgesetz.
Ludwig erwähnt in ihrem Artikel, dass die Personalräte der Jobcenter bereits im vergangenen Jahr das Bundesarbeitsministerium gedrängt haben, eine neue Personalbemessung durchzuführen. Und hier findet man einen entlarvenden Passus:
»Nach langen Debatten mit Ländern und Kommunen holten ihre Mitarbeiter demnach im Dezember ein Schreiben der Arbeitsagentur hervor: Man lehne die Studie zum Personalbedarf grundsätzlich ab, stand darin. Schließlich würden so „keine Potenziale für Verbesserungen, sondern in der Regel Stellenbedarfe ausgewiesen“. Damit habe das Ministerium das Projekt für gescheitert erklärt. Auf einen Alternativvorschlag warteten die Mitarbeitervertreter bis heute vergeblich.«
Das wäre fast schon als putzige Argumentation zu bezeichnen, wenn sie nicht so handfeste Konsequenzen für die Betroffenen vor Ort hätte. Der „moderne Dienstleister am Arbeitsmarkt“, wie sich die Bundesagentur für Arbeit selbst gerne beschreibt in Fortsetzung der offiziellen Betitelung der Hartz-Kommission aus dem Jahr 2002, lehnt also eine Studie zum Personalbedarf ab, weil durch eine solche „keine Potenziale für Verbesserungen, sondern in der Regel Stellenbedarfe ausgewiesen“ werden. Ja genau. Das ist eigentlich der Zwecke einer Personalbemessung, wie es – wiederum eigentlich – betriebswirtschaftlicher Standard ist. Die Ablehnung der BA hätte korrekterweise so formuliert werden müssen:
Also wir wissen natürlich, dass eine echte Analyse der Personalsituation ergeben würde, dass die Jobcenter im gegebenen System unterausgestattet sind mit Personal, mithin Personalmehrbedarf herauskommen wird. Da wir diesen aber nicht decken können bzw. wollen, verzichten wir lieber gleich auf die Analyse und um das nicht zugeben zu müssen, verkleistern wir das mit dem „Argument“, dass man über diesen Weg nicht die Rationalisierungs- und Produktivitätssteigerungseffekte (wie man die auch immer erreichen will) abbilden kann. Ja, stimmt, weil das zwei unterschiedliche Dinge sind, wie man im ersten Semester Personalwirtschaft lernen sollte.
Aber wieder zurück zu den aktuellen Ausführungen der Jobcenter-Personalräte mit Blick auf das doch so hoffnungsversprechend gestartete Projekt Rechtsvereinfachung und Bürokratieabbau, das nun in das 9. SGB II-Änderungsgesetz gegossen worden ist.
Kristiana Ludwig zitiert in Anknüpfung an die erwähnte Personalbedarfsanalyse von Bearing Point aus dem Jahr 2013 ein Beispiel:
»Als das Beratungsunternehmen 2013 die Mitarbeiter danach fragte, was ihnen die meiste Zeit raube, nannten fast 80 Prozent von ihnen die sogenannten Rückforderungen. Denn vor allem Geringverdiener, die mit Hartz IV ihren schmalen Lohn aufstocken, müssen regelmäßig Beträge an das Jobcenter zurückzahlen: Wenn ihr Einkommen schwankt und die Behörde mehr zugeschossen hat, als sie müsste, bekommen sie zum Teil Monate später eine Rechnung. Selbst Kleinstbeträge von wenigen Euro fordern die Ämter zurück. Wer nicht zahlt, der bekommt Mahnungen. Denn auch bei Cent-Beträgen kennt die Arbeitsagentur keine Kulanz.
Während der Beratungen für das neue Gesetz hatten viele Experten gefordert, Arbeitslosen und Jobcentern das Leben zu erleichtern, indem auf die Eintreibung von Kleinstbeträgen verzichtet wird. Doch Nahles blieb bei der aufwendigen Praxis.«
Werfen wir einen Blick in das Original, also in die Stellungnahme zum 9. ÄndG SGB II / Rechtsvereinfachungen und Mehraufwand der Jobcenterpersonalräte, die Harald Thomé dankenswerterweise auf seiner Seite eingestellt hat und schauen uns einige ausgewählte Kritikpunkte der Personalräte einmal genauer an:
Da wird beispielsweise unter der sperrigen Überschrift „Erbringung von Eingliederungsleistungen in Arbeit an Anspruchsberechtigte von Arbeitslosengeld oder Teilarbeitslosengeld durch die Agenturen für Arbeit (§ 5 Abs. 4 SGB II)“, was als ein Beispiel für die „Entlastung“ der Jobcenter durch die gesetzliche Neuregelung angeführt wird, da nun die Arbeitsagenturen die Arbeit abnehmen sollen, auf folgende Relativierung hingewiesen:
»Mit Stand März 2016 gab es 91.000 sogenannte Aufstocker, die zusätzlich zu ihrem Arbeitslosengeld oder Teilarbeitslosengeld auch Grundsicherungsleistungen bezogen haben. Bei insgesamt 4.328.093 erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die durch die Arbeitsvermittlung der Jobcenter zu betreuen waren, reduziert sich der Erfüllungsaufwand in der Arbeitsvermittlung der Jobcenter um rund 2,1%. Dies ist also bereits kein riesiger Schritt zur Entlastung in der Arbeitsvermittlung der Jobcenter.«
Und auch diese minimale „Entlastung“ zerbröselt in der Wirklichkeit, denn die Personalräte der Jobcenter weisen darauf hin, »dass im SGB II der Ansatz der ganzheitlichen Beratung der Bedarfsgemeinschaft verankert ist und Bedarfsgemeinschaften häufig aus mehr als nur einer Person bestehen. In diesen Fällen wird eine weitere Schnittstelle zwischen Jobcentern und Agenturen für Arbeit geschaffen und der Ansatz der ganzheitlichen Beratung zumindest erheblich erschwert. Es wird ja nur der eigentliche Aufstocker durch die Arbeitsvermittlung der Agentur für Arbeit betreut, der Rest der Bedarfsgemeinschaft verbleibt in der Arbeitsvermittlung der Jobcenter.« Am Ende kann als Ergebnis der geplanten Entlastung herauskommen: Für die Jobcenter ändert sich nichts, aber die Agenturen für Arbeit werden stärker belastet.
Ein weiterer kritischer Punkt aus Sicht der Beschäftigtenvertreter ist die – ebenfalls sicher gut gemeinte und als Verbesserung für die „Kunden“ daherkommende – „Ausdehnung der Beratungspflicht der Jobcenter (§ 14 Abs. 2 SGB II)“. Im neuen § 14 Abs. 2 S. 3 SGB II wird nun festgeschrieben: „Art und Umfang der Beratung richten sich nach dem Beratungsbedarf der leistungsberechtigten Person.“ Dazu wird angemerkt:
»Im Bereich der Massenverwaltung geht die Rechtsprechung bisher davon aus, dass der Sozialleistungsträger lediglich zu einer Beratung verpflichtet ist, die sich aufgrund von konkreten Fallgestaltungen unschwer ergibt (Bundessozialgericht, Urteil vom 24. Juli 2003, B 4 RA 13/03 R). Es bleibt abzuwarten, welche Anforderungen die Sozialgerichte an die neue Beratungspflicht innerhalb des SGB II knüpfen werden. Dem Wortlaut der Gesetzesbegründung zu folge ist jedoch bereits jetzt klar, dass es sich bei dieser Regelung um keine Entbürokratisierung handelt. Diese Norm wird selbstverständlich zu einem Mehraufwand in den Jobcentern führen.«
Das nächste Beispiel aus dem Brandbrief der Jobcenterpersonalräte bezieht sich auf einen Sachverhalt, der vor kurzem in den Medien kritisch aufgegriffen wurde und zu solchen Schlagzeilen geführt hat: Hartz-IV-Empfänger sollen stärker kontrolliert werden: »Die Jobcenter sollen die Einkünfte von Hartz-IV-Haushalten künftig häufiger kontrollieren. Der Datenabgleich soll nun einmal monatlich erfolgen – statt wie bisher einmal im Quartal«, so Cordula Eubel in ihrem Artikel. Die Neuregelung besteht aus zwei Komponenten: Zum einen die Verkürzung des zeitlichen Abstands der Überprüfungen auf einen monatlichen Rhythmus und in den Datenabgleich werden auch Personen einbezogen, die in einem Haushalt mit einem Hartz IV-Bezieher leben, aber selbst keine Leistungen beziehen. Dazu die Jobcenterpersonalräte unter der Überschrift „Die Erhöhung der Frequenz des automatisierten Datenabgleichs (§ 52 Abs. 1 S. 3 SGB II)“:
»Es wäre erforderlich, hier eine technische Lösung einzuführen, im Zuge derer die Überschneidungsmitteilungen direkt mit den Angaben aus dem Leistungsfachverfahren Allegro abgeglichen werden und bereits bekannte Meldungen automatisiert aussortiert werden. Dies wäre eine echte Verfahrensvereinfachung. Durch die Erhöhung der Frequenz des händisch durchzuführenden Datenabgleichs fürchten wir jedenfalls erhebliche Mehrbelastungen.«
Jeder, der schon mal in einer Massenverwaltung gearbeitet hat, kennt die furchterregende Bedeutung der Begrifflichkeit „händisch durchzuführender Datenabgleich“.
Und der letzte in diesem Beitrag zu erwähnende Kritikpunkt aus den Reihen der Jobcenter-Beschäftigten wird sich jedem sofort erschließen, der Verwaltungserfahrung hat – für die anderen klingt das nach böhmischen Dörfern:
»Zu guter Letzt ist auch der Mehraufwand zu erwähnen, den die Belegschaften der Jobcenter schlichtweg damit haben, sich in die neuen Regelungen einzuarbeiten und sich diese anzueignen. Auch die IT-Verfahren sind auf die neue Gesetzeslage hin anzupassen und ihre diesbezügliche Handhabung muss von den Belegschaften ebenfalls erlernt werden. Es ist vorgesehen, dass die technische Umsetzung erst im März 2017 mit einer neuen Programmversion beginnen wird und voraussichtlich im November 2017 abgeschlossen sein wird. Bis dahin erfordert das 9. SGB II-Änderungsgesetz insgesamt 9 Übergangsregelungen und 3 Verfahrenshinweise. Diese Umgehungslösungen sind in der Regel sehr umständlich, arbeits- und zeitintensiv und schwer nachvollziehbar.«
Ja, so ist das. Da macht man in Berlin eine umfangreiche, kleinteilige Gesetzesänderung, setzt das in Kraft und denkt: jetzt läuft’s. Aber dass das umgesetzt werden muss in den technischen Systemen, dass die Leute geschult werden müssen, dass sie übergangsweise Krücken-Lösungen praktizieren müssen, weil die neue Rechtslage noch nicht abgebildet sind in den IT-Systemen, daran denken die Praktiker, nicht aber die Theoretiker.
Und wir haben an dieser Stelle noch gar nicht gesprochen von den zusätzlichen Arbeiten, die sich ergeben werden aus der Tatsache, dass das 9. SGB II-Änderungsgesetz zahlreiche Regelungen enthält zuungunsten der Hartz IV-Empfänger, die zu neuen Klageverfahren vor den überlasteten Sozialgerichten führen werden – bereits in meiner schriftlichen Stellungnahme für die Anhörung im Deutschen Bundestag habe ich dazu geschrieben, »dass im Ergebnis aus einem „Rechtsvereinfachungsgesetz“ mit Blick auf Teile der Betroffenen ein „Rechtsverschärfungsgesetz“ geworden ist, da über einzelne, teilweise höchst diffizile Regelungen reale Verschlechterungen für die Leistungsberechtigten zu erwarten sind« (Deutscher Bundestag, Ausschuss für Arbeit und Soziales, Ausschussdrucksache 18(11)645 vom 26. Mai 2016, S. 128).
Und das alles findet statt im Kontext einer ganz erheblichen Zunahme der zusätzlichen Arbeitsbelastung der Jobcenter, die sich dadurch ergibt, dass nunmehr und spürbar immer mehr Flüchtlinge nach ihrer Anerkennung in das Grundsicherungssystem wechseln, das in vielen Fällen für viele Jahre für sie zuständig sein wird, selbst wenn der eine oder andere eine Beschäftigung finden wird, denn oftmals bleiben die dann als Aufstocker mit ihrer Bedarfsgemeinschaft den Jobcentern erhalten, weil sie zu wenig verdienen (können), um aus der Hilfebedürftigkeit herauszukommen. Man darf an dieser Stelle zugleich daran erinnern, dass die vielen geflüchteten Menschen, die nun von den Jobcentern betreut werden müssen, nicht nur eine quantitative Zunahme der Hilfeempfänger darstellen, sondern das eine Vielzahl weiterer Aufgaben damit einhergehen, man denke hier nur an die Frage der Sprachfähigkeit. Um nur ein Beispiel zu nennen.
Im Zusammenspiel aller genannten Entwicklungen wird das Jobcenter-System in den kommenden Monaten weiter heiß laufen. Das hat natürlich auch Auswirkungen für diejenigen, die vor dem Schreibtisch der Jobcenter-Mitarbeiter sitzen. Dazu Kristiana Ludwig in ihrem Artikel: »Harald Thomé vom Erwerbslosenverein Tacheles in Wuppertal sagt, die überlasteten Mitarbeiter führten bei den Arbeitslosen zu viel Frustration. Oft bleibe nicht genug Zeit für den einzelnen Fall: Die Zuständigen wechselten häufig, Fehler passierten.« Das werden einige, vor allem oben, als einen eben unvermeidbaren „Kollateralschaden“ bezeichnen.
Für andere hingegen stellt sich das alles als ein sozialpolitisch nicht akzeptables Systemversagen dar. Und keiner kann sagen, man sei „überrascht“ worden von der wirklichen Wirklichkeit oder „überrollt“ von den Ereignissen, die man nicht habe vorhersehen können. Hier ist die Beweislage ziemlich eindeutig. Diese Ausreden gelten nicht.