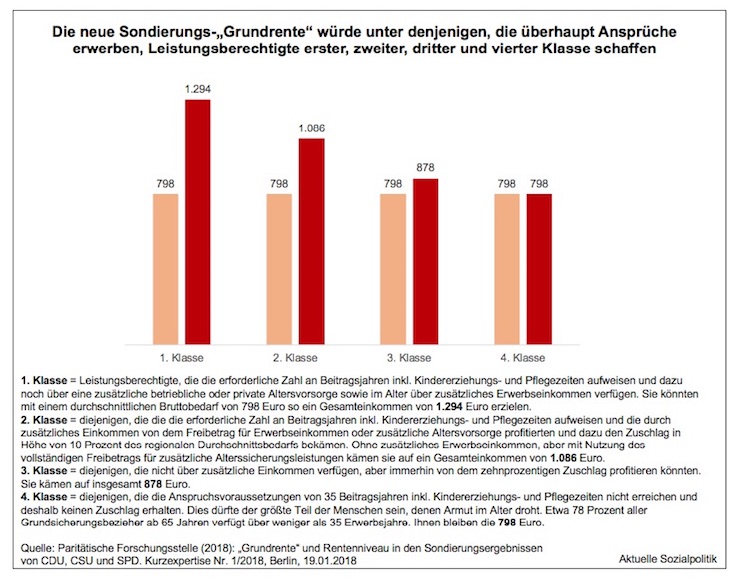Immer wieder wird man mit dem Vorwurf konfrontiert, dass das deutsche Sozialrecht zu großzügig sei bzw. vor allem von den Sozialrichtern so ausgelegt werde zugunsten der Leistungsbezieher und dass man – so die Empfehlung – doch genauer hinschauen sollte und Leistungen auch verweigern müsse, wenn denn da noch was anderes bei den Betroffenen zu holen ist. Nun werden sich viele Menschen, die in den weiten Welten der Sozialgesetzbücher unterwegs sein müssen, für solche Aussagen bedanken und darauf hinweisen, dass in vielen Bereichen nicht bewilligt oder andere Mittel angerechnet werden, bis es kracht. Gerade die Hartz IV-Empfänger wissen ein Lied von Einkommensanrechnungen und Leistungskürzungen zu singen.
Und erneut werden wir Zeugen der Unerbittlichkeit der Vorschriften, denen es egal ist, wer an ihnen abprallt. Diesmal geht es um Menschen, die als Überlebende die von Deutschland ans Tageslicht geholte Hölle auf Erden hinter sich haben, also um die Opfer des Holocaust. Es werden immer weniger, die noch dazu gehören und die eigentlich – sollte man meinen – wenigstens am Ende ihres Lebens halbwegs ordentlich behandelt werden von dem Staat, der die juristische und moralische Nachfolge dessen angetreten hat, was als „Drittes Reich“ nicht nur semantisch verklärt wird.