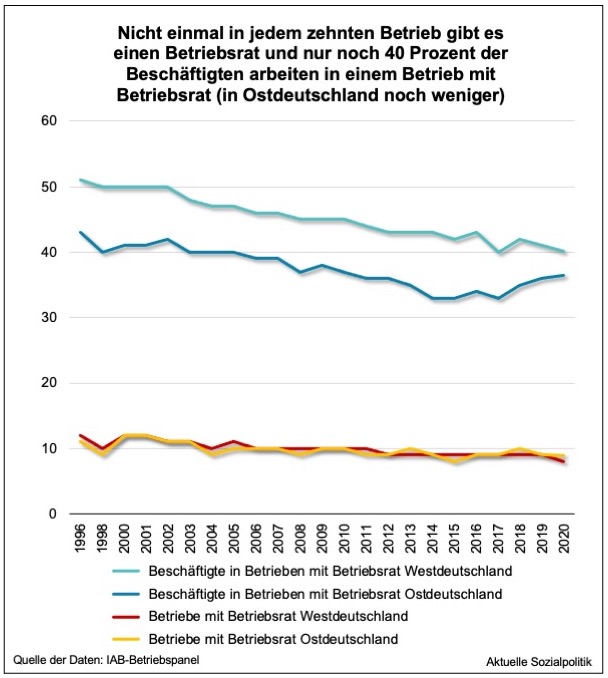Die erste Warnstreikwelle der in der Gewerkschaft GDL organisierten Lokführer bei der Deutschen Bahn haben wir bereits hinter uns, nun rollt die zweite. Auf der einen Seite gibt es viel Kritik an den Arbeitskampfmaßnahmen der kleineren der beiden Gewerkschaften bei der Bahn, aber die GDL scheint anders als die DGB-Gewerkschaft EVG deutlich stärker den klassischen Vorstellungen von gewerkschaftlicher Gegenmacht zu entsprechen.
Immer wieder kann man mit Blick auf „die“ Pflege lesen oder hören, dass es nur dann deutliche Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte geben wird, wenn es auch in diesem so bedeutsamen Bereich der Daseinsvorsorge die Drohung, letztendlich auch die Realisierung spürbarer Arbeitsniederlegungen geben wird. Aber „leider“ seien „die“ Pflegekräfte aus ganz unterschiedlichen Gründen dazu nicht bereit oder willens, ihr gewerkschaftlicher Organisationsgrad sei hundsmiserabel, sie stehen sich selbst im Wege hinsichtlich eines Streiks aufgrund dessen, was sie tun – eben nicht irgendwas produzieren oder machen, was man einfach stehen lassen kann.
Zuweilen kommt dann sowas aus der Politik: Nordrhein-Westfalens Gesundheits- und Sozialminister Karl-Josef Laumann wünscht sich mehr kämpferisches Auftreten von Deutschlands Pflegekräften. „Ich wäre froh über einen Lokführer-Moment in der Pflege“ – mit diesen Worten wird der CDU-Politiker zitiert. »Die Beschäftigten in der Pflege müssten sich dringend besser gewerkschaftlich organisieren. Tarifverträge müssten erkämpft werden, erklärte der Bundesvorsitzende der CDU-Sozialausschüsse.«