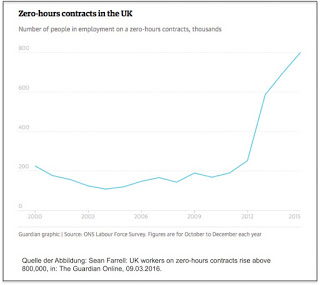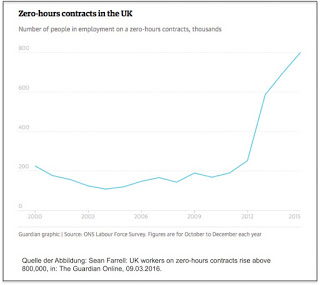Das Thema Werkverträge und der Grenzbereich zur illegalen Arbeitnehmerüberlassung ist mal wieder ans Tageslicht befördert worden. Schon seit Jahren ein Thema und auch derzeit Teil der gesetzgeberischen Aktivitäten einer „Reform“ der Leiharbeit, konkret des AÜG (vgl. hierzu weiterführend Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze, am 17. Oktober 2016 wird im Ausschuss für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages eine Sachverständigenanhörung zum Gesetzentwurf stattfinden). Eigentlich ist der Unterschied simpel: Wenn sich ein Unternehmen Personal entleiht von einem Leiharbeitsunternehmen, dann kann es diese Mitarbeiter in seinem Unternehmen so verwenden, als wären sie seine „normalen“ Beschäftigten, er hat dann auch das Direktionsrecht gegenüber den entliehenen Arbeitnehmern. Wenn das Unternehmen hingegen ein Subunternehmen beauftragt, einen Werkvertrag zu erledigen, dann dürfen die Mitarbeiter im Werkvertrag nicht eingegliedert werden in die normale Belegschaft und das Werkvertragsunternehmen muss als „Betrieb im Betrieb“ fungieren. Es schuldet dem Auftraggeber ein vereinbartes Werk (oder beim Dienstvertrag eine vereinbarte Dienstleistung).
Und nun erreichen uns wieder einmal Berichte aus dem Drogeriemarktbereich, den viele immer noch mit der untergegangenen Welt von Schlecker assoziieren. Oder mit dm – oder mit Rossmann. Und um das letzte Unternehmen geht es konkret und damit um den „Vorzeigeunternehmer“ Dirk Roßmann.
Das Politikmagazin „Report Mainz“ hat sich nun mit einem Beitrag in die Öffentlichkeit begeben, der allerdings eher auf das Gegenteil verweist: Der Vorzeigeunternehmer Rossmann steht erneut in der Kritik, so ist der überschrieben: Mitarbeiter von Fremdfirmen in „Rossmann“-Filialen klagen über schlechte Arbeitsbedingungen und Bezahlung.
»Dirk Roßmann gilt als Vorzeigeunternehmer. Er hat das Firmenimperium mit mehr mit als 3.000 Filialen und einem Umsatz von fast 8 Milliarden Euro aufgebaut. In der Öffentlichkeit sieht er sich gern in der Rolle des stets um seine Mitarbeiter bemühten Firmenpatriarchen.
Gemeinsame Recherchen des Magazin stern und von REPORT Mainz zeigen allerdings, dass es neben den relativ gut bezahlten Rossmann-Mitarbeitern auch tausende Billiglöhner in den Filialen gibt. Sie sind Mitarbeiter einer Fremdfirma, mit der Rossmann einen so genannten Werkvertrag geschlossen hat. Doch ob diese Konstruktion juristisch in diesem Fall wirklich legal ist, daran bestehen erhebliche Zweifel. Würde sich stattdessen der Verdacht der illegalen Arbeitnehmerüberlassung bestätigen, hätte das gravierende Folgen für die Firma Rossmann.«
Der stern berichtet unter der Überschrift: Verdacht illegaler Arbeitnehmerüberlassung bei Rossmann. Dort findet man diese Hinweise:
»Beim Einsatz von Werkvertragsarbeitern in Filialen der Drogeriekette Rossmann könnten rechtliche Regeln gebrochen worden sein … Rossmann setzt für Einräumarbeiten in seinen Filialen tausende Mitarbeiter des Subunternehmens Promota.de auf Basis von Werkverträgen ein. Interne Firmenunterlagen, Filmaufnahmen aus Rossmann-Filialen und Aussagen von Mitarbeitern und legen jedoch den Verdacht nahe, dass Angestellte des Subunternehmens und Rossmann-Stammbeschäftigte in den Filialen enger zusammenarbeiten, als dies nach den Regeln für Werkverträge zulässig ist.«
Rossmann und Promota.de haben solche im Raum stehenden Vorwürfe bisher stets mit Verweis auf bestandene Überprüfungen durch den Tüv Rheinland zurückgewiesen. Nun allerdings haben die recherchierenden Journalisten Material bekommen, das diesen Beleg für ordentliches Verhalten fragwürdig erscheinen lässt, angereichert um Filmaufnahmen:
»Nach einer internen Schulungsunterlage der Promota.de-Tochter Tempus vom Frühjahr 2016 verändert das Subunternehmen seine Arbeitsabläufe jedoch offenbar gezielt dann, wenn die Tüv-Prüfer in den Rossmann-Filialen erscheinen. So sollen die Einräumer „während des Audits“ spezielle „Besonderheiten“ beachten und Regale nicht gleichzeitig mit Rossmann-Mitarbeitern einräumen. „Die Ausübung der gleichen Tätigkeit“ von Mitarbeitern der Drogeriekette und des Subunternehmens „zur gleichen Zeit ist ein Indiz für ‚verdeckte Arbeitnehmerüberlassung‘ und gefährdet den Werkvertrag“, ermahnte das Unternehmen seine Teamleiter. Sind keine Tüv-Prüfer im Haus, sei es hingegen vollkommen normal, dass die Werkarbeiter die Regale zeitgleich mit Rossmann-Mitarbeitern einräumen, bestätigten Promota.de-Mitarbeiter dem stern. Das gleiche Bild zeigte sich auf Filmaufnahmen aus Rossmann-Filialen in verschiedenen deutschen Städten, die „Report Mainz“ vorliegen.«
Peter Schüren, Professor für Arbeitsrecht an der Universität Münster und ein ausgewiesener Kenner der Werkvertragsproblematik, wird zitiert mit den Worten, dass es angesichts des Materials „ernsthafte Verdachtsmomente, die für eine illegale Arbeitnehmerüberlassung sprechen“, geben würde. Seiner Auffassung nach sollten hier die Behörden aktiv werden, die für die Bekämpfung von Scheinwerkverträgen zuständig sind: „Das ist ein Fall für den Zoll.“
In dem Fernsehbeitrag von „Report Mainz“ »klagen mehrere Mitarbeiter der Fremdfirmen zudem über schlechte Arbeitsbedingungen und miese Bezahlung. Sie empfinden die Arbeit als „Ausbeutung“ und „erniedrigend“ angesichts der Tatsache, dass sie im Vergleich zu „Rossmann“-Mitarbeitern viel weniger verdienten. Fahrten zwischen verschiedenen Einsatzorten würden nicht als Arbeitszeit bezahlt. Vielfach müsse umsonst gearbeitet werden, um zeitliche Vorgaben zu erfüllen.«
Und wir erfahren auch – nicht wirklich überraschend bei solchen Konstruktionen: „Rossmann“ ist zu 49 Prozent an der Firma „Promota.de“ beteiligt.
Aber der eine oder andere wird sich erinnern – Rossmann, da war doch schon mal was? Und schreiben nicht auch die Redakteure von „Report Mainz“, dass das Unternehmen „erneut“ in der Kritik stehe?
Genau, schon im Mai 2012 erschien im Handelsblatt ein hervorragend recherchierte Artikel von Massimo Bognanni unter der Überschrift Die verborgene Seite des Rossmann-Reiches. Im Lichte der neuen Vorwürfe gegen das Unternehmen lohnt der Blick in diesen Artikel: Statt auf Stammpersonal setzt der Drogeriekonzern Rossmann auf billige Arbeitskräfte ausländischer Subunternehmen – und die Insider werden nicht wirklich überrascht sein, dass in der Beschreibung der konkreten Umsetzung des Lohndumping die Werkverträge auftauchen. Bognanni beschrieb das Konstrukt damals so:
„Was die meisten Kunden nicht ahnen: Nicht alles bei Rossmann ist besser als bei Schlecker. Es gibt auch eine dunkle, verborgene Seite des Rossmann-Reiches. Handelsblatt-Recherchen werfen erstmals Licht auf ein Geflecht aus Subunternehmen mit englischen Namen und polnischen Töchtern.
Nicht ohne Grund arbeiten die Subunternehmen im Verborgenen. Ihre Beschäftigten befüllen bei Rossmann die Regale, erledigen Inventuren, sitzen an der Kasse. Sie sind Billiglöhner, verdienen deutlich weniger, als es die Einzelhandelstarife vorgeben.
Die Potsdamer „Instore Solution Services GmbH“ (ISS) ist so ein dunkler Fleck. Dirk Roßmanns Investitionsfirma ist an der ISS mit 49 Prozent beteiligt. So steht es im Jahresabschluss der „Rossmann Beteiligungs GmbH“ vom Sommer 2011. Knapp 32 Millionen Euro Umsatz machte die ISS 2010 und 1,27 Millionen Euro Gewinn. Zahlen, über die sich Dirk Roßmann freuen dürfte.
Mitarbeiter und Teamleiter der ISS haben hingegen weniger zu lachen. Sie berichten dem Handelsblatt, wie das System Rossmann funktioniert: In den frühen Morgenstunden rücken sie an. Auf Palettenwagen stehen die Shampoo-Flaschen, Baby-Gläschen und Deko-Kerzen, die sie in die Regale räumen. Ein Sortiment von über 17 000 Produkten. Bis neun Uhr, wenn die Läden öffnen, sollen die ISS-Leute fertig sein. Brauchen sie länger, verdienen sie für die Überstunden meist nichts, klagen Beschäftigte.
Der Drogerieunternehmer profitiert indes doppelt von den billigen Arbeitskräften: durch seine Beteiligung an der ISS einerseits, durch die gedrückten Löhne andererseits. Der Verdi-Tarifvertrag in Niedersachsen sieht für das Wareneinräumen einen Stundenlohn von mindestens 9,86 Euro vor. Doch bei Rossmann gibt es eine andere Lösung: den Werkvertrag. Damit überträgt Rossmann das Regaleinräumen von der Stammbelegschaft auf die ISS. Und das ist deutlich billiger.
Denn die Werkvertragler haben einen eigenen Tarifvertrag. Dieser, unterzeichnet vom Arbeitgeberverband „Instore und Logistik Services“ und der Gewerkschaft DHV, sieht im Westen einen Stundenlohn von 6,63 Euro vor, in Ostdeutschland sind es 6,12 Euro. Ersparnis im Vergleich zum Verdi-Vertrag: 33 Prozent. Und die Werkverträge haben weitere Vorzüge: Im Gegensatz zu der Zeitarbeit muss der Betriebsrat einer Auslagerung an Werkvertragler nicht zustimmen. „Für uns sind die ISS-Beschäftigten die einzige Möglichkeit, an der Personalkostenschraube zu drehen“, erklärt ein Rossmann-Bezirksleiter.
Wie viele der ISS-Werkvertragler für die Drogeriekette arbeiten, verrät Rossmann auch nicht. Nur so viel: Die ISS-Arbeiter befüllen in jeder zweiten Filiale Regale der Drogeriekette, in über 800 Märkten.
Eine weitere Investition der Rossmann’schen Beteiligungsgesellschaft ist die „Instore Solutions Personell GmbH“ (ISP). An der Leiharbeitsfirma hält Roßmann 22,5 Prozent. ISP-Leiharbeiter sitzen in Filialen an der Kasse. „Ich habe in Märkten gearbeitet, in denen ISP-Leiharbeiter kassierten, ISS-Leute die Regale befüllten. Nur noch ein Kollege arbeitete direkt für Rossmann – und das war der Filialleiter“, berichtet ein Werkvertrages.
Auch bei den Inventuren setzt die Firma auf ein Subunternehmen. In Rossmann-Filialen zählen Billiglöhner der polnischen Firma „Invent“ die Bestände. Invent ist als Tochter der „ISS Polska“ mit der Potsdamer ISS verbunden. 250 Zloty, umgerechnet 59,42 Euro, bekommt ein polnischer Inventurhelfer brutto am Tag. Die Schichten dauern bis zu neun Stunden – das macht einen Stundenlohn von 6,60 Euro. In Niedersachsen sieht der Tarifvertrag für Inventurhelfer einen Stundenlohn von 7,73 Euro vor.“
Sollten sich die neuen Vorwürfe gegen das Unternehmen erhärten, dann hätten wir es also mit einem „Wiederholungstäter“ zu tun. Man wird abwarten müssen, ob Ermittlungen aufgenommen werden und was die rechtlich verwertbar zu Tage fördern (können), denn das ist eines der zentralen Probleme beim Kampf gegen die missbräuchliche Verwendung von Werkverträgen: Der gerichtsverwertbare Nachweis.
Und wenn wir schon im Themenfeld Werkverträge und Abgrenzung zur Leiharbeit sind, kann man an dieser Stelle auch mit Blick auf einen Bericht, der vor mehreren Jahren einen Moment lang die mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, folgendes berichten:
Manche werden sich noch erinnern an das Frühjahr 2013, als die SWR-Reportage Hungerlohn am Fließband über Werkverträge und Leiharbeit beim Premium-Hersteller Daimler im ARD-Fernsehen ausgestrahlt wurde. Im Anschluss wurde das Thema bei „Hart aber fair“ aufgegriffen. Der SWR-Journalis Jürgen Rose hatte undercover beim Daimler gearbeitet und gefilmt. Der Konzern war not amused (um das mal vornehm auszudrücken) und hat den SWR mit Klagen überzogen, um die weitere Ausstrahlung zu verhindern. Ganz klar ging es auch darum, den Medien ein deutliches Signal zu senden, dass man rigoros gegen jeden Nachahmer vorzugehen gedenkt und Journalisten die Finger davon lassen sollten, weil sie mit Klagen überzogen werden. In mehreren Instanzen ist Daimler aber mit diesem Ansinnen gescheitert. Und Ende September 2016 kommt nun endlich diese erfreuliche Botschaft von ganz oben: Daimler scheitert mit Beschwerde vor dem BGH. In der letzten Instanz hat der Automobilbauer nun verloren:
»Die Niederlage des Autobauers Daimler im Streit mit dem Südwestrundfunk (SWR) über eine Undercover-Reportage zu Niedriglöhnen ist endgültig besiegelt. Eine Beschwerde von Daimler wegen Nichtzulassung zur Revision sei abgewiesen worden, sagte eine Sprecherin des Bundesgerichtshofs (BGH) am Mittwoch in Karlsruhe (Az.: VIZR427/15).
Das Berufungsverfahren vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht (OLG) hatte Daimler 2015 verloren. Auch wenn bei dem Filmdreh das Hausrecht des Konzerns verletzt worden sei, rechtfertige der aufgedeckte Missstand den Eingriff in die Rechte der Firma, hatte das OLG 2015 entschieden.«
Allerdings kann es der Konzern nicht lassen, für die Zukunft zu drohen – und die Zielgruppe ist klar:
Eine Daimler-Sprecherin sagte, die in den Fall involvierten Gerichte hätten „bloße Einzelfallentscheidungen“ getroffen. „Vergleichbare Aktivitäten würden wir wieder ebenfalls gerichtlich klären lassen.“