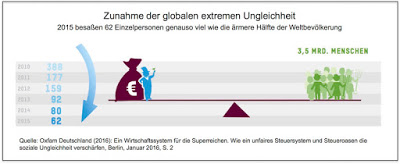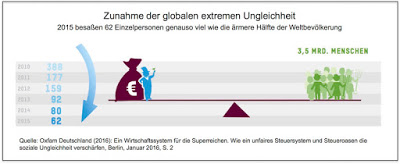Wir schreiben das Jahr 2006. Der SPIEGEL veröffentlicht einen Artikel mit dem Titel Wie ein Stück Fleisch von Markus Deggerich. Darin beschreibt er diese Szene vom Arbeiterstrich: »Meistens steigen sie nicht mal aus. Sie bremsen, mustern mit kalten Blicken in der Morgendämmerung die Wartenden am Straßenrand. Und wenn ihnen gefällt, was sie sehen, lassen sie langsam die Fensterscheibe runter und beginnen grußlos die Preisverhandlungen. Ein Tag, 50 Euro, bar auf die Hand, sagt der Fahrer im blauen Golf: „Nur für echte Kerle“, fügt er hinzu. 50 Euro sind viel Geld. Torsten Berne, 47, hebt die Hand und nickt. Und die sechs anderen Männer neben ihm auch. Einer ruft in gebrochenem Deutsch noch dazwischen „50 Euro für zwei Mann“. Aber der Golf-Fahrer entscheidet sich für Berne. Vielleicht, weil sich so starke Oberarme unter dem löchrigen Blaumann abzeichnen. Vielleicht, weil er Deutsch spricht.« Ein Beispiel von den Discount-Anbietern der Ware Arbeitskraft, damals eingefangen auf einem der „Abholmärkte für Arbeiter“, auf einem Parkplatz vor dem Treptower Park im Südosten Berlins. Und schon damals, im Jahr 2006, war klar, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt: »Auf 80.000 schätzen die Gewerkschaften die Zahl der Tagelöhner in Deutschland. Doch erfasst sind damit nur die „Sichtbaren“, wie die Statistiker erklären, jene, die sich legal mit Personalausweis und Steuerkarte bei den offiziellen Vermittlungsstellen der Arbeitsagenturen für Tagesjobs melden. Daneben gibt es noch das Heer der „Unsichtbaren“: die, ähnlich wie früher, am Arbeiterstrich stehen oder – immer öfter – sich über das Internet andienen.«
Das war vor zehn Jahren. Aber 2016?
Wir schreiben den 1. März des Jahres 2016 und man muss so eine Meldung aus München zur Kenntnis nehmen: Obdachlose Tagelöhner demonstrieren vor dem Rathaus. Aus einer so reichen, wohlhabenden Stadt, aber eben nicht für alle. Auch – und vielleicht gerade? – hier blüht der Handel mit der menschlichen Arbeitskraft aus den Kelleretagen unserer Arbeitsgesellschaft. Was ist los in München?
Inga Rahmsdorf berichtet in ihrem Artikel von Ahmed Maksud, der seit mehr als vier Jahren in München lebt.
»Er hat auf Baustellen gearbeitet und für Reinigungsfirmen, manchmal hat er seinen Lohn erhalten und manchmal nicht. Einen Arbeitsvertrag hat er fast nie bekommen. Seine Frau und seine drei Töchter wohnen in Bulgarien. Nachts schläft er in einem großen Raum der Bayernkaserne, wo die Stadt den Winter über im Kälteschutzprogramm für Menschen wie Maksud Schlafplätze zur Verfügung stellt.
Im Sommer übernachtet er auf der Straße, in Hauseingängen oder unter Büschen. Es sei schwer, ohne seine Familie zu leben, sagt er. Aber das Leben in Bulgarien ohne Arbeit und ohne Perspektive sei noch miserabler gewesen. Maksud ist EU-Bürger, er darf legal hier arbeiten, aber meist findet er nur Jobs in Schwarzarbeit.«
Ahmed Maksud steckt in einem Teufelskreis fest: »Ohne festen Arbeitsvertrag hat er in München so gut wie keine Chance auf eine Wohnung. Ohne Wohnung kann er sich nicht anmelden. Und ohne Anmeldung hat er auch keine Möglichkeit, ganzjährig einen Platz in einer Notquartier für Wohnungslose zu erhalten.«
Und weil er darin feststeckt, hat er an der Demonstration in der Schillerstraße in München teilgenommen, wo auch das Beratungszentrum für wohnungslose Migranten ist. 50 Demonstranten, überwiegend bulgarische Arbeiter, ziehen durch das Bahnhofsviertel, über den Rindermarkt bis vor das Rathaus. Die EU-Migranten wollen auf ihre Situation aufmerksam machen, ihre Kritik richtet sich dabei vor allem an die Stadt München.
Die Demonstration ist der Auftakt einer Kampagne, die EU-Migranten gemeinsam mit Initiativen organisiert haben. »Sie fordern, dass die Migranten ganztägig und ganzjährig an dem Programm für Wohnungslose teilnehmen können und dass sie sich auch ohne Wohnsitz in München anmelden können.«
Und das in einer Stadt, die wächst, wo Wohnraum knapp und teuer ist. Die offiziellen Zahlen sprechen ihre eigene Sprache:
»Derzeit geht die Stadt von insgesamt etwa 5400 wohnungslosen Menschen aus, 4600 von ihnen sind in Notquartieren, Pensionen, Clearinghäusern und Unterkünften von Wohlfahrtsverbänden untergebracht. Hinzu kommen etwa 200 bis 270 Flüchtlinge, die, obwohl sie anerkannt sind, noch in Gemeinschaftsunterkünften leben, weil sie keine Wohnung finden. Und weitere 550 Menschen leben auf der Straße, wobei das nur eine geschätzte Zahl ist.«
Um Wohnungslosenhilfe zu erhalten, muss man nicht nur nachweisen, dass man sonst nirgendwo einen Wohnsitz hat, sondern auch glaubhaft machen, dass man aus eigenen Mitteln und trotz eigener Bemühungen keine Wohnung finden kann, beschreibt Rahmsdorf in ihrem Artikel ein veritables Zugangsproblem für die betroffenen Menschen.
Schon im vergangenen Jahr gab es Berichte über den Umgang mit den Tagelöhnern in München – man könnte sich ja vorstellen, dass diesen Menschen, die nun wirklich ganz unten gelandet sind, besondere Hilfe zukommen lässt. Aber offensichtlich gibt es auch andere Varianten, wenn man diesem Artikel folgt: Stadt bezahlt Sicherheitsdienst gegen Tagelöhner:
»Tagelöhner sollen nicht an Häuserwänden lehnen oder in Hofeingängen herumstehen: Einige Geschäftsleute im Münchner Bahnhofsviertel fühlen sich durch ihre Anwesenheit massiv gestört und haben deshalb einen privaten Sicherheitsdienst engagiert. Nun übernimmt die Stadt einen Großteil der Kosten – bis zu 20 000 Euro jährlich, so hat es der Wirtschaftsausschuss einstimmig beschlossen.«
Einer dieser klassischen Konflikte: Die Geschäftsleute fühlen sich vor Ort belästigt und haben Angst, dass Kunden wegbleiben: „Die Kreuzung sowie anliegende Gebäude und Ladengeschäfte werden mittlerweile regelmäßig belagert von stetig wachsenden Mengen von Arbeitern“, so wurde es schon in einer Petition aus dem Jahr 2013 vorgetragen.
Und die andere Perspektive kann mit diesen Zeilen angerissen werden: »In den geregelten Münchner Arbeitsmarkt zu kommen, ist für die Männer und Frauen schwer, viele haben nicht einmal eine Bleibe und schlafen im Sommer in Parks oder in Hofeinfahrten. „Und dann kommt die Polizei und verhaftet uns“, sagt ein anderer, der seit vier Monaten in München ist. „Wir werden hier behandelt wie Straßenköter.“«
Aber auch das ist München: Man hatte damals nicht nur den hier angesprochenen Beschluss gefasst, den Sicherheitsdienst gegen die Tagelöhner mitzufinanzieren, sondern auch, dass von den Arbeitern und von Sozialverbänden seit langem geforderte Beratungscafé einzurichten. Aber beides ist ein verzweifeltes Abarbeiten an den Symptomen einer grundsätzlichen Problematik.
Man sollte die vielen vorliegenden Berichte aus der Schattenwelt des Arbeitsmarktes in unserem Land sorgfältig zur Kenntnis nehmen – und sie sollten zu Konsequenzen führen, für die, die von diesen Zuständen profitieren. Dazu beispielsweise – wieder mit Blick auf München – der Artikel Schuften zum Hungerlohn aus dem Sommer des vergangenen Jahres. Allein die Kurzfassung lässt einen erschaudern über die Zustände: »Für teilweise nur 68 Cent pro Stunde haben acht Rumänen anscheinend auf einer … Baustelle gearbeitet. Auch dieser spärliche Lohn sei ihnen teilweise nicht ausbezahlt worden. Jetzt werden die Arbeiter von der Tafel versorgt. Der Zoll ermittelt.«
Wir haben ein echtes Problem in der Schattenwelt der Arbeitsprostitution und der Staat hätte die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, für eine flächendeckende Inspektion zu sorgen, eine Arbeit, wie sie von einzelnen Initiativen oder dem DGB-Projekt Faire Mobilität hier und da gleistet wird, auf breite und verlässliche Füße zu stellen. Denn dabei muss es auch darum gehen, die Betroffenen nicht nur als schützenswerte Subjekte zum Gegenstand hilfreichen Handelns zu machen, sondern ihnen Unterstützung zu geben, sich selbst – mit anderen – zu wehren, Nein sagen zu können.
Jeder Mensch, der heute schon in diesen Kelleretagen unterwegs sein muss, ist einer zu viel. Aber was glaubt man eigentlich, was in diesem Schattenreich passieren wird, wenn nur einige der vielen Flüchtlinge keine Perspektive bekommen, irgendwo legal arbeiten zu können bzw. zu dürfen?