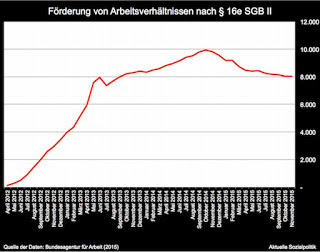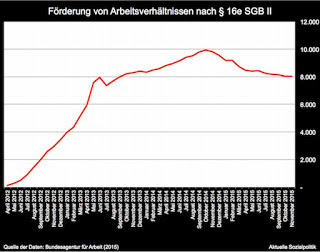In wenigen Stunden ist sie vorbei, die große Auslieferungswelle für die vielen Paketboten in unserem Land. Dann kehrt wieder Normalität ein, wobei diese keine Konstante ist, sondern ein bewegliches Ziel nach oben. Seit Jahren steigt die Menge der auszuliefernden Pakete kontinuierlich an, die „Amazonisierung“ unserer Gesellschaft schlägt sich hier nieder in Zuwachsraten für die Paketdienste, die sich im zweistelligen Prozentbereich bewegen. Aber in den Wochen vor dem Weihnachtsfest war und ist es am heftigsten – und das wird auch so bleiben. In dieser Zeit macht der Einzelhandel einen großen Teil seiner Umsätze und immer davon werden per Klick und Anlieferung über das Internet geordert. Um so bedeutsamer werden die Paketdienste zwischen Handel und Kunden, zuweilen und immer öfter werden sie auch zum Nadelöhr. Kunden beschweren sich – zunehmend – über Qualitätsprobleme bei der Zustellung der bestellten Waren, entnervte Paketzusteller wissen nicht mehr ein und aus.
Und manche Politiker glauben, in dieser Gemengelage auch noch billig Punkte zu machen, in dem sie mitsurfen auf der Welle der „Ich-reg-mich-auf-Kunden“ – die mittlerweile von der Verbraucherzentrale sogar eine eigene Website für ihre Beschwerden zur Verfügung gestellt bekommen (www.paket-ärger.de). Beispielsweise der Verbraucherschutzminister Heiko Maas (SPD), der es dann zu solchen Artikeln bringt: Minister Maas kritisiert „Geschenke, die erst zu Ostern kommen“: »Verbraucher- und Justizminister Heiko Maas hat kurz vor den Feiertagen klare Worte an die Paketdienstleister gerichtet. Die Verbraucher hätten ein Recht auf pünktliche und zuverlässige Auslieferung.« Das hört sich gut und energisch an. „Die Rechte von Verbrauchern müssen gewahrt werden“, wird er zitiert. Insbesondere vor den Weihnachtstagen sei es besonders wichtig, sich auf die Zusteller verlassen zu können. Das mag dem einzelnen Kunden gefallen – aber kein Wort zu den möglichen strukturellen Ursachen für die tatsächlich überall zunehmende Unzufriedenheit mit den Paketdiensten, bei deren Arbeit sich die Mängel tatsächlich häufen. Im schlimmsten Fall bleibt hängen, dass die Paketzusteller ihre Arbeit nicht (mehr) richtig machen.
Aber damit würde man sich auf eine völlig unzulässige Verkürzung dessen einlassen, was tatsächlich in diesem Bereich passiert. Wenn man schon nach einer halbwegs zutreffenden Adresse für Kritik oder gar Vorwürfe sucht, dann müsste man sowohl die Paketunternehmen adressieren wie auch den auftraggebenden Versandhandel. In diesem Blog wurde bereits mehrfach über die sich erheblich verschlechternden Arbeitsbedingungen der Paketzusteller berichtet. Das wird auch an anderer Stelle aufgegriffen, beispielsweise in diesem Artikel: Vier Minuten pro Teil – wie Paketboten vor dem Fest schuften.
»Vier Minuten. Das ist die Grenze, die Martin S. sich selber setzt. Wenn er nur vier Minuten oder weniger braucht für jedes Paket, dann erreicht der Hermesbote die Prämienzone. Dann verdient er mehr als den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro. In diesen Tagen teilt ihm das Lager gern mal 160 Pakete zu – ein Drittel mehr als üblich. Und auch diese Menge schafft Martin S., selbst wenn er bis 21 oder 22 Uhr treppauf, treppab spurtet, sechs Tage die Woche, ohne echte Mittagspause, die Weihnachtszeit nur ein Rauschen aus Parkplatzsuche, Treppenhäusern und flüchtigen Gesichtern.«
Weihnachten geht den „Männern der letzten Meile“ auf die Knochen:
»„Weinkisten sind das größte Übel“, sagt der 51-jährige S., der seinen Job eigentlich als „ein Fitnesstraining“ betrachtet. Vor zwei Jahren aber, zur Weihnachtszeit, hat er doch gemerkt, dass sein Körper nicht mehr wollte. Das Knie schmerzte so höllisch, dass er nicht mehr die Kupplung treten konnte. Also fuhr ein Freund den Transporter, Martin S. humpelte die Pakete zur Tür. Damals war er noch selbstständig – Subunternehmer des Depots mit mehreren angestellten Fahrern. Hätte er die festgeschriebene Menge an Paketen nicht bewältigt, hätte Hermes eine Spezialtruppe geschickt – mit immensen Kosten für Martin S.«
Hier wird auch das weit verbreitete unselige Subunternehmer-System angesprochen, das eine wichtige Rolle spielt in der Ausbeutungshierarchie, an deren Spitze die großen Konzerne stehen, die durchaus erhebliche Gewinne einstreichen können, während sich unten, an der Ende der Nahrungskette, die oftmals sehr kleinen (schein)selbständigen Subunternehmen mit ihren angestellten Paketzustellern befinden und wo der Preis- bzw. spiegelbildlich Kostendruck so enorm ist, dass das voll auf die Arbeitsbedingungen der letzten in der Kette, also bei den Zustellern, durchschlägt. Und zwar derart heftig, dass man immer öfter da unten keine mehr findet, die das machen und zunehmend zurückgreift auf rumänische oder bulgarische Paketzusteller, die dann für Hungerlöhne und unter völlig unakzeptablen Lebensbedingungen hier bei uns schuften (müssen).
Nur so viel den Nörglern untern den Kunden oder den hier Stimmen sammelnden Ministern, die nur das Roß, nicht aber den Reiter nennen: Wenn man derart miese Arbeitsbedingungen geschaffen hat, dass man sogar osteuropäische Billigstarbeiter für die Paketzustellung einsetzen muss, dann darf man sich nicht wundern, wenn es Probleme gibt bei der Zustellung. Aber dieses strukturelle Problem pflanzt sich nach oben fort: Wenn sich die Deutsche Post DHL selbst auf die Rutschbahn nach unten setzt und Billigtöchter (DHL Delivery) ausgegründet, dann darf sich der Kunde nicht wundern, wenn ständig wechselnde Zusteller Probleme haben, sich zu orientieren und vielleicht auch nicht wirklich eine Bindung zu „ihrem“ Zustellbezirk aufbauen (können), wie das oftmals vorher in der „alten“ DHL-Welt der Fall war. „Flexibilisierung“ und „billiger“ haben eben ihren Preis in Form sinkender Qualität – und genau das erleben wir jetzt. Zugespitzt formuliert: Wir können und dürfen uns eher darüber wundern, dass das immer noch so funktioniert.
Wie immer sind es die am Ende der Verwertungskette, die den zunehmenden Druck am stärksten zu spüren bekommen. Und die dann auch für Verbesserungen, die vielen Kunden gefallen, den Preis zahlen müssen. Man denke hier an den Service, dass man genau nachvollziehen kann, wo das eigene Paket gerade unterwegs ist. Nette Dienstleistung. Aber für die Paketzusteller bedeutet das: mehr Stress und Druck, so Benedikt Müller in seinem Artikel Der Bote wird gläsern. Und diese Entwicklung ist weniger eine Nettigkeit an die Kunden, sondern – wir nähern uns schon dem bereits bespielten Feld vor der Glaskugel – ein Ergebnis der Tüftelei der Paketdienste an einer effizienteren Zustellung.
„Alle Paketdienstleister versuchen, ihre Kosten auf der letzten Meile zu senken“, sagt Sonja Thiele vom Wissenschaftlichen Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste. Deshalb wollen die Firmen möglichst genau vorhersagen, wann ein Päckchen ankommt – und ihre Daten besser auswerten. Sie könnten die Zustellung etwa weiter in den Abend legen, weil dann mehr Empfänger zu Hause sind. Schön für die Kunden. Für die Paketboten jedoch erhöht sich der Stress noch weiter, so Müller in seinem Artikel.
Wie jede Medaille zwei Seiten hat, so werden wir auch hier mit einer Schattenseite konfrontiert. Denn das umfängliche Tracking der Pakete geht einher mit einer lückenlosen Überwachung der Paketzusteller und damit natürlich auch dem, was sie (nicht) tun.
Werfen wir mit Müller einen Blick auf den angeblichen „Innovationsführer“ dieser Entwicklung, dem Unternehmen DPD:
»Wer ein Paket … erwartet, kann im Internet auf einer Karte nachschauen, wo die Sendung gerade steckt: Am Tag der Zustellung sieht der Empfänger in Echtzeit, an welcher Straßenecke der zuständige Bote zuletzt haltgemacht hat.
Seit diesem Monat erfasst DPD weitere Daten zu seinen Sendungen: Nachdem ein Paket angekommen ist, kann der Adressat per App oder Online-Formular bewerten, wie gut er den Service fand … Wenn der Adressat nur einen oder zwei Sterne vergibt, hakt das Unternehmen nach: Hat es zu lange gedauert? War der Bote unfreundlich?«
Nicht wirklich überraschend: Die Gewerkschaft sieht das Schreckensszenario eines Bewertungssystems ante portas, das dem Arbeitgeber Rückschlüsse auf den einzelnen Zusteller zulässt. Wenn das nicht aufgehalten werden kann, dann wird es auch dazu kommen. Als Zwischenetappe benennt DPD dieses Ziel, das zugleich verdeutlicht, wohin die Reisen gehen wird:
»DPD verspricht, die Rückmeldungen der Empfänger nicht gegen einzelne Boten zu verwenden. Allenfalls breche man die Daten auf einzelne Standorte herunter, um regionale Probleme besser erkennen zu können. Das bedeutet: Der Konzern sieht, welches Depot und welche Gruppe von Boten welche Schwierigkeiten haben – den Einzelnen trifft das vielleicht nicht, das verantwortliche Boten-Team müsste sich dann aber wohl rechtfertigen.«
Bei den weiteren Gedankengängen nähern wir uns dann der berühmten Glaskugel, aber die Überlegungen sind nicht unplausibel: Die verstärkten Investitionen in das Tracking der Pakete wird nicht nur Auswirkungen haben auf den Umgang mit den Beschäftigten, sondern es wird auch neue Entwicklungsschritte auslösen:
»Die Empfänger wollen nicht nur wissen, wann ein Päckchen wohl ankommen wird. Sie wollen auch spontan veranlassen können, dass der Bote flexibel reagiert und auf einen anderen Ort ausweicht: auf das Büro, eines Tages gar vielleicht auf das geparkte Auto. Der Zusteller könnte dann mit einem übermittelten Code den Kofferraum öffnen und das Paket hinterlegen.«
Und auch durch andere Entwicklungen wird der Druck steigen, die bisherige Organisation der Paketzustellung – die allein schon aufgrund der stetig steigenden Sendungsmenge rein quantitativ an Systemgrenzen stößt – fundamental umzubauen. Man muss an dieser Stelle sehen, dass nicht nur der „klassische“ Paketdienstbereich enorm expandiert, sondern das diese Entwicklung auch noch angereichert wird durch neue, zusätzliche Lieferdienste (beispielsweise im Lebensmittelbereich), die sich zumindest in den Städten ausbreiten und ebenfalls die rein logistischen Grenzen zu spüren bekommen werden.
Wir leben mithin in einer Übergangsphase, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die bestehende Art und Weise der Paketzustellung im Kontext des brutalen Wettbewerbs zu einer stetigen Verschlechterung der Arbeitsbedingungen führen muss, die man so lange ausreizen wird, bis die damit untrennbar verbundenen Qualitätsverluste so groß werden, dass sich das gegen die Paketdienste selbst richtet. Dann werden sich technisch-organisatorische Umbauten durchsetzen lassen.
Korbinian Eisenberger hat darauf in dem Artikel Die Last mit der Last hingewiesen. Dort wagt man auch einen Blick ganz weit in die Zukunft, unter besonderer Berücksichtigung der neuen Lieferdienste, die sich derzeit ausbreiten – und die (noch?) auf „klassische“ Strategien des Lohndumpings setzen, wie man sie auch bei den herkömmlichen Paketdiensten beobachten muss (»In aller Regel sind die Männer und Frauen Freiberufler, bis vor Kurzem arbeiteten viele für fünf Euro brutto die Stunde. Seit der Einführung des Mindestlohns Anfang des Jahres müssen jedoch auch Lieferanten 8,50 Euro Stundenlohn bekommen. Seitdem kommen Firmenchefs auf die skurrilsten Ideen, um das Gesetz zu umgehen, etwa Klauseln, dass mit der Vergütung Überstunden und der Anspruch auf bezahlten Urlaub abgegolten sind. Nach wie vor basiert das System der Lieferdienste auf Einwanderern …, von denen viele die Not zwingt, zweifelhafte Verträge zu unterschreiben.«):
„In fünf bis zehn Jahren wird Zustellung und Abholung das normale Einkaufen für einen Großteil der Bevölkerung ersetzen“, sagt Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands für E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh), … Wenk-Fischer prognostiziert, dass künftig immer mehr Lebensbereiche von den Lieferdiensten abgedeckt werden, Firmen wie Lockbox hätten dann eine zentrale Rolle im System. „Supermarktketten werden sich zusammenschließen“, sagt Wenk-Fischer. „Sie müssen gemeinsame Modelle entwickeln, wie sie ihre Ware zum Kunden bringen.“
Und auch die Städte werden sich verändern, glaubt er. Denkbar seien flächendeckende Lieferzonen und immer mehr standardisierte Wohnungseinrichtungen. Etwa, damit ein Lieferant bei einem Stopp gleich in mehreren Wohnungen den Pulvertank für Waschmaschinen auffüllen kann. „Es reicht nicht, dass es für den Kunden bequem ist“, sagt Wenk-Fischer. „Für die Anbieter muss es auch effizient sein.“
Und mit Blick auf die normalen Pakete (wobei man ehrlich fragen muss: Was ist heute eigentlich noch normal, wenn sich die Leute Kompostanlagen in den dritten Stock eines Hauses liefern lassen, wie ein Paketzusteller berichtet hat) wird die Entwicklung einer ganz bestimmten, uns allen gut bekannten Linie folgen: So viel Arbeit wie möglich auf die Kunden selbst zu verlagern. Paketstationen gibt es bereits, Paketboxen werden sich jetzt ausbreiten. Ein Teil der Kunden wird als „Teilzeit-Paketfahrer“ eingespannt werden, was immer noch deutlich billiger kommt als mit festem Personal arbeiten zu müssen. Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.
Bis dahin aber bleibt: Eine „umgekehrte“ Hommage an die vielen Paketzusteller, nicht nur aufgrund dessen, was sie in den vergangenen Wochen geleistet haben. „Umgekehrt“ ist die Hommage deswegen, weil von der Herkunft unter einer Hommage die „Huldigung des Vasallen“ gegenüber dem „Lehnsherrn“ verstanden wird, ein öffentlicher Ehrenerweis, meist auf eine berühmte Persönlichkeit, der man sich verpflichtet fühlt. Hier geht der Ehrenerweis an die Vasallen, die sich krumm machen für uns alle. Die Paketzusteller sind nicht berühmt, sie werden oftmals gerade nicht als Persönlichkeit behandelt, sondern im Gegenteil wie ein Werkstück, das zu funktionieren hat. Gerade deswegen verdienen sie einen Ehrenerweis weitaus mehr als die Schönen und Reichen, die das ansonsten immer einheimsen.