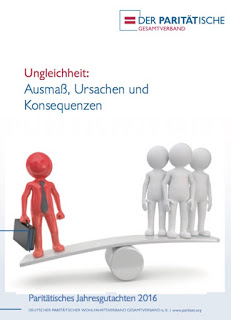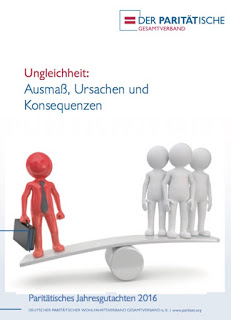In den vergangenen Wochen musste man zuweilen den Eindruck bekommen, die deutsche Wirtschaft steht bereits Schlange, um die Flüchtlinge, die zu uns kommen, in Lohn und Brot zu bringen. „Die meisten Flüchtlinge sind jung, gut ausgebildet und hoch motiviert. Genau solche Leute suchen wir“. Mit diesen Worten wird beispielsweise Dieter Zetsche zitiert in dem Artikel Daimler-Boss lässt in Flüchtlingszentren nach Arbeitskräften suchen. Obgleich die Headline etwas vorgriffig ist, denn er lässt das nicht tun, sondern er könnte es sich vorstellen, das zu tun: „Ich könnte mir vorstellen, dass wir in den Aufnahmezentren die Flüchtlinge über Möglichkeiten und Voraussetzungen informieren, in Deutschland oder bei Daimler Arbeit zu finden“. Und bereits vorher war der Premiumkarossenhersteller mit ganz konkreten Forderungen an die Politik aufgefallen: »Kürzlich hatte bereits Daimler-Vorstandsmitglied Christine Hohmann-Dennhardt in einem Zeitungsinterview angeregt, die Regeln zur Arbeitsaufnahme allgemein zu lockern und Asylbewerbern nach einem Monat zu gestatten, eine Arbeit aufzunehmen.« Der Hintergrund sind reale Restriktionen: Asylsuchende und Geduldete dürfen in den ersten drei Monaten überhaupt nicht arbeiten und auch danach haben sie nur schlechte Chancen auf einen Job, wenn es „bevorrechtigte Arbeitnehmer“ gibt, was die Arbeitsagenturen über eine „Vorrangprüfung“ feststellen müssen, die für viel Arbeit sorgt. Dies sind Deutsche, aber auch EU-Ausländer oder anerkannte Flüchtlinge. Erst nach 15 Monaten fallen diese Hürden weg. Vorstöße wie der aus der Konzernzentrale von Daimler könnten den Eindruck erwecken, dass man viele Flüchtlinge gleichsam direkt nach ihrer Einreise beschäftigen könnte. Dem ist aber offensichtlich nicht annähernd so.
»Andrea Nahles dämpft die Euphorie: Die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen koste Zeit und Geld, sagt die Arbeitsmarktministerin. Dabei reicht ihr Zeithorizont nicht über Monate, sondern über Jahre«, berichtet das Handelsblatt in dem Artikel Integration dauert viel länger als gedacht. Die Ministerin hat vor zu viel Euphorie bei der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen gewarnt. Erste Auswertungen des Projekts Early Intervention der Bundesagentur für Arbeit (BA) hätten gezeigt, dass nicht einmal jeder zehnte Flüchtling direkt in Arbeit oder Ausbildung vermittelt werden konnte.
Zu diesem Projekt vgl. auch den IAB-Forschungsbericht von Daumann, V. et al.: Early Intervention – Modellprojekt zur frühzeitigen Arbeitsmarktintegration von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern Ergebnisse der qualitativen Begleitforschung, Nürnberg 2015.
Deshalb sei auch klar, dass der Flüchtlingsandrang zu einem Anstieg der Arbeitslosenzahl führen werde, so die Ministerin, um der kommenden Entwicklung schon mal vorzubeugen. Zugleich macht sie konkrete Veränderungsankündigungen, denn sie hoffe auf eine Verständigung mit den Bundesländern, »die Vorrangprüfung für eine Weile auszusetzen, ohne dabei die einheimischen Arbeitslosen aus dem Blick zu verlieren.«
Steffen Fründt, Philipp Vetter und Virginia Kirst beschäftigen sich in ihrem Artikel Die große Hürde für Flüchtlinge bei der Jobsuche mit dem Nadelöhr für viele Flüchtlinge – den notwendigen Sprachkenntnissen und warum es kaum möglich ist, ihnen schnell Deutsch beizubringen.
»“Der beste Weg der Integration ist die berufliche. Doch die scheitert sehr häufig schon allein an den Sprachkenntnissen“, sagt Sönke Fock, Geschäftsführer der Hamburger Agentur für Arbeit. Er dämpft die Erwartungen derer, die in der Flüchtlingswelle eine schnelle Lösung für den Fachkräftemangel im Land sehen. Mit Ausnahme von ein paar IT-Firmen sei gutes Deutsch die Grundvoraussetzung, um auf dem deutschen Arbeitsmarkt überhaupt vermittelbar zu sein.«
Auch hier wird auf die Erfolgsquote von Early Interventions, einem Programm, mit dem die Agentur für Arbeit in mehreren deutschen Städten Menschen mit Migrationshintergrund durch Coaching und Sprachschulung in Beruf und Arbeit zu vermitteln versucht, hingewiesen:
»Seit eineinhalb Jahren läuft das Programm in Hamburg, über 2000 Kandidaten meldeten sich bislang zu der freiwilligen Maßnahme an. Davon erfolgreich in eine Arbeitsstelle vermittelt wurde bis heute keiner.«
Das schlägt sich auch schon in der offiziellen Arbeitsmarktstatistik nieder:
»Während die Zahl der deutschen Arbeitssuchenden deutlich um knapp sechs Prozent auf 3,8 Millionen Arbeitssuchende schrumpfte, wuchs sie im gleichen Zeitraum unter den Arbeitssuchenden mit ausländischer Staatsangehörigkeit um neun Prozent. Ihre Anzahl beträgt nun rund eine Million Menschen. Damit sind überproportional viele Ausländer auf der Suche nach Arbeit. Ihr Anteil an der Bevölkerung liegt bei rund neun Prozent, sie stellen aber 21 Prozent der Arbeitssuchenden.«
Die vielen Flüchtlinge, die vor kurzem Deutschland erreicht haben, sind da noch gar nicht eingerechnet.
Die größte und vor allem zeitaufwendigste Barriere ist und bleibt die Sprache. » Schon ein Basiskurs Deutsch dauert 300 Stunden. Dabei werden allerdings nur Grundlagen vermittelt. Je nach Status und Herkunftsland kann es dann sehr lange dauern, bis ein Aufbaukurs mit 600 Stunden oder „Deutsch für das Berufsleben“ folgt, Wochen oder Monate, in denen das Erlernte oft gleich wieder vergessen wird. Untergebracht in isolierten Einrichtungen und umgeben von Landsleuten fehlt schlichtweg die Praxis.« Und an unsere eigenen Erfahrungen anknüpfend bringt das folgende Zitat das Grundproblem, mit dem wir konfrontiert sind, auf den Punkt:
»Wenn schon unbelastete und aufnahmefähige Jugendliche Jahre brauchen, um eine einfache Fremdsprache wie Englisch zu erlernen, wird schnell deutlich, dass die nun von Politikern propagierte schnelle Integration in den Arbeitsmarkt in vielen Fällen tatsächlich ein eher zäher und langwieriger Prozess werden wird.«
Hinzu kommt: Um 800.000 Flüchtlingen Deutsch beizubringen, fehlen schlichtweg die Lehrkräfte. Deutschlehrer sind schon jetzt auf dem Arbeitsmarkt praktisch nicht mehr zu finden. Und die, die bislang in diesem Feld gearbeitet haben, sind mit nur noch als skandalös zu bezeichnenden Arbeitsbedingungen konfrontiert (vgl. dazu den Blog-Beitrag 1.200 Euro im Monat = „Top-Verdienerin“? Lehrkräfte in Integrationskursen verständlicherweise auf der Flucht oder im resignativen Überlebenskampf vom 2. September 2015). „Das Fehlen qualifizierter Deutschlehrer droht zum Flaschenhals der Integration zu werden“, befürchtet Hamburgs Arbeitsagenturchef Fock. Wohl wahr.
In diesem Kontext hat sich auch der Bundesverband der Träger beruflicher Bildung (BBB) zu Wort gemeldet unter der Überschrift Flüchtlinge haben absoluten Vorrang: »Die Bildungsträger unterstützen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Neue Lehrerstellen für Integrationskurse und bessere Planungssicherheit haben aber ihren Preis.« Der Vorstandsvorsitzende des BBB, Thiemo Fojkar, wird mit diesen Worten zitiert:
»„Es müssen tausende von Lehrerstellen neu besetzt werden, allein um die Integrationsklassen aufrecht zu erhalten und ausbauen zu können. Eine enorme Verantwortung, die da auf uns alle zukommt.“
Wenn die Bedingungen für Träger und deren Personal nicht verbessert werden – derzeit bekommt ein Lehrer in einem Integrationskurs zwischen 800 bis 1200 Euro Honorar – dann ist zu befürchten, dass Lehrkräfte, die dringend gebraucht werden, zunehmend in attraktivere Arbeitsfelder abwandern und zusätzliche Stellen nicht besetzt werden können.«
Das sind die Realitäten und eine Andeutung der Hindernisse, die man in der Lebenswirklichkeit vorfindet. Das hindert natürlich Theoretiker nicht daran, munter weiter mehr oder weniger gehaltvollen Gedankenspielereien in die Öffentlichkeit zu werfen. Hierzu ein Beispiel: »Derzeit dauert es zu lang, bis Flüchtlinge eine Arbeitserlaubnis bekommen. Die Gemeinden müssen deshalb hohe Kosten tragen. Doch schon eine einfache Maßnahme könnte zu einer Win-Win-Situation führen.« Da horcht man auf, vor allem, wenn der Artikel auch noch überschrieben wird mit Diese Idee löst ein großes Problem der Flüchtlinge. Und die kommt von Thomas Straubhaar ist Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere internationale Wirtschaftsbeziehungen, an der Universität Hamburg und Fellow der Transatlantic Academy in Washington.
»Dürften Flüchtlinge arbeiten, könnten sie selber einen Teil ihrer alltäglichen Aufenthaltskosten tragen. Bestenfalls leisten sie dann sogar über ihre Einkommenssteuern einen Beitrag in die öffentlichen Kassen. Erneut eine weitere Win-Win-Situation«, so Straubhaar. Der allerdings das Dilemma zu erkennen meint, dass dadurch Anreize gesetzt werden, dass noch mehr Flüchtlinge zu uns kommen werden. Was also ist seine Idee?
»Arbeit ja, aber volles Einkommen nein. Asylsuchende sollten rasch und unbürokratisch die Arbeitserlaubnis erhalten. Sie sollten auch genauso bezahlt werden müssen, wie es orts- und branchenüblich ist. Also keine Diskriminierung aufgrund ihres Flüchtlingsstatus. Das Gehalt sollte jedoch nicht vollständig an die Beschäftigten ausbezahlt werden. Ein nicht unwesentlicher Teil sollte an die jeweiligen Gemeinden fließen, als eigener Kostenbeitrag der Flüchtlinge an die allgemeinen kommunalen Aufwendungen für die Betreuung der Asylsuchenden.«
Der gute Mann plädiert also für eine Sondersteuer für arbeitende Flüchtlinge. Das »Recht auf Arbeit bei beschränktem Einkommen (sei) ein gangbarer Kompromiss. Er würde den Asylsuchenden die Langeweile des Wartens ersparen und eine sinnvolle Tätigkeit ermöglichen. Er bietet die Chance, dass Flüchtlinge einen Teil der durch das Asylverfahren entstehenden Kosten selber tragen könnten.« Unabhängig von der Fragwürdigkeit des ganzen Ansatzes insgesamt – der Vorschlag geht offensichtlich davon aus, dass die Aufnahmebereitschaft des Arbeitsmarktes sehr groß sein muss. Aber was, wenn nicht? Jedenfalls nicht zu halbwegs akzeptablen Bedingungen?
Im Vergleich dazu weitaus näher an der Lebensrealität ist da schon eher diese Debatte: Arbeitslose als Flüchtlingshelfer? Lob und Kritik an Kraft: Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) hat vorgeschlagen, Langzeitarbeitslose künftig als Flüchtlingshelfer einzusetzen. Der Bund sollte Programme für öffentlich geförderte Beschäftigte massiv ausbauen, so Kraft. Nun ist eine kontroverse Debatte losgegangen:
»Der Hauptgeschäftsführer des NRW-Städte- und Gemeindebundes, Bernd Jürgen Schneider, sprach von einer „Schnapsidee, weil Langzeitarbeitslose als Flüchtlingshelfer mehr Probleme schaffen als lösen“. Rückendeckung erfuhr Kraft dagegen von der Landesagentur für Arbeit. „Wir finden die Idee gut“, sagte Sprecher Werner Marquis dieser Zeitung. „Es gibt sehr wohl Arbeitslose mit hoher Qualifikation, die aufgrund des Alters oder wegen gesundheitlicher Probleme als Kümmerer fungieren können.“ So könnten Langzeitarbeitslose ehrenamtliche Helfer in der Flüchtlingsbetreuung unterstützen. Die Arbeitsagentur nennt Beispiele: Behördengänge, Einkauf, Bedienen von Geräten, Formulare, Hilfe bei der Kinderbetreuung oder die Unterstützung von Lehrern im Deutschunterricht – „ganz alltägliche Dinge eben“, sagt Marquis. Die Arbeitsagentur schätzt, dass zu Beginn landesweit „Luft“ für bis zu 300 Stellen im Haushalt ist. Dazu müssten Wohlfahrtsverbände aber als Träger einspringen. „75 Prozent der Kosten des Arbeitsentgelts der Langzeitarbeitslosen können übernommen werden“, rechnete Marquis vor.«
Kritisch dazu Matthias Knuth vom IAQ der Universität Duisburg-Essen. Er bemängelt: »Es fehle an Strukturen und Personal, um diese Leute einzuarbeiten und zu schulen. „Wie soll zum Beispiel ein Langzeitarbeitsloser einem alleinreisenden jungen Flüchtling helfen, wenn er dabei nicht angeleitet werden kann?“ Es bringe wenig, „die Probleme der Flüchtlingsbetreuung und die der Langzeitarbeitslosigkeit in einen Topf zu werfen und zu meinen, damit habe man eine Lösung“, sagte Knuth. Das werde nicht funktionieren.«