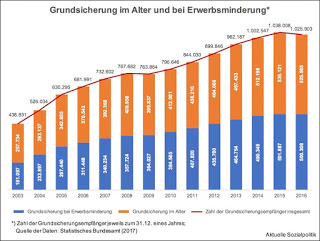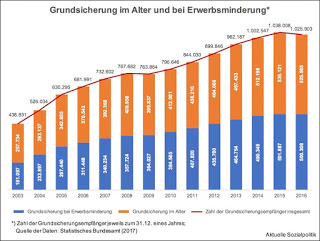Es ist ein grundsätzliches Phänomen unserer Zeit und zugleich ein echtes Problem, dass die von den Gesetzmäßigkeiten einer Aufmerksamkeitsökonomie vor sich hergetriebenen Medien auf ein Thema anspringen, um dann kurze Zeit später die mit Sicherheit folgende neue Sau, die dann durchs Dorf getrieben wird, zu verfolgen und die vor kurzem noch im Mittelpunkt der Berichterstattung stehende Angelegenheit verschwindet wieder in der Dunkelheit der Nicht-Berichterstattung und damit folgend der Nicht-Wahrnehmung. Mit erwartbaren Folgen: Aus den Augen, aus dem Sinn. Die Politik und ihre professionellen Öffentlichkeitsarbeiter wissen das. Also müssen sie in dem Moment, wo ein Thema durch eine Aufmerksamkeitswelle nach oben gespült wird und die Erregung am größten ist, schnell und scheinbar tatkräftig reagieren, in dem sie dem Publikum signalisieren, wir tun was. Das wird gelöst. Dumm nur, wenn es sich – wie im sozialpolitischen Feld eher der Regelfall – um höchst komplexe Angelegenheiten handelt, die man eben nicht einfach Wegreden kann, sondern wo nur mit dem Einsatz von Mehr-als-Worten, also Geld und dann auch noch möglicherweise gemeinsam mit den föderalen Ebenen unseres Staates etwas bewirkt werden kann. Das kostet Zeit, wenn die Finanzmittel überhaupt da sind oder zur Verfügung gestellt werden, da muss jemand die Verantwortung der Umsetzung übernehmen, wobei vorher die Zuständigkeitsfrage geklärt sein muss. Das dauert.
Nur hin und wieder wird mal nachgefragt seitens der Medien, was den aus einem der vielen tatkräftig daherkommenden Lösungsversprechen geworden ist, wie die Ergebnisse aussehen, ob es überhaupt welche gibt. Nicht selten wird man dann mehr als ernüchternde Befunde zur Kenntnis nehmen. Nehmen wir als Beispiel die Flüchtlinge und dabei ganz besonders die Sprach- und Integrationskurse. Die einleitend beschriebenen Mechanismen unserer Medienwelt kann und muss man hier wie in einem Lehrbuch zur Kenntnis nehmen.
In diesem Blog wurde bereits vor einiger Zeit nicht nur darüber berichtet, dass es nicht genügend Sprach- und Integrationskurse gibt, sondern ein besonderer Schwerpunkt wurde auf die teilweise erheblich prekäre Situation der Lehrkräfte gelegt.
Bereits am 13. April 2015 wurde hier dieser Beitrag veröffentlicht: Vom Sparen am falschen Ende und einer „vorsätzlichen Gesellschaftsgefährdung“. Es geht um Sprach- und Integrationskurse für Asylbewerber und „Menschen mit einem dauerhaften oder befristeten Aufenthaltstitel“. Schon damals wurde – mit Bezug auf die Bundesagentur für Arbeit – darauf hingewiesen, dass enorme gesellschaftliche Folgekosten drohen, wenn man nicht endlich bei den Sprach- und Integrationskursen in die Puschen kommt. Dazu braucht man natürlich die Lehrkräfte als wertvollste Ressource. Aber über die musste dann am 2. September 2015 unter dieser Überschrift berichtet werden: 1.200 Euro im Monat = „Top-Verdienerin“? Lehrkräfte in Integrationskursen verständlicherweise auf der Flucht oder im resignativen Überlebenskampf. Nach der Beschreibung der Bedingungen, unter denen die meisten (selbständigen) Lehrkräfte arbeiten müssen, ließ sich dieses Fazit nicht vermeiden: „Letztendlich haben wir es hier mit pädagogischen Tagelöhnern zu tun.“
So etwas wie ein Hoffnungsschimmer hat es dann am 16. Mai 2016 in die Überschrift dieses Beitrags geschafft: Der Integrations-Flaschenhals Sprachkurse, die Lehrkräfte und deren schlechte Vergütung. Doch jetzt soll alles besser werden. Damals ging es darum, dass das durchschnittliche Mindesthonorar für die selbständigen Lehrkräfte gerade mal bei 20,35 Euro pro Unterrichtsstunde lag und eine Anhebung auf 35 Euro pro Stunde zur Diskussion stand, nachdem es in den Medien immer mehr kritische Berichte über die Vergütung der Lehrkräfte gegeben hatte. Aber selbst diese diskutierte Anhebung wurde von den Betroffenen als viel zu niedrig kritisiert.
In den vergangenen Monaten ist es ziemlich ruhig geworden rund um das Thema Flüchtlinge. Und damit leider auch um das Thema Sprach- und Integrationskurse, obgleich da eben nicht nunmehr alles rund läuft. Immer noch gibt es zu wenig Angebote und immer noch sind die Bedingungen der dort arbeitenden Fachkräfte unbefriedigend.
Mal wieder in den Lichtkegel der öffentlichen Aufmerksamkeit gerutscht ist das Thema rund um die Berichterstattung über eine Bewertung des Bundesrechnungshofes über längst zurückliegenden Vorgänge. Rechnungshof rügt Sprachkurse für Flüchtlinge, so eine der vielen Artikel-Überschriften dazu.: »Die Arbeitsagentur hat 400 Millionen Euro für Deutschkurse ausgegeben. Ein großer Teil der eingesetzten Mittel ist wohl wegen geringer Teilnehmerzahlen wirkungslos verpufft«, so Sven Astheimer. Das hört sich nach einem Skandal an, 400 Mio. Euro sind ja kein Pappenstiel. Und wenn man dann liest, der »Bundesrechnungshof beschuldigt Deutschlands größte Behörde, durch mangelnde Vorgaben für Bildungsträger und fehlende Kontrollen Millionenbeträge mit Sprachkursen für Flüchtlinge verschwendet zu haben«, dann scheint sich der Verdacht zu bestätigen. Hinzu kommt: Es geht hier um rund 400 Millionen Euro aus Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung, denn die hat das Geld aus ihrer Kasse zur Verfügung gestellt, obgleich natürlich eigentlich die Aufgabe aus allgemeinen Steuermitteln zu finanzieren wäre.
Aber man muss genauer hinschauen.
»Im Herbst 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, entschied sich jedoch der Verwaltungsrat der Arbeitsagentur dafür, ein Sonderprogramm aufzulegen, weil es an Sprachkursen mangele. Das Programm wurde als „Soforthilfe“ deklariert und sollte „unbürokratisch“ umgesetzt werden. Das Programm lief von Oktober bis Dezember 2015. Die Nachfrage war riesig: Rund 220000 Flüchtlinge wurden für die Sprachkurse angemeldet, mehr als doppelt so viel wie erwartet. Das trieb die Kosten in die Höhe. Waren zunächst 54 bis 121 Millionen Euro veranschlagt, stand am Ende ein Bedarf von rund 400 Millionen Euro.«
Die mit gut gefüllten Kassen ausgestattete Bundesagentur für Arbeit, deren damaliger Leiter Frank-Jürgen Weise auch noch Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wurde, das für die Kurse eigentlich zuständig ist, ist also in die Bresche gesprungen, als Not am Mann war und der Haushalt des Bundes geschont werden sollte, denn Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hatte und hat die „schwarze Null“ als ewige Dauerstimme im Kopf.
Man könnte jetzt also argumentieren, damals war die Not groß und die BA ist dann eben unbürokratisch eingesprungen, um die Kurse für die Flüchtlinge zu ermöglichen, da läuft natürlich nicht alles so, wie es seinen normalen bürokratischen Gang geht. Aber:
»Schon damals waren jedoch Zweifel an der Vergabe- und Kontrollpraxis der Agenturen aufgekommen. Von Schein- und Doppelmeldungen durch die Bildungsträger war die Rede, von überhöhten Abrechnungssätzen und dubiosen Anbietern. Die Arbeitsagentur schreckte auf und begann mit stichprobenartigen Prüfungen. Dabei sei man „in Einzelfällen“ auf Umstände gestoßen, „die wir uns so nicht gewünscht hätten“, hatte Vorstandsmitglied Detlef Scheele im Februar 2016 noch gesagt. Zu diesem Zeitpunkt waren jedoch erst 4 Prozent der Sprachkurse abgerechnet.«
Und nun – rückblickend ist man immer schlauer könnte man einwerfen – meldet sich Monate später der Rechnungshof zu Wort nach einer Prüfung der damaligen Vorgänge in aller Ruhe und im warmen Büro und wirft der BA vor, dass nicht alles so abgelaufen sei, wie man es erwarten müsste unter Normalbedingungen. Aber so einfach kann man die Kritik auch nicht beiseite schieben, die Argumentation des Rechnungshofes, über die Astheimer berichtet, hört sich differenzierter an:
„Besonders kritisch sehen wir, dass die Bundesagentur zwar bestimmte Vorgaben vorbereitet hatte, diese aber nicht zur Anwendung kamen“, rügte Rechnungshofpräsident Kay Scheller. Zwar erkennt er den Willen der Verantwortlichen an, in einer schwierigen Situation einen Beitrag für die Integration von Flüchtlingen leisten zu wollen. „Gerade in einer solchen Situation brauchen wir aber ein Mindestmaß an Regelung, wie solche Sprachkurse aussehen und durchgeführt werden sollen.“
Und fürwahr – das Vorgehen der BA damals erscheint als ziemlich freier Freibrief: »Normalerweise knüpft die Arbeitsagentur den Einkauf von Leistungen Dritter an konkrete Vorgaben. In diesem Fall wurde darauf jedoch verzichtet. Es gab weder ein festgelegtes Lernziel für die Teilnehmer noch eine Anwesenheitskontrolle. Auch wurden entgegen sonstigen Gepflogenheiten Anbieter ohne Zertifizierung zugelassen.«
Auch Sandra Stalinski weist in ihrem Artikel Integrationskurse: Die Qualität schwankt zuerst darauf hin, dass im Herbst und Winter 2015 in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen auf einmal kamen und zunächst Chaos herrschte. »Es gab nicht genügend Plätze in den Integrationskursen, es mangelte an Trägern, die solche Kurse durchführen können und an geeigneten Lehrkräften. Der Bund versuchte, schnell Abhilfe zu schaffen. Durch ein Sonderprogramm der Bundesagentur für Arbeit (BA) wurden rasch Einstiegskurse für Geflüchtete ins Leben gerufen. Die Anforderungen an die Träger waren sehr gering. Es kam zu Missbrauch, falschen Abrechnungen, miserablen Lernbedingungen.«
Dieses Chaos ist inzwischen behoben, so Stalinski, denn die Einstiegskurse sind ausgelaufen.
Für die regulären Integrationskurse wurden mehr Plätze geschaffen: Nach Angaben des BAMF wurden 20 Prozent mehr Träger zugelassen, die Zahl der Lehrkräfte sei sogar um 100 Prozent gestiegen. Hört sich erst einmal gut an.
»600 Unterrichtsstunden Sprachkurs und weitere 100 Stunden Orientierungskurs, mit Wissen zu Geschichte, Rechtsordnung und Werten in Deutschland umfasst ein Integrationskurs. Am Ende sollen die Teilnehmer mindestens das Sprachniveau B1 erreichen. Gemeint ist damit die selbstständige Sprachverwendung in den wichtigsten Lebensbereichen.«
Aber offensichtlich haben wir es weiterhin mit erheblichen Qualitätsunterschiede zwischen den so wichtigen Integrationskursen zu tun. Und bei der Suche nach den Ursachen dafür stoßen wir auf die Lehrkräfte und ihre Qualifikation:
»In der Kürze der Zeit sind viele Lehrer nachqualifiziert worden, die nie Deutsch als Fremdsprache (DaF) studiert haben. Ihre Qualifikation ist nicht gleichwertig: Beispielweise bei einem deutschen Soziologen, der zum Lehrer umgeschult wurde und jetzt durch eine Zusatzqualifizierung Integrationskurse unterrichtet. „Der musste in wenigen Wochen lernen, was andere in jahrelangem Studium lernen. Da fehlt es oft an methodisch-didaktischem Wissen, an Reflexion über die eigene Sprache, die man ja als Muttersprachler in der Regel nicht hat“, sagt Ingo Schöningh vom Goethe-Institut Mannheim.
Nur 51 Prozent der aktuell etwa 19.500 Integrationskurslehrer haben ein DaF-Studium absolviert, teilt das BAMF auf Anfrage mit. Rund 37 Prozent haben vor ihrer Zulassung eine Qualifizierung durchlaufen. 12 Prozent unterrichten bereits und holen die Zusatzqualifizierung parallel nach. Die – je nach Vorbildung – 70 oder 140 Unterrichtsstunden Zusatzqualifizierung sind nach BAMF ausreichend. Akteure im Bildungssektor bezweifeln das jedoch.«
Und die Arbeitsbedingungen, die auch heute zu beobachten sind, müssen als sichere Quelle für Qualitätsprobleme angesehen werden. Beispiel Gruppengröße – die ist sogar raufgesetzt worden:
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) »bemängelt, dass die Teilnehmerzahl von 20 auf 25 erhöht wurde: „Die Gruppen sind viel zu groß, angesichts der pädagogischen Herausforderung“, sagt Ansgar Klinger zu tagesschau.de. „Da sitzen mitunter Menschen mit Bürgerkriegserfahrung, die vielleicht nie eine Schule besucht haben, neben EU-Bürgern, die hier arbeiten wollen und ein abgeschlossenes Studium haben.“
Und selbst die mehr als fragwürdigen 25 werden angeblich überschritten. So berichtet eine Lehrkraft: „Ich weiß von Kursen privater Träger, in denen 30 Leute sitzen. 25 davon sind Integrationskursteilnehmer, die anderen fünf sind Selbstzahler.“ Da formal die Teilnehmerzahl des Integrationskurses nicht überschritten wird, werde das offenbar nicht weiter kontrolliert.
An der Bezahlung hat sich seit der letzten Anhebung nichts geändert: 35 Euro pro Unterrichtsstunde erhält eine Honorarkraft für den Integrationskurs. Die Anhebung von durchschnittlich 23 auf 35 Euro sei zwar ein richtiger Schritt gewesen, reiche aber bei weitem nicht aus, so die GEW: Umgerechnet in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung käme man laut GEW gerademal auf den Mindestlohn in der Weiterbildungsbranche, der auch für Nicht-Akademiker gilt.
Und ein eigenes Problemfeld sind die Träger, die solche Maßnahmen durchführen – mit bedenklichen Folgewirkungen der „wilden Zeit“, über die hier bereits berichtet wurde (Zitat einer Volkshochschullehrerin: „Als die BA 2015 die Einstiegskurse ins Leben rief, haben im Ruhrgebiet sogar Fahrschulen solche Kurse angeboten. Da haben Leute 300 Stunden Kurs gemacht und hinterher kaum ein Wort Deutsch verstanden.“) Aber die sind doch vorbei? Ja, aber:
„Anbieter, die damals ohne jede Qualifikation die Einstiegskurse der BA durchgeführt haben, können das beim BAMF heute als Erfahrungsnachweis vorbringen und so eine vorläufige Zulassung als Träger erhalten“, so Ansgar Klinger von der GEW.
Man sieht: Der Fortschritt ist eine quälend langsame Schnecke, in diesem Fall ganz besonders und zuweilen werden auch noch tote Schnecken reanimiert, um sie weiterlaufen zu lassen.
Und es möge sich keiner angesichts der seit dem vergangenen Jahr rückläufigen Flüchtlingszahlen in falscher Sicherheit wiegen, dass sich das Bedarfsproblem ab Sprach- und Integrationskursen irgendwie von alleine löst. Ein Beispiel, was – ob man will oder nicht – an zusätzlichem Bedarf auf uns zukommt, neben denen, die schon da sind: Fast 268.000 Syrer haben Anspruch auf Familiennachzug, so ist ein Artikel überschrieben. »Immer mehr anerkannte syrische Flüchtlinge haben einen Anspruch auf Familiennachzug. Das geht aus einem internen Papier der Bundesregierung zu den Folgen der Flüchtlingskrise hervor … Aus den Asylentscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ergebe sich „ein Potenzial von Syrern, die berechtigt wären, Familienangehörige nachzuholen“ von derzeit rund 267.500 Personen. Für sie findet die „Aussetzung des Familiennachzugs für zwei Jahre“ nach dem Aufenthaltsgesetz (§ 104, Absatz 13) laut dem internen Bericht „keine Anwendung“. Die betroffenen syrischen Flüchtlinge dürften ihre Familien somit nach Deutschland nachholen.«
Wer sich gleichsam aus erster Hand über die Situation, vor allem aber über die Forderungen der Fachkräfte, die in den Sprach- und Integrationskursen arbeiten, informieren möchte, dem sei diese Seite empfohlen: Bündnis DaF/DaZ-Lehrkräfte, die beiden Kürzel stehen für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache.