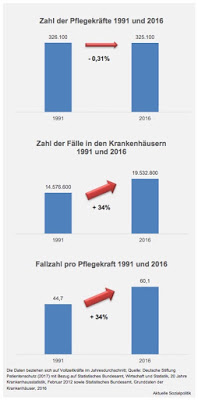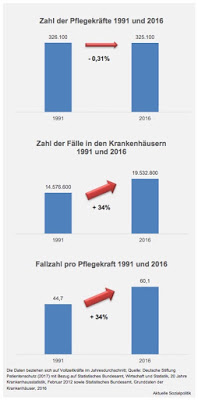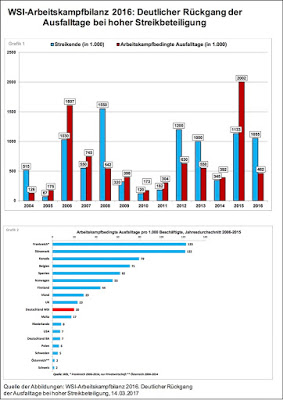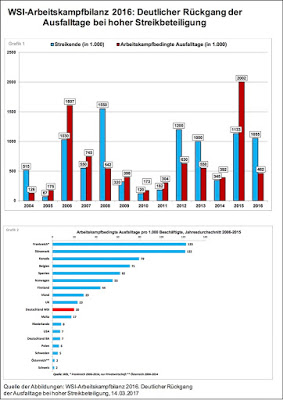Das hohe Gericht in Karlsruhe hat gesprochen, wenn auch nicht einstimmig: Das Tarifeinheitsgesetz ist weitgehend mit dem Grundgesetz vereinbar, so die Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts vom 11. Juli 2017. »Mit heute verkündetem Urteil hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts entschieden, dass die Regelungen des Tarifeinheitsgesetzes weitgehend mit dem Grundgesetz vereinbar sind.« Damit ist der Widerstand gegen ein im Sommer 2015 vom Bundestag verabschiedetes Gesetz, das in den Kernbereich der Arbeitsbeziehungen eingreift, an den Klippen des BVerfG „weitgehend“ gescheitert, hatten doch die Kläger gehofft, in Karlsruhe würde die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes festgestellt werden – und im Vorfeld der heutigen Entscheidung gab es nicht wenige Arbeitsrechtsexperten, die dafür auch zahlreiche Anhaltspunkte gesehen haben. Es geht hier wahrlich nicht um irgendeine gesetzgeberische Petitesse, sondern letztendlich um das Streikrecht der Gewerkschaften: Wenn es sein muss, dann müssen Gewerkschaften auch streiken können. Nun ist das Streikrecht eine höchst diffizile Angelegenheit und es gibt ein solches eigentlich nur als abgeleitetes Recht aus der „Koalitionsfreiheit“, die im Grundgesetz verankert ist. Dort finden man im Artikel 9 Absatz 3 GG diese – man sollte meinen eindeutige – Formulierung: »Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig.« Die Konkretisierung des aus diesem – nicht umsonst ganz vorne im Grundgesetz normierten – Grundrechts abgeleiteten Streikrechts für die Gewerkschaften basiert auf einer über Jahrzehnte andauernden ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts.
Und da hatte sich in der Vergangenheit etwas verändert – und diese Kehrtwende zu verstehen ist wichtig, um die Stoßrichtung und die Konfliktintensität des Tarifeinheitsgesetzes verstehen zu können. Jahrzehntelang gab es in der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts eine klare Linie pro Tarifeinheit. Darunter versteht man den Rechtsgrundsatz, dass in einem Arbeitsverhältnis oder in einem Betrieb nur ein Tarifvertrag anzuwenden ist. In Deutschland galt dieser Grundsatz seit einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahr 1957. 2010 wurde dann eine grundlegende Korrektur hin zur Tarifpluralität mit einer expliziten Bezugnahme auf die grundgesetzliche verankerte Koalitionsfreiheit vorgenommen.
Das Tarifeinheitsgesetz soll nun den Weg zurück zur Tarifeinheit ebnen. Allerdings nur für die Arbeitnehmer mit ihren Gewerkschaften, nicht aber für die Arbeitgeber, worauf noch zurückzukommen sein wird.
Was ist der Kerninhalt des neuen Gesetzes? Man will mit seiner Hilfe dafür sorgen, dass nicht eine kleine Berufsgruppe an wichtigen Schaltstellen – wie die Lokführer bei der Bahn, die Piloten bei der Lufthansa oder die Ärzte in den Krankenhäusern – durch ihren Streik alles lahmlegen und damit ihre Individualinteressen durchsetzen kann, womöglich sogar gegen die Interessen der Mehrheit der Arbeitnehmer in den jeweiligen Unternehmen. Den Lösungsansatz des Gesetzes beschreibt Dietmar Hipp in seinem Artikel Stoff für Zoff so: Es geht im Prinzip um die Installierung eines Mehrheitsprinzips: »Wenn sich zwei Gewerkschaften nicht auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen können, gilt das Recht des Größeren. Zwar sollen auch die Kleineren weiter Tarifverträge abschließen können – diese würden aber im Kollisionsfall vom Tarifvertrag der Mehrheitsgewerkschaft verdrängt.«
Und hier wird es dann richtig schwierig für die „kleine“ Gewerkschaft. Es ist die Stelle, an der die Kritik vieler Juristen vor der heutigen Entscheidung aus Karlsruhe hinsichtlich einer aus ihrer Sicht gegebenen Verfassungswidrigkeit des neuen Gesetzes angedockt hat, weil die grundgesetzlich garantierte Koalitionsfreiheit faktisch für einen Teil der Gewerkschaften ausgehebelt wird, denn die kleineren Gewerkschaften können für ihre Mitglieder nichts mehr durchsetzen, sobald ein größerer Konkurrenzverband die Bühne betritt. Die faktische Außerkraftsetzung des Streikrechts für die kleinen Gewerkschaften resultiert wiederum aus der Arbeitskampfrechtsprechung: Als „unverhältnismäßig“ gilt in der Rechtsprechung ein Streik unter anderem dann, wenn er auf ein Ziel gerichtet ist, das mit ihm gar nicht erreicht werden kann. Wenn aber ein angestrebter Tarifvertrag gar nicht erreicht werden kann, weil sowieso der der größeren Organisation gilt, dann müsste der Streik als „unverhältnismäßig“ bewertet und untersagt werden. Warum aber sollen sich dann Arbeitnehmer in der kleineren Gewerkschaft organisieren, wenn die nur im Windschatten der größeren Gewerkschaft segeln darf und kann? Damit aber stellt sich logischerweise die Existenzfrage der kleineren Organisationen.
Und die Entscheidung des BVerfG schafft jetzt leider keine Klarheit, sondern sie eröffnet zahlreiche Baustellen: Dass die kleinen Gewerkschaften prinzipiell streiken dürfen, wird vom BVerfG herausgestellt. Wenn ein Tarifvertrag aber ohnehin von einem Mehrheitstarifvertrag verdrängt werden kann, dürfte ein Streik oft unverhältnismäßig sein. Aber das Bundesverfassungsgericht verlangt ausdrücklich, dass die Minderheitsgewerkschaft in einem solchen Fall nicht dem Risiko ausgesetzt werden darf, für streikbedingte Verluste und Schäden zu haften – das müssten dann aber die Arbeitsgerichte sicherstellen. Und wie soll das funktionieren?
Offensichtlich ist auch die Mehrheit der Richter des BVerfG nicht wirklich wohl bei dem, was das Tarifeinheitsgesetz beinhaltet: Nach der Statuierung einer „weitgehenden“ Verfassungskonformität des Gesetzes schieben die Richter eine Einschränkung hinterher:
»Die Auslegung und Handhabung des Gesetzes muss allerdings der in Art. 9 Abs. 3 GG grundrechtlich geschützten Tarifautonomie Rechnung tragen; über im Einzelnen noch offene Fragen haben die Fachgerichte zu entscheiden. Unvereinbar ist das Gesetz mit der Verfassung nur insoweit, als Vorkehrungen dagegen fehlen, dass die Belange der Angehörigen einzelner Berufsgruppen oder Branchen bei der Verdrängung bestehender Tarifverträge einseitig vernachlässigt werden. Der Gesetzgeber muss insofern Abhilfe schaffen. Bis zu einer Neuregelung darf ein Tarifvertrag im Fall einer Kollision im Betrieb nur verdrängt werden, wenn plausibel dargelegt ist, dass die Mehrheitsgewerkschaft die Belange der Angehörigen der Minderheitsgewerkschaft ernsthaft und wirksam in ihrem Tarifvertrag berücksichtigt hat. Das Gesetz bleibt mit dieser Maßgabe ansonsten weiterhin anwendbar. Die Neuregelung ist bis zum 31. Dezember 2018 zu treffen.«
Darüber, wie das funktionieren soll, rätseln aber selbst Experten. Es stellt sich hier die Frage, ob der Gesetzgeber dafür überhaupt eine verfassungskonforme und zugleich praktikable Lösung finden kann.
Das Grundgesetz gibt den Gewerkschaften „kein Recht auf unbeschränkte tarifpolitische Verwertbarkeit von Schlüsselpositionen und Blockademacht zum eigenen Nutzen“, so einer der Leitsätze des Urteils. Man muss aber wie immer bei Juristen genau lesen – „unbeschränkte“ Verwertbarkeit steht da. Aber wann ist etwas noch nicht oder doch schon „unbeschränkt“? Wer genau legt die Grenze fest?
Die Entscheidung des BVerfG schafft weitere akrobatische Herausforderungen für die vor uns liegende Arbeitsrechtsprechung: Dass der Tarifvertrag einer Minderheitsgewerkschaft verdrängt wird, gilt zwar grundsätzlich, aber eben nur mit Ausnahmen. So sollen „längerfristig bedeutsame Leistungen“, die eine Minderheitsgewerkschaft in einem Tarifvertrag erstritten hat, und auf die sich Beschäftigte typischerweise in ihrer Lebensplanung einstellen, nicht durch einen Mehrheitstarifvertrag verdrängt werden. Dazu zählt das Urteil ausdrücklich Leistungen zur Alterssicherung, zur Arbeitsplatzgarantie oder zur Lebensarbeitszeit. Ja wie soll man das nun wieder überprüfen und einordnen?
Das hört sich nach einem veritablen Durcheinander an. Vielleicht macht das solche Artikel-Überschriften verständlicher: Karlsruhe stärkt die kleinen Gewerkschaften. Wolfgang Janisch argumentiert so: »Das Gesetz ist keineswegs verfassungsgemäß, es ist sogar ziemlich grundgesetzwidrig – und war nur zu retten, weil die Richter es an allen Ecken und Enden so zurechtgebogen haben, dass es gerade noch in den Rahmen des „Gewerkschafts-Artikels“ im Grundgesetz passt. Verfassungskonforme Auslegung nennt man das, eine schonende Methode, Gesetze durch die Brille des Grundgesetzes zu lesen, um sie nicht mit großem Aplomb einstampfen zu müssen.«
Und offensichtlich gab es im zuständigen Senat auch grundsätzlichen Widerstand gegen die nunmehr vorliegende Mehrheitsentscheidung, denn zwei der acht Richter haben ein abweichendes Votum abgegeben. Dazu kann man der Pressmitteilung des Gerichts entnehmen:
»Abweichende Meinung des Richters Paulus und der Richterin Baer:
Richter Paulus und Richterin Baer sind sich mit dem Senat hinsichtlich der Anforderungen einig, die aus dem Freiheitsrecht des Art. 9 Abs. 3 GG für Regelungen zur Sicherung der Tarifautonomie folgen. Sie können dem Urteil jedoch in der Bewertung des Mittels, mit dem der Gesetzgeber die Tarifautonomie stärken möchte, in der Entscheidung, das Gesetz fortgelten zu lassen, und in der Überantwortung grundrechtlicher Probleme an die Fachgerichte nicht folgen. Sie sind der Auffassung, das Ziel der Sicherung der Tarifautonomie sei legitim, aber das Mittel der Verdrängung eines abgeschlossenen Tarifvertrags sei zu scharf.«
Die beiden bringen es in ihrem abweichenden Votum klar auf den Punkt: »Die Reparatur eines Gesetzes, das sich als teilweise verfassungswidrig erweist, weil Grundrechte unzumutbar beeinträchtigt werden, gehört nicht zu den Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts«, so Susanne Baer und Andreas Paulus.
In diesem Kontext bewegt sich dann auch die Argumentation von Wolfgang Janisch:
»Rätselhaft ist …, warum der Erste Senat des Gerichts den leckgeschlagenen Dampfer Tarifeinheitsgesetz nicht einfach versenkt hat, statt ihn mühsam zu flicken. Die Mehrheit der Fachleute hatte das Gesetz ohnehin für verfassungswidrig gehalten. Für die beiden überstimmten Richter – Susanne Baer war sogar als Berichterstatterin für das Verfahren zuständig – war schon die politische Ausgangslage fragwürdig: „Es ist nicht zu übersehen, dass die angegriffenen Regelungen auf einen einseitigen politischen Kompromiss zwischen den Dachorganisationen Deutscher Gewerkschaftsbund und Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände zurückgehen.“«
Dazu passt dann die Reaktion der beiden angesprochenen Institutionen, also der BDA und des DGB: Wirtschaft erleichtert – Gewerkschaften gespalten, so eine der Überschriften. Zur Wirtschaft:
»In der deutschen Wirtschaft wird das Urteil mit Erleichterung aufgenommen. Arbeitgeberpräsident Kramer sprach von einem guten Tag für die Soziale Marktwirtschaft, weil nun Rechtssicherheit herrsche. Auf ein positives Echo stieß das Urteil auch beim Arbeitgeberverband Gesamtmetall und dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft. Dessen Präsident Ohoven sagte, es sei gut, dass die Möglichkeit der Spartengewerkschaften, das Wirtschaftsleben lahmzulegen, beschränkt bleibe.«
Bei den Gewerkschaften haben wir es mit einer ganz anderen Gemengelage zu tun, man kann das an zwei Beispielen verdeutlichen: „Klares Signal gegen Gruppenegoismen und Spaltung“ – so hat die IB Bergbau, Energie, Chemie (IG BCE) ihre Stellungnahme zum BVerfG-Urteil überschrieben. Michael Vassiliadis, der Vorsitzende der IG BCE, wird mit den Worten zitiert, dass damit sichergestellt sei, „dass künftig der Ingenieur nicht gegen den Papiermacher ausgespielt werden kann“.
Und auf der anderen Seite aus dem Lager der DGB-Gewerkschaften die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di: Urteil zum Tarifeinheitsgesetz führt zu massiver Rechtsunsicherheit, so ist deren Mitteilung betitelt. „Wenig Licht, viel Schatten“, kommentierte die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Andrea Kocsis das BVerfG-Urteil. Und die weiteren Ausführungen von ver.di leiten über zu der abschließenden Frage, wer das am Ende ausbaden muss:
»Wie soll ein Arbeitsgericht feststellen, ob die Minderheit in einem Mehrheitstarifvertrag ausreichend berücksichtigt wurde? Auch die Vorgaben an den Gesetzgeber, Minderheitsinteressen zu berücksichtigen, bleibe unklar. „Uneinheitliche Urteile und unzählige Prozesse drohen zu jahrelanger Rechtsunsicherheit zu führen.“ Gewerkschaften müssten nun immer wieder – vor, während und nach Tarifverhandlungen – den Beweis erbringen, ob sie die Mehrheiten an Mitgliedern in einem Betrieb haben.«
Ver.di kritisiert, dass die Regelung nun den Wettbewerb zwischen den Gewerkschaften anheizen werde. „Anstatt Ruhe trägt das Urteil nun Unfrieden in die Betriebe!“. Auf diese und weitere problematische Aspekte hinsichtlich der Umsetzung wurde in diesem Blog bereits am 22. Mai 2015 hingewiesen: Von der Tarifeinheit zur Tarifpluralität und wieder zurück – für die eine Seite. Und über die Geburt eines „Bürokratiemonsters“. In den vergangenen Jahren wurde das Thema Tarifeinheitsgesetz in diesem Blog mit mehreren Beiträgen begleitet.
Die beiden Richter mit dem abweichenden Votum weisen laut Mitteilung des BVerfG auf einen wichtigen Punkt hin, der gegen das Tarifeinheitsgesetz spricht: »Hinter der Annahme der Senatsmehrheit, die Nachzeichnung eines Tarifvertrags einer anderen Gewerkschaft halte den Verlust des eigenen Tarifvertrags in Grenzen, steht eine gefährliche Tendenz, die Interessen aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als einheitlich aufzufassen. Die Vorstellung, es komme nicht auf den konkret ausgehandelten Vertrag an, solange überhaupt eine Tarifbindung bestehe, privilegiert in der Sache die großen Branchengewerkschaften. Dies widerspricht dem Grundgedanken des Art. 9 Abs. 3 GG, der auf das selbstbestimmte tarifpolitische Engagement von Angehörigen jedweden Berufes setzt.«
Und am Anfang dieses Beitrags wurde darauf hingewiesen, dass das Tarifeinheitsgesetz die Tarifeinheit erzwingen soll – aber nur für die Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften. Deshalb ja auch der Jubel bei den Arbeitgeberverbänden für das Gesetz, das eine sozialdemokratische Arbeitsministerin auf den Weg gebracht hat (vgl. zu der hier angesprochenen Unwucht aus der Zeit vor dem Gesetzgebungsverfahren beispielsweise den Kommentar Gesetz zur Tarifeinheit: Geschenk für die Arbeitgeber von Heiner Dribbusch aus dem Jahr 2014). Zugleich gilt das aber nicht für sie als Arbeitgeber, darauf wurde hier schon am 5. März 2015 in dem Beitrag Schwer umsetzbar, verfassungsrechtlich heikel, politisch umstritten – das ist noch nett formuliert. Das Gesetz zur Tarifeinheit und ein historisches Versagen durch „Vielleicht gut gemeint, aber das Gegenteil bekommen“ hingewiesen: Damals wurden die Arbeitgeber zitiert mit ihrer Argumentation, dass Tarifkollisionen zu widersprüchlichen Regelungen führen, die sich im Betrieb nicht umsetzen lassen. Vielmehr tragen sie Streit in die Belegschaften.
»Nun könnte der eine oder die andere schon an dieser Stelle auf die Idee kommen, dass das irgendwie eine sehr einseitige Wahrnehmung dessen ist, was in vielen Betrieben passiert. Denn sind es wirklich (nur) miteinander konkurrierende Gewerkschaften, die zu „Tarifkollisionen“ führen? Was ist mit den vielen Unternehmen, die seit Jahren Teile ihrer Belegschaften „abschichten“ durch Auslagerung in Tochtergesellschaften mit einem anderen, niedrigeren Tarifgefüge? … Und was ist mit der teilweise hyperkomplexen Nutzung ganz unterschiedlicher Beschäftigungs- und damit auch Lohnarrangements durch Leiharbeit und Werkverträge neben den (noch) tariflich abgesicherten Stammbelegschaften? Da sind die Unternehmen offensichtlich sehr wohl in der Lage, komplexe, sich unterscheidende, nicht selten erheblich miteinander konfligierende Beschäftigungsbedingungen zu managen. Und wird dadurch kein Streit in die Belegschaften getragen?«
Vor diesem Hintergrund kann man der Kommentierung Kompliziert und mit Streitpotential von Christian Rath durchaus folgen: »Der Bundestag könnte nach der Wahl aber auch zum Schluss kommen, dass das Tarifeinheitsgesetz wenig bringt und nur Ärger macht – und es einfach wieder abschaffen.« Das wäre richtig und nur konsequent.