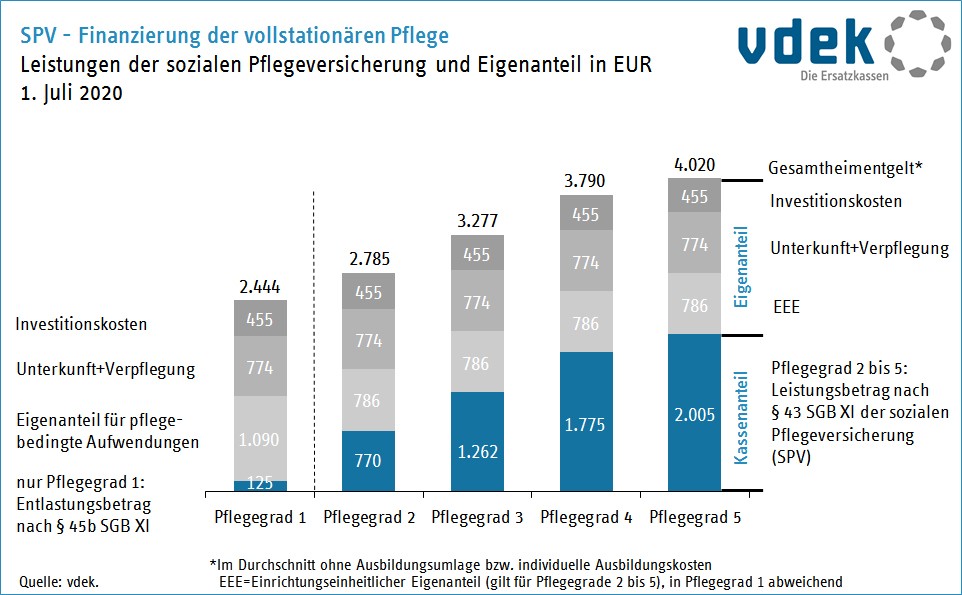Es waren durchaus beeindruckende Bekundungen der Anerkennung und des Danks für diejenigen, die in vorderster Reihe beim Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie ihre Frau bzw. ihren Mann stehen, die in den Kliniken, den Pflegeheimen und den ambulanten Pflegediensten durchhalten und die Versorgung hilfsbedürftiger Menschen sicherstellen. Da wurde nach italienischem Vorbild auf den Balkonen geklatscht und über weitere in vielen Fällen sicher auch zutiefst ehrlich gemeinte Bekundungen des Danke-Sagens wurde berichtet. Nun ist das, wie man überall feststellen kann und muss, mittlerweile abgeklungen, die Diskussionen drehen sich um die eingeleiteten Öffnungen des kommerziellen und gesellschaftlichen Lebens und viele Menschen haben den Eindruck, dass doch eigentlich alles schon vorbei ist. Die tatsächlichen Dramen laufen im Hintergrund ab und oftmals in den Einrichtungen, die man auch noch abgeschottet hat gegenüber der Außenwelt. Also in den Pflegeheimen, die zu den Hotspots der im wahrsten Sinne des Wortes tödlichen Seite der Corona-Krise geworden sind. Und das, was dort abläuft, schlägt sich dann nieder in solchen Meldungen: »In Deutschland sind bislang etwa 4.600 Menschen infolge des Corona-Virus gestorben – etwa ein Drittel davon in Pflegeheimen und anderen Betreuungseinrichtungen. Das besagen die Zahlen des Robert Koch-Instituts«, so Christoph Heinzle in seinem Artikel Ein Drittel aller Corona-Toten in Heimen. Es ist ein stilles Sterben in den abgeschlossenen Heimen und auch zahlreiche Mitarbeiter dort haben sich infiziert.
Aber da ist dann ja noch wenigstens das Versprechen einer nicht nur emotionalen oder verbalen Anerkennung (die erst einmal nicht viel kostet), sondern dass die Pflegekräfte in der Altenpflege eine handfeste materielle Würdigung in Form einer Prämie bekommen sollen. So entstand vor einigen Wochen die Idee, die besonderen Leistungen der Altenpflege mit einer „Corona-Sonderprämie“ von 1.500 Euro für die mehr als eine halbe Million Beschäftigten zu honorieren.
mehr