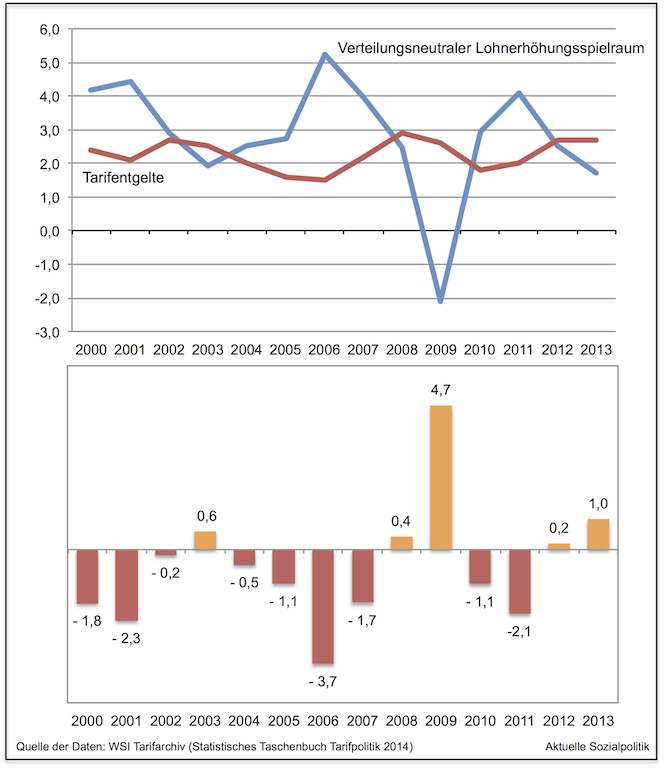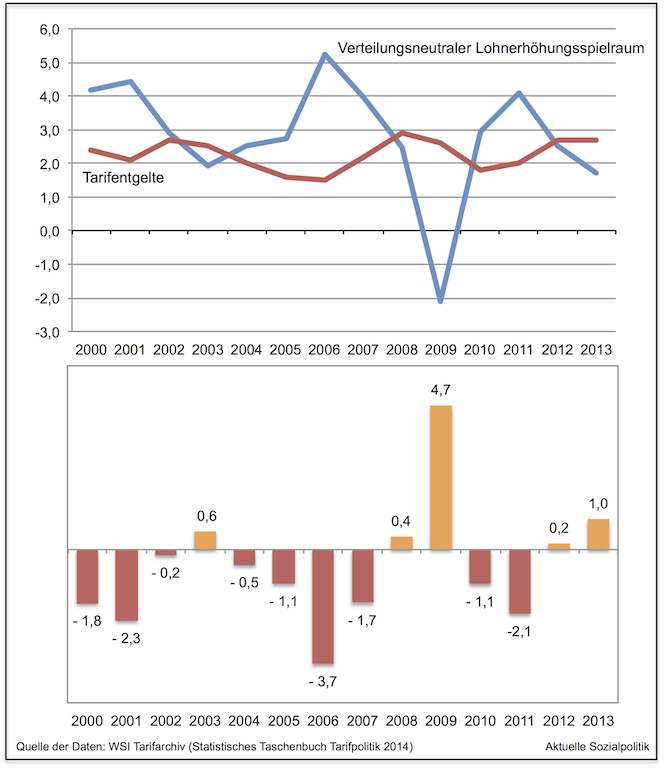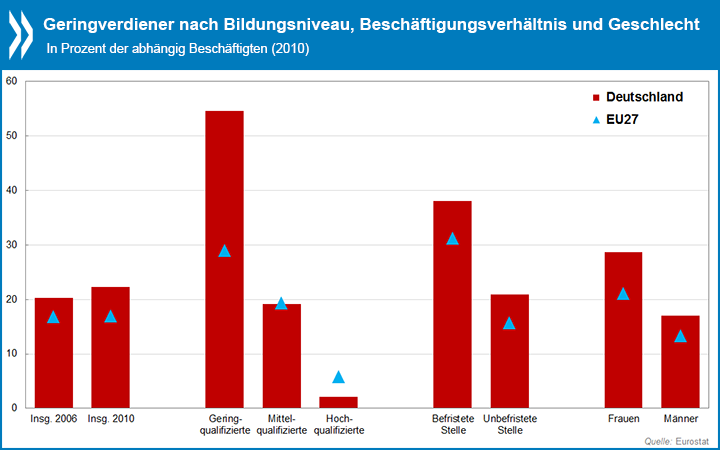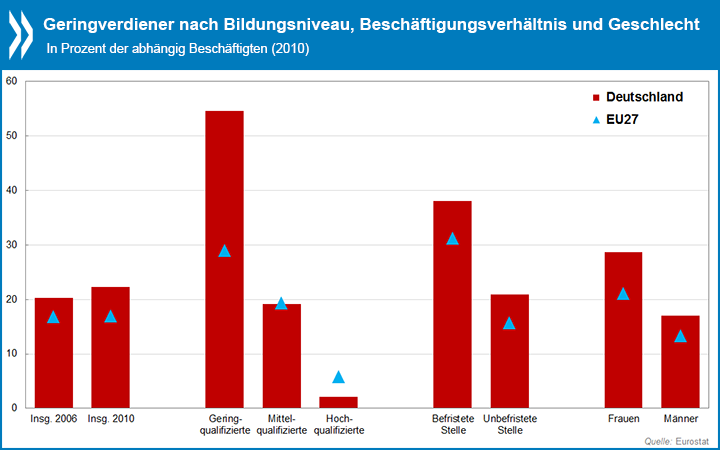Heute schon einen richtigen Brief verschickt, beispielsweise eine handgeschriebene Liebeseloge oder eine Anfrage nach Flensburg, das eigene Punktekonto beim Verkehrszentralregister betreffend? Dann hat man den Brief in einen Briefkasten der Deutschen Post geworfen und viele Menschen gehen davon aus, dass Mitarbeiter der Deutschen Post diese leeren und die mehr oder weniger wichtigen Schreiben in die großen Briefverteilzentren bringen. Aber bekanntlich gibt es solche und solche Mitarbeiter. Und wir leben in einer sich metastasierend ausbreitenden Subunternehmer-Ökonomie, von der auch unsere Briefe betroffen sind – sowohl bei der Zustellung wie auch schon beim Einsammeln. In dem wirklich lesenswerten Artikel Weniger ist leer von Bettina Malter müssen wir lesen: »Die Deutsche Post duldet Dumpinglöhne beim Einsammeln der Briefe. Lange war nicht bekannt, wie schlecht die Arbeitsbedingungen sind. Jetzt bricht ein Fahrer sein Schweigen.«
Es geht um eine richtig große Sache: 112.052 Briefkästen stehen (noch) in Deutschland. Und die müssen regelmäßig geleert werden. Bettina Malter berichtet von Matthias Jung (Name natürlich geändert), der solche Briefkästen abfährt und entleert und der ein gelbes T-Shirt mit dem bekannten Posthorn trägt, also scheinbar bei dem ehemaligen Staatsmonopolisten Deutsche Post – die immer noch auf einen Marktanteil von 89% im Briefgeschäft kommt – arbeitet. Scheinbar deshalb, weil er das nicht tut, was sich erschließt, wenn man den kleinen Aufdruck „Servicepartner der Deutschen Post“ bedenkt, den er mit sich herumtragen muss. Er ist angestellt bei einem Auftragnehmer der Deutschen Post, in seinem Fall konkret bei einem Subunternehmen eines Subunternehmers der Post.
»Um Kosten zu sparen, hat die Post vor mehr als zehn Jahren damit begonnen, diese Arbeiten an Fremdfirmen zu vergeben. Die Post sagt, es werde nur „ein geringer Anteil der Leerungen durch Servicepartner“ erledigt. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di geht aber vom Gegenteil aus: „Die Fremdvergabe ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel.“ So ist ein Netz aus Hunderten Firmen entstanden, die um die Aufträge buhlen. Billiger gewinnt. Nicht zuletzt deshalb, weil die Partnerfirmen ihren Mitarbeitern nicht den gleichen Lohn zahlen wie die Post. Fahrer, die bei der Deutschen Post beschäftigt sind, bekommen laut Tarifvertrag etwa 11 Euro die Stunde, nach zwölf Jahren sogar rund 14 Euro, und haben eine 38,5-Stunden-Woche.
Matthias Jungs Vertrag sieht demgegenüber 40 Wochenstunden vor – bei einem Gehalt von 789 Euro brutto im Monat. Sein Tag beginnt um sieben Uhr morgens und endet um 19 Uhr. Mittags hat er zwei Stunden frei, samstags früher Feierabend. Umgerechnet verdient er 4,50 Euro die Stunde. Jung muss also fast zweieinhalb Stunden arbeiten, um genauso viel zu verdienen wie ein Post-Angestellter in einer Stunde.«
Ja ist das denn nicht „sittenwidrig“, wird sich der eine oder die andere an dieser Stelle fragen? Hat nicht das Bundesarbeitsgericht 2004 – so Bettina Malter in ihrem Artikel – in einer wichtigen Entscheidung das heute immer wieder gerne zitierte Merkmal für Sittenwidrigkeit definiert, dass ein Lohn, der ein Drittel unterhalb des Tariflohns liegt, ein Wucherlohn sei? Wenn das so ist, dann ist der Lohn des Herrn Jung sittenwidrig.
Hier nur ein kleiner Exkurs in die Untiefen der „Sittenwidrigkeit“ bzw. des „Lohnwuchers“ (im Sinne eines „Wuchers“ nach unten): Offensichtlich bezieht sich Bettina Malter auf BAG , Urt. v. 24.03.2004, Az.: 5 AZR 303/03. Das Gericht berichtete damals in einer Pressemitteilung über den Sachverhalt und die Entscheidung: »Der Kläger war von Dezember 2000 bis August 2001 bei dem beklagten Zeitarbeitsunternehmen als Lager- und Versandarbeiter/Hilfskraft in Berlin beschäftigt. Der arbeitsvertraglich vereinbarte Stundenlohn betrug zunächst 11, 99 DM und dann ab 1. Mai 2001 12, 38 DM. Der Kläger meint, der vereinbarte Lohn sei sittenwidrig, weil er in einem auffälligen Missverhältnis zu dem vom Statistischen Landesamt mitgeteilten Durchschnittslohn für ungelernte Arbeiter im produzierenden Gewerbe in Berlin in Höhe von 23, 35 DM stehe. Mit seiner Klage verlangt er die Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Stundenlohn und dem seiner Meinung nach ortsüblichen Lohn in Höhe von 23, 35 DM. Die Klage blieb in allen Instanzen erfolglos. Der vertraglich vereinbarte Stundenlohn des Klägers ist nicht sittenwidrig.« Und warum? »Der Kläger war nicht im produzierenden Gewerbe tätig, sondern bei einem Zeitarbeitsunternehmen. Maßgebliche Bezugsgröße für die Feststellung der Sittenwidrigkeit der Lohnvereinbarung ist der bei Zeitarbeitsunternehmen geltende Tariflohn … Dieser Tariflohn ist seinerseits nicht sittenwidrig.« In dem Beitrag Niedriglohn oder Lohnwucher? auf der Website anwalt.de wurde bereits 2010 zum Thema „Sittenwidrigkeit“ ausgeführt: »Bereits 1997 hat der Bundesgerichtshof im Rahmen einer Strafverurteilung eines Bauunternehmers, der zwei tschechischen Maurern einen Wucherlohn gezahlt hatte, einen Richtwert vorgegeben: Danach ist ein Lohn sittenwidrig, wenn er unterhalb von zwei Dritteln des in der Branche und Region üblicherweise gezahlten Tariflohns liegt (Beschluss v. 22.04.1997, Az.: 1 StR 701/96). An diesem Grenzwert orientierten sich die Arbeitsgerichte, wenn sie entscheiden mussten, ob ein Lohn sittenwidrig ist. Diesen Grenzwert des BGH hat das Bundesarbeitsgericht mit Urteil v. 22.04.2009 auf die arbeitsrechtliche Komponente übertragen (Az.: 5 AZR 463/08). Der Entscheidung lag ein besonders schwerwiegender Fall von Lohndumping zugrunde: Eine Portugiesin, die kein Deutsch konnte, war als Hilfskraft in einem Gartenbaubetrieb beschäftigt. Laut dem in Portugiesisch verfassten Arbeitsvertrag arbeitete sie für einen Stundenlohn in Höhe von 3,25 Euro im Monat bis zu 352 Stunden. Sie und ihre Familie bekamen vom Arbeitgeber eine Wohngelegenheit auf dem Betriebsgelände gestellt. Der 5. Senat bestätigte, dass dieser Stundenlohn unter zwei Dritteln des Tariflohns lag. Aus seiner Sicht lag vorliegend zweifelsohne Ausbeutung und damit Lohnwucher gemäß § 138 Abs. 2 BGB vor, was die gesetzeswidrig hohen Arbeitszeiten verdeutlichten.« Entscheidend, so das BAG, bei der Beurteilung, ob ein sittenwidriger Wucherlohn vorliegt, ist allein das Missverhältnis zwischen Arbeitsleistung und Arbeitsentgelt.
Zurück zur Deutschen Post und ihren Subunternehmen: Matthias Jungs Gehalt liegt sogar noch deutlich unter zwei Drittel der Vergütung der posteigenen Mitarbeiter und ist damit – sittenwidrig. Also eigentlich. Nur scheint das die Deutsche Post nicht besonders zu interessieren und sie greift zu einer Argumentationsfigur, die wir auch aus anderen Zusammenhängen – man denke hier beispielsweise an die Subunternehmerketten bei den Paketdiensten wie GLS & Co. – kennen: „Die Verantwortung für die Gestaltung der Arbeitsbedingungen“ und auch „der Höhe der Vergütung liegt beim Servicepartner“. Wie schön. Aus den Augen, aus dem Sinn oder Wegdelegation von Verantwortlichkeit nennt man das dann wohl.
Hätten wir doch schon den 1. Januar 2015, wird der eine oder die andere jetzt denken, dann gäbe es schon die magischen 8,50 Euro gesetzlichen Mindestlohn. Aber der Mindestlohn hat im Postbereich eine eigene, besondere Geschichte und Bettina Malter berichtet auch darüber, die zynische Note dieser Geschichte nicht aussparend:
»Am 1. Januar 2008 fiel in Deutschland das Briefmonopol. Seither dürfen nicht mehr nur die Deutsche Post, sondern auch Konkurrenten wie die Pin Mail AG oder TNT Briefe transportieren. Mehr Wettbewerb sollte für niedrige Preise und höhere Qualität sorgen. Doch gleichzeitig geschah etwas anderes: Wenige Tage vor der Marktöffnung hatte die Bundesregierung – auf massiven Druck der Post hin – hastig einen Mindestlohn beschlossen. Er sollte allerdings weniger dem Schutz der Arbeitnehmer dienen als dem Schutz des bisherigen Monopolisten vor mehr Wettbewerb. Als das Bundesverwaltungsgericht den Mindestlohn zwei Jahre später wieder kippte, waren viele Post-Konkurrenten bereits vom Markt verschwunden. Sie konnten die hohen Tarife nicht zahlen und mussten Insolvenz anmelden.
Man kann also sagen: Mit dem alten Post-Mindestlohn schaffte sich die Post unliebsame Konkurrenten vom Leib, um nun anschließend mit der Fremdvergabe von Aufträgen jenen Zustand zu befördern, den sie einst bei ihren Wettbewerbern anprangerte: Dumpinglöhne.«
Das hat schon was.
Aber es gibt doch mit der Bundesnetzagentur eine staatliche Aufsicht über die Postdienstleister, mithin und gerade über die Deutsche Post. Kann man hier keine Hilfe erhoffen? Kann man leider nicht. „Die Bundesnetzagentur überwacht die Fremdvergabe nicht“, heißt es auf Anfrage. Es gebe in diesem Bereich „keine postrechtlichen Regelungen“, berichtet Malter. Matthias Jung hat Pech – er arbeitet in einem „weitgehend unregulierten Bereich“.
Immerhin hat die Bundesnetzagentur ganz aktuell wenigstens mal genauer hingeschaut im Bereich der (eigentlich regulierten) Briefzustellung und das, was man gefunden hat, in einem Bericht über die „wesentlichen Arbeitsbedingungen bei den Linznehmern im lizenzpflichtigen Briefbereich“ veröffentlicht. Birger Nicolai berichtete in der Tageszeitung „Die Welt“ vor kurzem über den noch unveröffentlichten Bericht unter der Überschrift „Löhne der privaten Zusteller sind zu niedrig“. Mit Blick auf die Briefzustellung kommt die Agentur zu dem Befund: » Insgesamt 15.863 solcher Fremdfirmen gab es Ende 2012, davon waren 4.909 für private Briefdienste und 10.954 für das Briefgeschäft der Deutschen Post tätig. Im Vergleichsjahr 2009 waren insgesamt nur 11.964 Subunternehmer beschäftigt, 10.849 bei der Post.« Zu den Löhnen erfahren wir: »Danach zahlen private Briefdienste den eigenen Zustellern 9,46 Euro durchschnittlich in der Stunde. Zwischen den Bundesländern gibt es Unterschiede: In Hamburg sind es 10,34 Euro, in Sachsen 8,32 Euro. Enthalten sind darin auch mögliche Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld.« In drei Bundesländern lagen die Verdienste unter dem (kommenden) gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde. „Insgesamt zeigt die vorliegende Untersuchung, dass das Lohnniveau bei den Wettbewerbern seit der letzten Erhebung im Jahr 2009 merklich angestiegen ist“, so die Agentur. Zwar zahlt die Deutsche Post im Durchschnitt mit 16,01 Euro wesentlich mehr als ihre Wettbewerber, allerdings muss man dabei bedenken, dass der Stundenlohn der Post vom hohen Anteil älterer Arbeitsverträge sowie von den Beamtenlöhnen nach oben geschoben wird. Neueinsteiger erhalten bei der Post 11,48 Euro und damit nur noch etwas mehr als die Konkurrenten. Und das soll so weitergehen – also aus der Perspektive der Deutschen Post nach unten: »Kürzlich hat Postchef Frank Appel angekündigt, sich den Wettbewerbern beim Lohn annähern zu wollen. Angestrebt wird ein niedrigerer Einstiegslohn.« Man muss dieses Ansinnen auch und gerade vor diesem Hintergrund sehen und bewerten: Im vergangenen Jahr verzeichnete die Post ein operatives Ergebnis von 2,9 Milliarden Euro. Allein in der Briefsparte lag es bei 1,2 Milliarden Euro.
Dass die Deutsche Post allein in der Briefsparte ein operatives Ergebnis in Höhe von 1,2 Milliarden Euro erzielt hat, liegt eben auch an Menschen wie dem Matthias Jung, über den Bettina Malter in ihrem Artikel berichtet. Die armen Schweine am Ende der Kette. Da, wo die Ausbeutung am größten ist. Auch deshalb: Im Gegensatz zu Briefträgern und Paketboten, die die Post nach Hause bringen, haben die Briefkastenleerer keinen Kontakt zum Kunden. Kaum tauchen sie irgendwo an einem Briefkasten auf, sind sie schon wieder verschwunden. Matthias Jung wird unbemerkt ausgebeutet, so die Einschätzung von Malter. Sie hat die Gewerkschaft ver.di mit dem Arbeitsvertrag des Matthias Jung konfrontiert, konkret den Arbeitsrechtler Steffen Damm von der Rechtsabteilung von ver.di Berlin-Brandenburg:
»Paragraf 7 macht dann selbst den erfahrenen Juristen fassungslos: „Mit dem Grundgehalt sind 16 Überstunden pro Woche abgegolten“, steht dort. Die 789 Euro im Monat beinhalten also fast 70 unbezahlte Arbeitsstunden. Jung bestätigt, dass er sie jede Woche voll leisten muss. Der Arbeitgeber spart dadurch mehr als eine Drittelstelle ein. Drei Fahrer machen also die Arbeit von vier. „Solch eine Klausel ist bei dem vereinbarten Gehalt nichtig“, sagt Damm.«
Jetzt also – hier hat man doch endlich eine Handhabe. Oder doch nicht? Es ist wie ein Teufelskreis des Zynismus: »Denn in der Kette von Subunternehmern, die für die Post arbeiten, gibt es viele Kleinunternehmen; Betriebe, die weniger als zehn Mitarbeiter haben.« Und in so kleinen Unternehmen dürfe der Arbeitgeber eine Kündigung aussprechen, ohne sie begründen zu müssen. Was also faktisch bedeutet: Herr Jung kann selbstverständlich juristisch gegen die Ausbeutung vorgehen und für sich genommen hat er gute Chancen, aber er wird dann absehbar seinen Arbeitsplatz verlieren. Das wissen bzw. ahnen viele Betroffene und die Arbeitgeber wissen das ganz besonders.
Der Besuch bei dem Arbeitsrecht-Profi von der Gewerkschaft bringt übrigens weitere brisante Details ans Tageslicht:
»“Gehalt 789,00 Euro brutto“, liest er vor. In den nächsten Zeilen reihen sich Beträge untereinander, die steuerfrei an Jung gezahlt werden: Erstattung der Telefonkosten, ein Ausgleich für ausgelegte Kosten – die es nicht gibt – und ein sehr hoher Verpflegungszuschuss, so hoch, wie er gesetzlich nur zulässig ist, wenn Jung den ganzen Monat außerhalb Berlins arbeiten würde – was er nicht tut. Diese Leistungen bekommt Jung nicht aus Großzügigkeit, sondern, so schlussfolgert Anwalt Damm: „Der Arbeitgeber will damit Sozialversicherungsbeiträge umgehen.“ Alles addiert, kommt Jung letztlich auf ein Bruttogehalt von 1.400 Euro. Davon bleiben ihm knapp 1.200 Euro, wovon sein eigentlicher Nettolohn wiederum 600 Euro ausmacht. Nicht nur für die Sozialkassen, auch für Jung hat das konkrete Auswirkungen: Wenn er in den Urlaub fährt oder krank ist, zahlt ihm seine Firma allenfalls das Gehalt, nicht aber die sonstigen Zuschüsse … Jung und sein Arbeitgeber zahlen aufgrund des geringen Grundgehalts weniger in die Rentenkasse ein, als sie müssten. Die Folge kann Jung auf seinem Rentenbescheid nachlesen: Wenn er so weiterarbeitet wie jetzt, kann er im Alter mit einer Rente von gerade einmal 600 Euro rechnen.«
Bettina Malter hat lange suchen müssen, um einen zu finden, der aus den Untiefen dieses Segments berichtet. Viele andere haben abgelehnt aus Angst vor dem Jobverlust.
Zugleich berichtet sie aber von gleichsam „kannibalistischen“ Ausformungen eines Brutalo-Wettbewerbs: Sie zitiert beispielsweise einen türkischen Fahrer im Westen Berlins: „Ich verdiene 5,80 Euro“, sagt er. „Die Polen, die hier viele Touren übernehmen, fahren für noch weniger Geld.“ Gerade im Norden der Stadt haben viele Transporter von Servicepartnern ein polnisches Kennzeichen. Von den angesprochenen polnischen Fahrern war keiner bereit zu reden.
Man muss an dieser Stelle wieder daran erinnern, wer ganz oben für das mindestens mitverantwortlich ist: Die Deutsche Post. Sie schweigt offiziell zu der Frage, was sie denn ihren Subunternehmen zahlt. Zumindest bestreitet sie, die Auftragnehmer nach Stunden zu bezahlen. Soweit die Theorie. Die Praxis sieht anders aus:
»Subunternehmer hingegen berichten von Preisen zwischen 16 und 19 Euro pro Stunde. Damit müssen Personal, Benzin, Fahrzeuge und die Miete fürs Büro bezahlt werden. Wer eine Tour erhält, gibt sie für einen geringeren Preis an einen Sub-Subunternehmer weiter. Es geht darum, Personalkosten und Kosten für die Fahrzeuge zu sparen, und darum, das eigene Risiko zu verringern. Und natürlich will jeder der Beteiligten Gewinn machen. Das größte Risiko trägt letztlich der, der in der Kette ganz unten steht. In vielen Fällen sind das Einmannfirmen, Taxifahrer oder Pizzalieferanten, die sich vor allem in ländlichen Regionen als Briefkastenleerer ein Zubrot verdienen.«
Abschließend: Es geht hier nicht um ganz besondere „Stilblüten“ in einer sicher bedauernswerten, allerdings einmaligen Neben-Branche. Zeitgleich zu dem hier herausgestellten Artikel von Bettina Malter wurden wir konfrontiert mit einem Bericht aus den Untiefen der Busbeförderung von Schülern und behinderten Menschen, die ebenfalls oft vergeben werden an mehr oder weniger dubiose Subunternehmen: Dumpinglöhne konkret: „Bedenkliche“ 2,88 Euro und wieder einmal die Arbeitszeitmanipulation als Haupteinfallstor für Bypass-Strategien zum Unterlaufen von Lohnansprüchen. Zugleich ein Ausblick auf das, was noch kommen wird – so habe ich einen Blog-Beitrag auf der Facebook-Seite von „Aktuelle Sozialpolitik“ überschrieben. In diesem Beitrag wird ein Artikel aus der Online-Ausgabe der WAZ zitiert, in dem berichtet wird, dass ein Busunternehmer sich auf einen Vergleich vor Gericht eingelassen habe, der dem klagenden Busfahrer eine Nachzahlung von über 4.000 Euro bringen wird, weil der Richter die gezahlten 2,88 Euro pro Stunde als „bedenklich“ tituliert hat. Aber 2,88 Euro pro Stunde sind nicht „bedenklich“, sondern eine richtige Schweinerei.