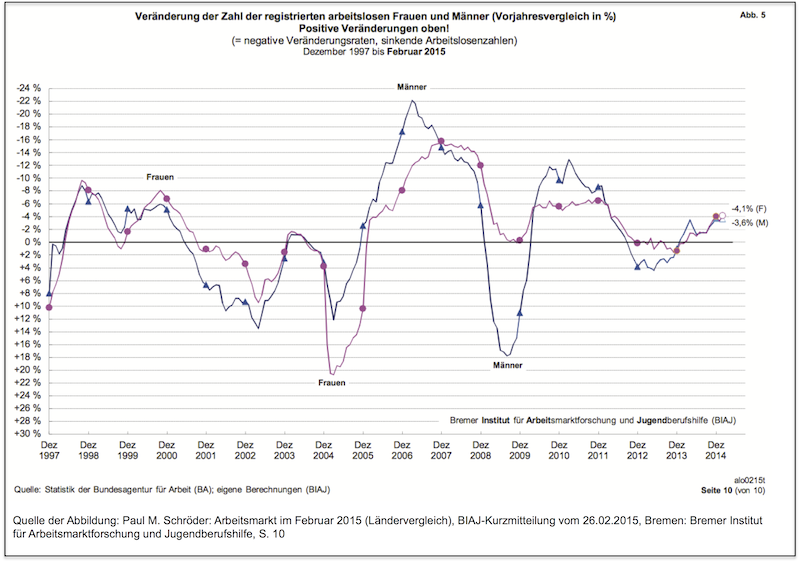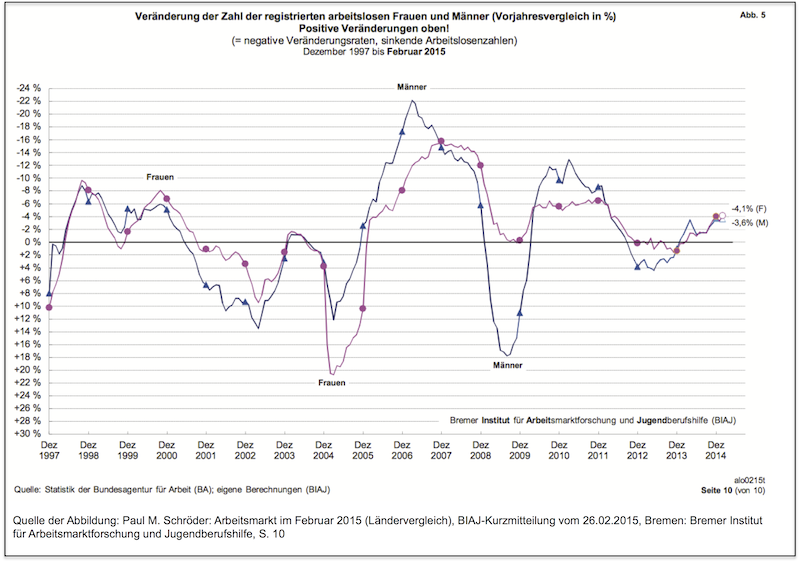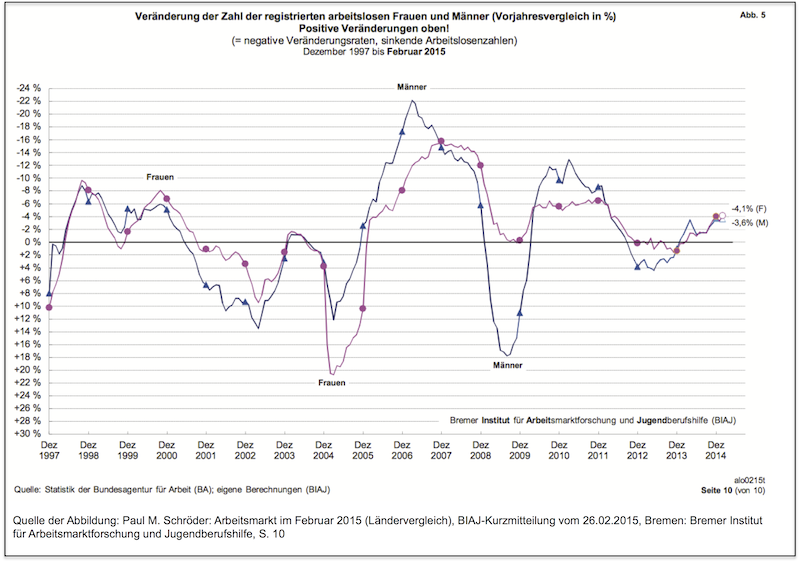
„Im Februar hat sich die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt fortgesetzt. Die Arbeitslosigkeit ist gesunken und die Beschäftigung behält ihren Aufwärtstrend bei.“ Mit diesen Worten wird Frank-Jürgen Weise, der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA) von seiner eigenen Behörde zitiert. »Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist von Januar auf Februar um 15.000 auf 3.017.000 gesunken. Im Durchschnitt der letzten drei Jahre ist die Arbeitslosigkeit im Februar gestiegen, und zwar um 15.000. Saisonbereinigt ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat um 20.000 gesunken. Gegenüber dem Vorjahr waren 121.000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet.« Und auch die Zahl der Unterbeschäftigten wird erwähnt: »Die Unterbeschäftigung, die auch Personen in entlastenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und in kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit mitzählt, hat sich saisonbereinigt um 20.000 verringert. Insgesamt belief sich die Unterbeschäftigung im Februar 2015 auf 3.888.000 Personen. Das waren 173.000 weniger als vor einem Jahr.« Und auch die Arbeitsnachfrage – gemessen an der Zahl der bei der BA gemeldeten offenen Stellen, die nur einen Teil der gesamtwirtschaftlichen Arbeitsnachfrage abzubilden in der Lage ist – befindet sich im positiven Bereich: »Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern ist weiter aufwärtsgerichtet. Im Februar waren 519.000 Arbeitsstellen bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet, 63.000 mehr als vor einem Jahr … Besonders gesucht sind zurzeit Arbeitskräfte in den Berufsfeldern Mechatronik, Energie- und Elektrotechnik, Verkauf und Verkehr und Logistik. Es folgen Berufe in der Metallerzeugung, Maschinen- und Fahrzeugtechnik sowie Gesundheitsberufe.« Also alles gut.
Wie passen dann aber solche Schlagzeilen in diese schöne Landschaft: Warum Arbeitslose nicht vom Jobwunder profitieren? Und Moment – gab es da nicht die Schreckensvisionen vieler Ökonomen in den vergangenen Monaten, die immer wieder von mehreren hunderttausend Arbeitsplätzen gesprochen haben, die mit der Einführung des Mindestlohns verloren gehen werden? Wie passt das alles zusammen?
Warum Arbeitslose nicht vom Jobwunder profitieren, fragt Thomas Öchsner in der Süddeutschen Zeitung: Er verweist nicht nur auf die Zahl von mehr als 43 Millionen Beschäftigten (wobei man hier immer mitdenken muss, dass es sich um alle Erwerbstätige handelt, also nicht nur der Vollzeitbeschäftigte mit einer 40-Stunden-Woche ist darin enthalten, sondern beispielsweise auch die Minijobber), sondern auch auf die enorme Bewegung, die wir auf dem Arbeitsmarkt haben: »Jeden Werktag melden sich gut 10.000 Menschen arbeitslos, weil sie ihren Job verloren haben. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) zählte aber auch 2014 mehr als zwei Millionen Menschen, die ihre Arbeitslosigkeit beenden konnten.«
Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Brigitte Pothmer, hat bei der Bundesregierung nachgefragt, wie sich denn der Beitrag der Arbeitsagenturen und Jobcenter darstellt, wenn es um die Vermittlung in eine (neue) Beschäftigung geht. »Das Ergebnis fand sie ziemlich ernüchternd: Trotz der Rekordbeschäftigung gelingt es den staatlichen Vermittlern immer seltener, Arbeitslosen einen festen Job zu vermitteln«, so Thomas Öchsner in seinem Bericht über die Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage:
»2014 erhielten etwa 272 000 Arbeitssuchende eine reguläre, ungeförderte Stelle auf dem Arbeitsmarkt, weil sie ein Jobcenter oder eine Agentur bei einem Arbeitgeber vorgeschlagen hatte. Das sind 28 Prozent oder 100 000 weniger als noch 2011 … Wie erfolgreich die Arbeit der staatlichen Vermittler ist, zeigt unter anderem die Vermittlungsquote. Diese ist … seit Jahren rückläufig. Danach waren von allen arbeitslosen Menschen, die 2011 eine normale, nicht geförderte Stelle ergattern konnten, 16,2 Prozent von den staatlichen Behörden direkt vermittelt worden. 2014 waren es nur noch 13 Prozent.«
Nun sollte man fairerweise zugestehen, dass die Vermittlungsquote den Teil der Stellenbesetzungen abbildet, bei dem die Agenturen und Jobcenter direkt vermittlerisch tätig waren (oder wo das als solches statistisch erfasst wurde). Daneben kann man natürlich argumentieren, dass es auch zahlreiche indirekte Vermittlungsleistungen gibt oder geben kann, die dann in einer Stellenbesetzung münden, ohne dass diese in der Vermittlungsquote ausgewiesen werden.
Öchsner weist aber auch noch auf einen weiteren Aspekt hin, den man der Antwort der Bundesregierung entnehmen kann: Frühere Erwerbslose verlieren häufig relativ schnell wieder ihren neuen Job. »Danach haben nur knapp 57 Prozent noch nach einem Jahr die Stelle, die sie mithilfe der staatlichen Behörden bekommen haben. Bei denjenigen, die Arbeitslosengeld II (Hartz IV) beziehen und meist länger als ein Jahr arbeitslos sind, gelingt es nicht einmal jedem Zweiten, den zuvor vermittelten Job mindestens ein Jahr zu behalten.« Auch in der Bundesagentur wird das als Problem erkannt: „Die Dauer der Beschäftigungsverhältnisse ist besonders für Hartz-IV-Bezieher zu kurz.“ Jeder Arbeitsvermittler werde eine unbefristete Stelle einer befristeten Stelle oder einer in der Zeitarbeit vorziehen. „Wir können uns solche Stellen jedoch nicht backen“, zitiert Öchsner eine Sprecherin der BA.
Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Brigitte Pothmer, »fordert einen Politikwechsel in der Arbeitsförderung, „weil weder Umfang noch Qualität der Vermittlung überzeugen können“. Vor allem bei gering Qualifizierten sei es nötig, stärker das Augenmerk auf das Fördern und Qualifizieren der Arbeitslosen zu legen, statt ihrer schnellen Vermittlung den Vorrang zu geben.«
Das wäre ein richtiger und wichtiger Schritt, der allerdings derzeit in einem doppelten Sinne versperrt wird: Zum einen durch zahlreiche förderrechtliche Restriktionen im SGB III und II, die dazu führen, dass an sich sinnvolle und gebotene Maßnahmen gar nicht durchgeführt werden dürfen, zum anderen aber auch eine seit 2011 ablaufende erhebliche Kürzung der Mittel für Fördermaßnahmen (vgl. dazu auch den Beitrag Arbeitsmarktpolitische Förderung: Weiterer Rückgang 2014 bei O-Ton Arbeitsmarkt). Und vor dem Hintergrund der folgenden Äußerung der Sprecherin der BA, die Öchsner in seinem Artikel zitiert, wird zugleich die völlig unsinnige Ausgestaltung der Nicht-Förderung derzeit im SGB II erkennbar: „Unter den Arbeitslosen haben wir zu wenig Fachkräfte, die werden aber gesucht.“ Richtig, über die Hälfte der arbeitslos registrierten Hilfeempfänger im Hartz IV-System haben keine Ausbildung. Dann wäre es doch nur naheliegend, alles daran zu setzen, die Betroffenen, wenn sie denn wollen und können, zu einem ordentlichen Berufsabschluss zu verhelfen, auch und gerade vor dem Hintergrund das wir wissen, dass die Arbeitgeber in Deutschland extrem abschlussorientiert sind, also darauf schauen, ob jemand einen Berufsabschluss hat – oder eben nicht. Dann nützen auch zahlreiche Zertifikate mehr oder weniger sinnvoller Maßnahmen nichts. In der Rarität aber werden Hartz IV-Empfängern ohne eine Ausbildung aufgrund der rechtlichen Ausgestaltung im SGB II zahlreiche Steine in den Weg gelegt, wenn sie eine Ausbildung machen wollen, bei älteren Hilfeempfängern kann sogar die Leistung vollständig gestrichen werden, wenn sie sich selbst bemühen, ohne Ansprüche auf andere Leistungen – ein Irrsinn (vgl. dazu den Beitrag Langzeitarbeitslose: Wer sich engagiert, wird bestraft des Politikmagazins „Monitor“ in der Sendung am 26.02.2015).
Und wie sieht es auf einer anderen großen arbeitsmarktpolitischen Baustelle aus? Beim (fast) flächendeckenden Mindestlohn? Der muss hier natürlich gerade vor dem Hintergrund der neuen Arbeitsmarktzahlen aufgerufen werden. Denn wie war das im vergangenen Jahr, vor der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns? Hunderttausende Arbeitsplätze sollten nach den Vorhersagen zahlreiche Mainstream-Ökonomen durch die neue Lohnuntergrenze verloren gehen. Vom „Jobkiller“ Mindestlohn war die Rede und viele Medien haben die apokalyptischen Visionen der Ökonomen übernommen und verbreitet. Da gab es – um nur ein Beispiel zu nennen – die Zahl von 900.000 Arbeitsplätzen, die angeblich verloren gehen durch den Mindestlohn, wie eine Studie ergeben habe. Die Zahl stammt aus einem Diskussionspapier der Wirtschaftswissenschaftler Andreas Knabe, Ronnie Schön und Marcel Thun: Der flächendeckeckende Mindestlohn, veröffentlicht im Februar 2014. Dort findet man tatsächlich den folgenden Satz: »Die gesamten Beschäftigungsverluste belaufen sich auf über 900.000 Arbeitsplätze« (Knabe et al. 2014: 34). Aufschlussreich wird es dann schon, wenn man nicht nur bei diesem Satz stehen bleibt, sondern einfach mal weiterliest: »Doch diese Zahl ist mit Vorsicht zu interpretieren, da in ihr auch der Verlust von 660.000 geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (einschließlich Rentner und Studenten) mitgezählt wird. Rechnet man die Verluste bei den geringfügig Beschäftigten in Vollzeitäquivalente um, so entsprechen diese Verluste in etwa 340.000 Vollzeitarbeitsplätzen. Konzentriert man sich auf die Vollzeitbeschäftigten, so ergeben sich insgesamt rund 160.000 Arbeitsplatzverluste, die etwa je zur Hälfte in den Neuen und Alten Bundesländern anfallen.«
Wenn das alles so wäre, dann müssten wir erste Spuren dieses Beschäftigungsabbaus in den Zugangszahlen in die Arbeitslosigkeit sehen. Sehen wir aber nicht. Vielleicht einfach deshalb, weil es eben nicht zu den von vielen abgeschriebenen Arbeitsplatzverlusten kommt, wie Kritiker immer eingewandt haben? Nun kann man an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es vielleicht noch zu früh ist, für eine erste Bilanzierung des Mindestlohns, denn möglicherweise halten sich viele Unternehmen noch zurück mit den Entlassungen, die es eigentlich geben müsste, wenn denn die Modellwelten der Mindestlohnkritiker was mit der Realität zu tun haben. Schauen wir mal, kann und muss man dieser Stelle sagen, aber es ist durchaus plausibel, dass es insgesamt gesehen kaum relevante Arbeitsmartkeffekte geben wird – was nicht bedeutet, dass nicht einzelne Unternehmen bzw. bestimmt Geschäftsmodelle vom Markt verschwinden werden. Aber derzeit kann und muss man sagen, dass sich der Arbeitsmarkt sehr robust darstellt und keine Anhaltspunkte für ein Eintreten der Horrorszenarien, die manche an de Wand gemalt haben, zu beobachten sind.
Statt dessen dreht sich die aktuelle Diskussion um die Versuche eines Teils der Arbeitgeber bzw. ihrer Funktionäre, die Arbeitszeiterfassung bestimmter Beschäftigter und hierbei vor allem der Minijobber wieder aus den Vorschriften zu kegeln. Was natürlich ein Scheunentor öffnen würde für schwarze Schafe. Und in der Praxis werden – nicht wirklich überraschend – von dem einen oder anderen Unternehmen Umgehungsstrategien gesucht und ausprobiert, um faktisch einen Lohn unterhalb der Lohnuntergrenze zahlen zu können. Vgl. dazu beispielsweise den Artikel Der schwierige Kampf gegen den Überstunden-Trick. In diesem Artikel wird das Vorstandsmitglied der BA, Heinrich Alt, zitiert:
Dass ausgerechnet die Erfassung der Arbeitszeiten für Konfliktstoff sorgt, kommt überraschend. Schließlich ist sie laut Arbeitszeitgesetz Pflicht, betonte Heinrich Alt, Vorstand der Bundesagentur für Arbeit (BA). Die Erfassung von Arbeitszeiten „sollte der Normalfall sein – nicht nur, wenn es um den Mindestlohn geht“.
Er sei „immer davon ausgegangen, dass Arbeitszeiten festgehalten werden, wenn nach geleisteten Arbeitsstunden abgerechnet wird“, sagte Alt. Die hitzige Debatte in der Koalition über das Thema verstehe er nicht: „Wenn man die Zahl der geleisteten Stunden nicht dokumentiert, ist Missbrauch nicht auszuschließen, auch nicht bei Minijobs.“
Man sollte an dieser Stelle ergänzen: nicht auch, sondern gerade bei den Minijobs ist der Missbrauch mit der unbezahlten Mehrarbeit in der Vergangenheit schon an vielen Stellen beobachtet und in Studien auch kritisiert worden. »Für geringfügig Beschäftigte solle die Dokumentationspflicht ganz abgeschafft werden, wenn ein schriftlicher und aussagekräftiger Arbeitsvertrag vorliege.« Die Verwirklichung dieser Forderung von Arbeitgeberverbänden unter dem Segel eines angeblichen „Bürokratie-Abbaus“ würde gerade den für Missbrauch am anfälligsten Bereich, also die geringfügige Beschäftigung, schutzlos den schwarzen Schafen unter den Unternehmen überlassen.
Selbst aus dem Osten Deutschlands kommen – neben den derzeit üblichen Berichten über Umgehungsversuche in einzelnen Betrieben – (noch) keine Hiobsbotschaften. „Frustrierend“ für die Mindestlohn-Gegner. Ein Beispiel aus Brandenburg:
»Seine Mitarbeiter zu erpressen, das kommt für Ralf Blauert nicht in Frage. Er betreibt in Potsdam ein Cateringunternehmen mit 50 Mitarbeitern. Früher verdienten die um die sieben Euro. Jetzt zahlt Blauert ihnen gern den Mindestlohn – dafür musste er allerdings die Preise anheben: An den Grundschulen, die Blauert mittags beliefert, zahlen Eltern jetzt für ein Essen 3,25 Euro statt 3 Euro. Die Reaktionen waren nicht so negativ, wie Blauert erwartet hatte. „Natürlich waren nicht alle begeistert. Aber wir haben mit viel mehr Unverständnis gerechnet“, sagt er. Entlassungen sind für Ralf Blauert kein Thema.«
Das sind alles erste Eindrücke, die natürlich keine annähernd seriöse Evaluierung der neuen Lohnuntergrenze darstellen. Dazu muss man zahlreiche Faktoren und Wirkungskanäle über einen längeren Zeitraum beobachten. Aber es sind Indizien, dass die Welt sicher keine ökonomische Modellwelt ist.
Um das Thema abschließend abzurunden: Bereits am 1. Februar 2014 hatte ich in dem Beitrag Was „Aufstocker“ im Hartz IV-System (nicht) mit dem Mindestlohn zu tun haben darauf hingewiesen, dass zumindest für alleinstehende Aufstocker ein Mindestlohn von 8,50 Euro ausreicht, um die aufstockenden Leistungen aus dem Hartz IV-System wegfallen zu lassen, die ja aus Steuermittel gezahlt werden müssen und damit eine Subventionierung der Geschäftsmodelle mit besonders niedrigen Löhnen darstellt. Nun hat sich auch die BA zu Wort gemeldet: Bundesagentur sieht Millioneneinsparungen durch Mindestlohn, so eine Meldung der Nachrichtenagentur dpa:
»Nach vorläufigen Berechnungen sei bei den Ausgaben für alleinlebende Hartz IV-Empfänger mit einer Vollzeitstelle jährlich mit 600 Millionen bis 900 Millionen Euro weniger zu rechnen, sagte BA-Vorstandsmitglied Heinrich Alt am Donnerstag in Nürnberg. Diese Gruppe der sogenannten Aufstocker benötige künftig deutlich weniger Arbeitslosengeld II zusätzlich zu ihrem Lohn.«
Eben. Und Heinrich Alt legt noch einen nach und das, was er gesagt hat, soll hier als Schlusswort gesetzt werden: „Aber eines kann man schon jetzt sagen: Für die Horrorprognosen des Münchner Ifo-Instituts, das mit dem Mindestlohn eine Million Arbeitsplätze verloren gehen, gibt es bislang keine Hinweise.“ So ist das.