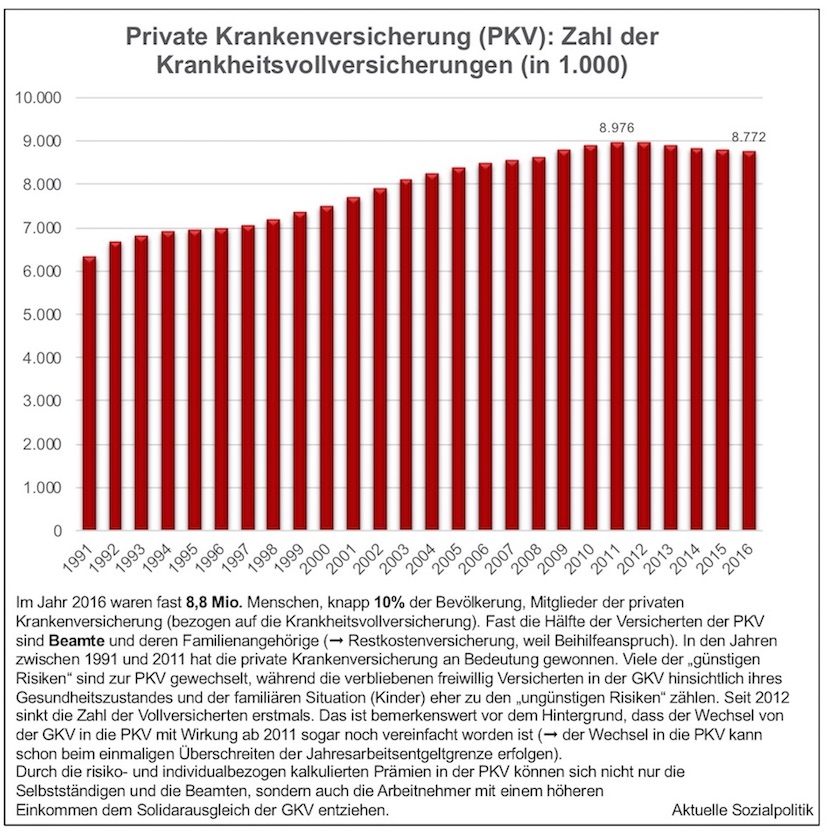»Lange wurde der Staat kaputtgespart. Heute ist er bei Großprojekten überfordert, ohne Unternehmensberater geht fast nichts mehr. McKinsey, Roland Berger & Co. bestimmen das Leben im Land mit, von der Straßenmaut bis zur Asylpolitik. Und verdienen damit Milliarden.« So beginnt eine Ende Januar 2019 veröffentlichte Titelgeschichte des SPIEGEL unter der bezeichnenden Überschrift „Die Berater-Republik“.
Im Innenministerium planen sie, wie Deutschland online geht, im Verkehrsministerium, wie Straßenmaut kassiert wird, im Bundesamt für Migration, wie Asylbewerber verwaltet werden. Insgesamt gibt der Staat inzwischen jährlich rund drei Milliarden Euro für Unternehmensberater aus, schätzt Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung und -entwicklung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Allein in den vergangenen sieben bis acht Jahren habe sich das Gesamtvolumen ungefähr verdoppelt, so der SPIEGEL. In den vergangenen Monaten wurden immer neue Affären um Beratereinsätze im Regierungsdienst bekannt, allen voran im Bundesverteidigungsministerium. Ursula von der Leyen hatte schon auf ihren früheren Kabinettsposten, also Familie und Arbeit, einen deutlich ausgeprägten Hang, Beratertruppen an die ministerielle Front zu werfen. In der Bundeswehr aber hat sie erst dermaßen über(ge)trieben, dass es nun sogar einen Untersuchungsausschuss im Bundestag gibt, der Licht in diese Schattenwelt bringen soll. Der Bundesrechnungshof stellte in mehreren Berichten fest, dass das Wehrressort von Ursula von der Leyen (CDU) millionenschwere Aufträge an Berater rechtswidrig vergeben hatte. Hier geht es um Vetternwirtschaft und Geldverschwendung, was am Ende der Ministerin das Ende bereiten kann. Aber darüber hinaus geht es um ein viel größeres und weitaus bedrohlicheres Problem, das in der SPIEGEL-Titelgeschichte so beschrieben wird: »Die Berater setzen nicht nur Projekte um, sondern machen Politik, beeinflussen, wie wir leben, ohne demokratische Kontrolle. Und der Staat läuft in die Falle: Er lagert Kompetenz um Kompetenz aus, wird abhängig vom Wissen an- derer und lernt am Ende selbst nichts mehr dazu. Er lernt nur Unfähigkeit.«