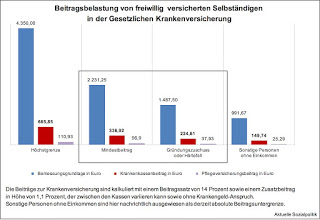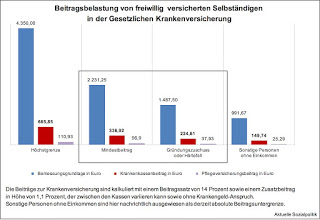Es ist ein Wesensmerkmal der meisten sozialpolitischen Bereiche, dass es eine große Asymmetrie gibt zwischen denen, die auf Leistungen angewiesen sind und diese in Anspruch nehmen wollen bzw. müssen, und den großen Sozialleistungsträgern, die eben nicht nur als Dienstleistungsscharnier fungieren, sondern nach ganz eigenen und seit vielen Jahren zunehmend auch betriebswirtschaftlichen Steuerungsvorgaben arbeiten (müssen). Und neben der berechtigten Abwehr von Leistungsmissbrauch (und damit Schädigung der Solidargemeinschaft) kann es gerade dann, wenn die Träger im Wettbewerb stehen und Kosten „drücken“ müssen, dazu kommen, dass man versucht ist, auch berechtigte Leistungserwartungen der Mitglieder oder „Kunden“, wie die heute so oft genant werden, zu verweigern oder zumindest den Zugang zu erschweren. Nun wird sich das angedeutete Spannungsverhältnis zwischen den beiden Seiten niemals vollständig auflösen lassen, aber gerade bei sozialpolitischen Leistungen, die ja oftmals von existenzieller Bedeutung sind, ist es wichtig, dass man genau hinschaut, wenn David (der einzelne Versicherte, Patient, Klient) auf Goliath (die großen Krankenkassen, die Jobcenter, die Jugendämter usw.) trifft, denn die Kräfteverhältnisse sind hier immer ungleich verteilt und die vielen Kleinen benötigen Schutz vor immer möglicher administrativer Willkür.
Im Bereich der Krankenkassen geht es nicht nur um das laut Umfragen „höchste Gut“ der Menschen, also Gesundheit bzw. dessen Infragestellung durch Unfall oder Erkrankung, sondern auch um eine wahrhaft unüberschaubare Vielzahl von Leistungen. Im Krankenhaus operiert zu werden oder vom niedergelassenen Vertragsarzt Medikamente verordnet zu bekommen – das fällt den meisten Menschen sicher sofort ein, wenn es um das Leistungsspektrum der Krankenkassen geht. Aber da gibt es noch zahlreiche andere Leistungen – von den Heil- und Hilfsmitteln, den Vorsorge- und Rehamaßnahmen, häusliche Krankenpflege und vieles mehr. Und gerade in diesen Bereichen wird immer wieder auch in den Medien von Ablehnungen, Verweigerungen, Hinhalte-Taktiken der Krankenkassen gegenüber einzelnen Versicherten berichtet. Nur stellt sich dann immer auch die Frage, ob es sich hierbei um bedauernswerte Einzelfälle handelt oder ob das öfter vorkommt und vielleicht sogar einem Muster folgt.
Auch den Patientenbeauftragten der Bundesregierung bewegt dieses Thema – schon allein deshalb, weil bei ihm natürlich viele Fälle landen, wo ein David aus der Masse der Versicherten Beschwerde führt gegen einen Goliath der Krankenversicherungswelt. Also wollte man von dort aus mehr wissen.
»Das Thema Leistungsbewilligungen und -ablehnungen durch gesetzliche Krankenkassen steht immer wieder im Fokus der öffentlichen Diskussion. Aus den Beschwerden von Versicherten bei der Geschäftsstelle des Patientenbeauftragten geht hervor, dass viele Betroffene eine Leistungsablehnung oftmals nicht nachvollziehen können, auch wenn sich die Entscheidungen der Krankenkassen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des SGB V begründen lassen. Des Weiteren wird vielfach – insbesondere von Seiten der Patientenorganisationen – kritisiert, dass Krankenkassen die beantragten Leistungen von Patientinnen und Patienten verspätet, pauschal und ohne Einzelfallprüfung ablehnen würden«, so heißt es in der Ausgangsbeschreibung für eine Studie, die man dann in Auftrag gegeben hat.
Da bezüglich der Anzahl der Leistungsbewilligungen und -ablehnungen – mit der Ausnahme der sog. KG 5- Statistik des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) für den Bereich der Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen – keine amtlichen Statistiken zu Verfügung stehen, sollte anhand einer empirischen Analyse ein neutraler und sachlicher Überblick über die Leistungsbewilligungen und -ablehnungen der gesetzlichen Krankenkassen erstellt werden.
Dabei geht es um diese wichtigen Fragen:
1) Wie häufig werden Leistungsanträge von den Krankenkassen bewilligt bzw. abgelehnt? Welche Leistungsbereiche sind häufig von Ablehnungen betroffen?
2) Wie und in welchem Umfang werden die Versicherten über die Gründe für eine Bewilligung bzw. Ablehnung eines Leistungsantrags informiert? Wie verständlich sind diese Informationen für die Versicherten?
3) Wie häufig kommt es zu Fristüberschreitungen nach § 13 Abs. 3a SGB V? Wie sind die Versicherten über die Regelungen des § 13 Abs. 3a SGB V informiert?
4) Wie häufig kommt es zu Widersprüchen oder Klagen? Wie erfolgreich sind Widersprüche und Klagen?
Herausgekommen ist diese Ausarbeitung:
Monika Sander, Martin Albrecht, Verena Stengel, Meilin Möllenkamp, Stefan Loos und Gerhard Igl (2017): Leistungsbewilligungen und -ablehnungen durch Krankenkassen. Studie für den Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten sowie Bevollmächtigten für Pflege, Berlin: IGES Institut, Juni 2017.
Es gibt auch eine Kurzfassung der Studie.
Susanne Werner hat ihren Artikel zu den Ergebnissen der Studie so überschrieben: Rätselhafte Vielfalt bei den Leistungen: Ob eine Leistung bewilligt wird oder nicht, hängt laut einer aktuellen Studie ganz erheblich von der Kasse ab. Über alle Leistungsbereiche hinweg lehnen die Kassen im Durchschnitt 5,2 Prozent der beantragten Leistungen ab. Einzelne Leistungsbereiche aber fallen durch besonders viele Absagen auf. Beispielsweise zeigen sich die Kassen auch bei den stationären Präventionsleistungen wie etwa Vorsorgekuren oder Mutter-Vater-Kind-Angeboten zugeknöpft. Etwa jedem dritten Antrag auf eine entsprechende präventive Maßnahme wurde 2015 eine Absage erteilt.
Als die Ergebnisse der Studie veröffentlicht wurden, fand der Patientenbeauftragte – mittlerweile als Gesundheits- und Arbeitsminister in die neue nordrhein-westfälische Landesregierung gewechselt – deutliche Worte: Neue Studie zur Bewilligung von Leistungsanträgen. Staatssekretär Laumann kritisiert gravierende Unterschiede zwischen Leistungsbereichen und Krankenkassen:
»Die Studie zeigt insbesondere, dass es bei der Bewilligung und Ablehnung von Leistungsanträgen teils erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Leistungsbereichen und den unterschiedlichen gesetzlichen Krankenkassen gibt. Nach Ansicht von Staatssekretär Laumann sind diese Unterschiede größtenteils nicht nachvollziehbar und gehören unverzüglich abgestellt.«
Das muss man mit Zahlen belegen können, also lesen wir weiter:
»So wird beispielsweise bei den Leistungen im Bereich der Vorsorge und Rehabilitation im Durchschnitt fast jeder fünfte Antrag (18,4 Prozent) von den Krankenkassen abgelehnt. Die Spannbreite der Ablehnungsquoten der einzelnen Krankenkassenarten liegt dabei zwischen 8,4 und 19,4 Prozent. Gegen rund jede vierte Leistungsablehnung in dem Versorgungsbereich wird Widerspruch eingelegt (24,7 Prozent). Und weit mehr als jeder zweite eingelegte Widerspruch (56,4 Prozent) ist erfolgreich oder zumindest teilweise erfolgreich, indem der Antrag schließlich doch wie beantragt oder mit anderer Leistung bewilligt wird. Bei der medizinischen Vorsorge für Mütter und Väter trifft das sogar auf sage und schreibe fast drei von vier Widersprüchen zu (72,0 Prozent).«
Man sollte an dieser Stelle mit Blick auf den Klageweg zur Sozialgerichtsbarkeit auf die Größenordnung hinweisen: 46.000 Streitfälle aus dem Bereich der Krankenversicherung wurden von deutschen Sozialgerichten verhandelt. Dabei hatte jede vierte Klage Erfolg.
Die Schlussfolgerungen von Laumann aus den nun vorliegenden Studienergebnissen werden von ihm so auf den Punkt gebracht:
„Wenn – wie bei den Leistungsanträgen zur Vorsorge und Rehabilitation – weit mehr als jeder zweite Widerspruch erfolgreich ist, kann bei der Bewilligungspraxis etwas nicht stimmen. Es ist auch nicht zu erklären, wieso die Ablehnungsquoten bei Anträgen auf Hilfsmittel für chronische Wunden zwischen den einzelnen Krankenkassen zwischen 3,8 und 54,7 Prozent regelrecht auseinanderklaffen. Die Krankenkassen dürfen erst gar nicht den Verdacht aufkommen lassen, dass sie bestimmte Leistungen zunächst einmal systematisch ablehnen, obwohl die Menschen einen klaren gesetzlichen Anspruch darauf haben. Das untergräbt massiv das Vertrauen in die Krankenkassen.“
Kritik ist das eine – und sie ist offensichtlich angebracht. Aber welche gesundheitspolitischen Schlussfolgerungen kann und muss man daraus ziehen? Dazu der bisherige Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Karl-Josef Laumann, durchaus konkret:
„Vor allem müssen die Krankenkassen in Zukunft verpflichtet werden, die Daten zu den Leistungsbewilligungen und –ablehnungen zu veröffentlichen. Außerdem müssen sie die Patienten besser über das Verfahren der Leistungsbeantragung und das Widerspruchsverfahren informieren sowie die Gründe für eine Ablehnung verständlicher als bisher darlegen. Damit würde die Wahlfreiheit der Bürger gestärkt, sich ganz bewusst für oder gegen eine Krankenkasse zu entscheiden“, sagt Laumann. Er wiederholt zudem seine Forderung, dass Patienten bei Leistungsanträgen nach Ablauf der Entscheidungsfrist nicht nur einen Kostenerstattungsanspruch, sondern einen Anspruch auf die Sache selbst haben und die Krankenkassen diesen bezahlen müssen.