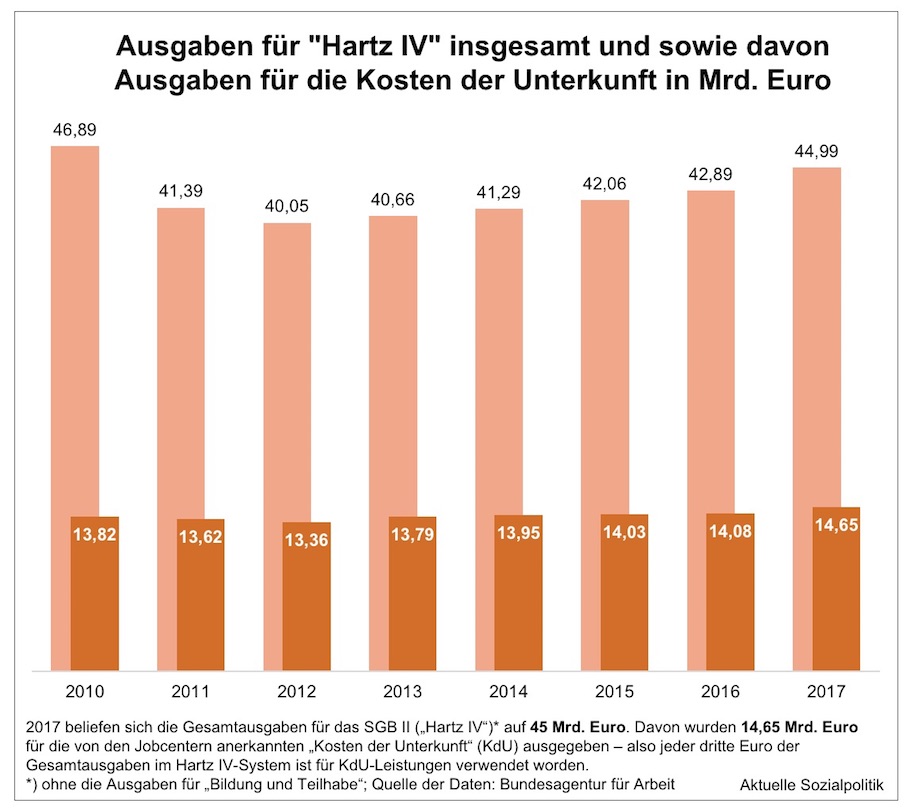Das war eine länger als geplante Partie, die da in Berlin gespielt wurde, bis endlich am vergangenen Mittwoch Abend das Ergebnis zweitägiger Verhandlungen über ein großes Konjunkturprogramm verkündet werden konnte. Das aber hatte es dann durchaus in sich. Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD hat versucht, einen semantischen Fußabdruck zu setzen, als er sagte, man wolle nun „mit Wumms aus der Krise kommen“. Folgt man der Häufigkeit, mit der sein „Wumms“ in den Medien aufgegriffen wurde, dann ist ihm das auch gelungen. Und man muss sich vor Augen halten, dass wir hier über gigantische Größenordnungen sprechen: Allein das nunmehr geschnürte Konjunkturpaket der Bundesregierung wird ein Volumen von (mindestens) 130 zu den bisherigen Rettungsprogrammen zusätzlichen Milliarden Euro haben, während gleichzeitig die Europäische Zentralbank (EZB) ihr zu Beginn der Krise aufgelegtes neues Anleihekaufprogramm von 750 auf 1.350 Milliarden Euro aufgestockt hat.
Im Mittelpunkt der allgemeinen Berichterstattung über das neue Konjunkturprogramm stehen Aspekte wie die erwartete, von vielen kritisierte und dann schlussendlich gestoppte Kaufprämie für alle Neuwagen, also auch Benziner und Diesel-Fahrzeuge. Oder der auch für viele Ökonomen eher überraschende Schritt, (vorerst) für ein halbes Jahr die Mehrwertsteuer abzusenken und zu hoffen, dass das auch an die Verbraucher weitergegeben wird. Insgesamt wird man wohl bilanzieren dürfen, dass es von vielen Seiten eine grundsätzliche Zustimmung zu dem 57 Maßnahmen umfassenden Paket (Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken. Ergebnis Koalitionsausschuss 3. Juni 2020) gibt, wenngleich jetzt, nachdem der erste Nebel verzogen ist, Detailaspekte auch kritisch diskutiert werden (beispielsweise, dass es offensichtlich nicht so ist, dass eine kurzfristige Mehrwertsteuersenkung einfach per Knopfdruck umgesetzt werden kann, vgl. dazu z.B. Handel fürchtet Millionenkosten durch Mehrwehrtsteuersenkung.)
Aber hier soll es um einen ganz besonderen Aspekt gehen: Was bringt das umfangreiche Maßnahmenpaket Menschen mit niedrigen Einkommen (nicht)?