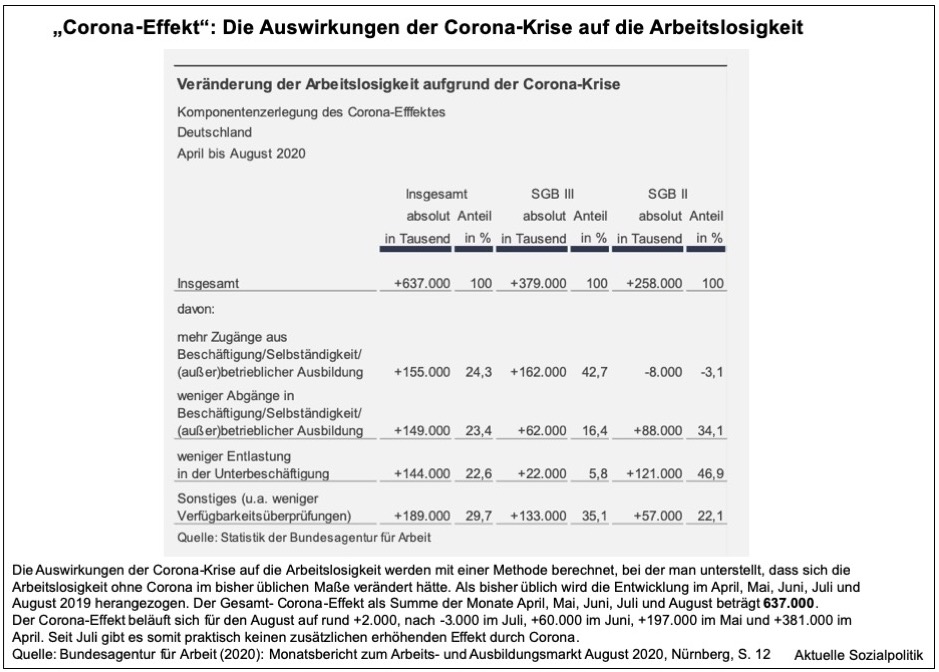Neben der oftmals (und interessanterweise gerade von Ökonomen, die es besser wissen sollten und könnten) ausgeblendeten Tatsache, dass es „den“ Arbeitsmarkt nicht gibt, sondern eine Vielzahl ganz unterschiedlich konfigurierter und in der Regel dann auch noch lokal/regional begrenzter Teilarbeitsmärkte, muss man darauf hinweisen, dass sich die arbeitsmarktlichen Angebots-Nachfrage-Verhältnisse strukturell, aber eben auch situationsbedingt umkehren können. Was natürlich Auswirkungen hat auf die Machtverhältnisse, besser die Asymmetrie der Machtverhältnisse, die sich dann abbilden in den Tarifauseinandersetzungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, wenn solche überhaupt relevant sind (man denke hier an das Phänomen quasi tariffreier Zonen bzw. Regionen unseres Landes).
Wie schnell und umfassend sich die Vorzeichen in einem spezifischen Arbeitsmarktsegment ändern können, lässt sich am Beispiel der Fluggesellschaften und ihres Personals studieren. Noch im vergangenen Jahr war auch aufgrund der bis dahin stetig steigenden Nachfrage nach Flügen die Arbeitsmarktlage der meisten Piloten so gut, dass selbst ein arbeitnehmerfeindlicher Intensivtäter wie Ryanair gezwungen war, den Piloten (und ein echter „Höllenritt“ für dieses Unternehmen: den Gewerkschaften) bei den Arbeitsbedingungen entgegenzukommen, weil es einen zunehmenden Personalmangel gab. Und dann kam die Corona-Krise über uns und von einem Moment auf den anderen hat sich alles verändert aufgrund der massiven Einbrüche im Luftverkehr. Die waren und sind so außergewöhnlich, dass selbst gestandene und stolze Piloten beispielsweise der Lufthansa zu bislang unvorstellbaren Gehaltseinbußen bereit waren bzw. sein mussten. In kürzester Zeit hat sich die Machtasymmetrie aufgrund völlig verkehrter Angebots-Nachfrage-Relationen zuungunsten der Beschäftigten gedreht und dass in so einer Branche wenn überhaupt, dann über die Sicherung eines Teils der noch vorhandenen Belegschaften, aber sicher nicht über Lohnerhöhungen verhandelt wird, erschließt sich von selbst.