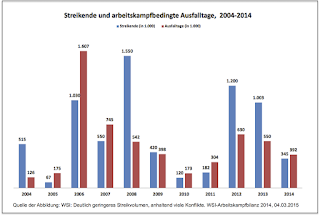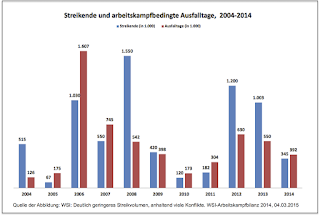Jetzt hat er also begonnen – der unbefristet angelegte Streik der Pflegekräfte an der Charité in Berlin. Die Charité gehört zu den größten Universitätskliniken Europas. In der Selbstdarstellung liest sich das so: »Die Charité verteilt sich auf vier Standorte, zu denen rund 100 Kliniken und Institute, gebündelt in 17 CharitéCentren, gehören. Mit 13.100 Mitarbeitern erwirtschaftet die Charité 1,5 Milliarden Euro Gesamteinnahmen pro Jahr und ist damit einer der größten Arbeitgeber Berlins. Im Jahr 2010 konnte die Charité auf eine 300-jährige Geschichte zurückblicken.« Es gibt insgesamt 3.000 Betten – von denen werden in den kommenden Tagen fast 1.000 nicht mehr belegbar und 200 Operationen werden pro Tag ausfallen, weil die Pflegekräfte in den Arbeitskampf ziehen. Nicht für mehr Geld oder weniger Arbeitszeit – sie kämpfen für mehr Personal. Mehr Leute sollen an Bord der Pflege.
Es ist sicherlich keine Übertreibung zu sagen, dass wir es mit einem historischen Ereignis zu tun haben – mit allen Unwägbarkeiten und Risiken, die damit verbunden sind. Es wird auf der einen Seite verdammt schwer, diesen Streik als überzogenes Verhalten irgendeiner kleinen Beschäftigtengruppe, die sich die Taschen voll machen wollen, zu desavouieren. Das spricht dafür, dass es eine breite Sympathiebewegung geben wird. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass das Pflegepersonal vor einem Problem stehen, das bereits im Erzieher/innen-Streik der vergangenen Wochen zu beobachten war: Bestreikt werden können sowohl in den Kitas wie auch in den Krankenhäusern nicht die Arbeitgeber direkt, wie beispielsweise in der Automobilindustrie oder anderen „normalen“ Unternehmen, sondern getroffen werden können diese nur indirekt, über die Kinder bzw. Eltern oder eben die Patienten. Und das ruft nach kurzer Zeit erhebliche Widerstände in Teilen der betroffenen Bevölkerung hervor. Das alles haben wir beobachten müssen mit zunehmender Dauer des Kita-Streiks und das wird wesentlicher heftiger ausfallen, wenn sich das im Gesundheitswesen zuspitzt. Allerdings – das muss man hervorheben – wird ein Krankenhaus weitaus schneller und wesentlich härter ökonomisch von einem Arbeitskampf getroffen als eine Kita. Das ist auch eine Folge des Finanzierungssystems auf Basis von Fallpauschalen, mit denen nur erbrachte Leistungen vergütet werden. Und wenn pro Tag 200 OPs ausfallen müssen, dann kann man sich vorstellen, um welche Verlustgrößen in Euro es hier für die Charité gehen wird.
Anfang Juni 2015 berichtete die Berliner Zeitung in dem Artikel Charité-Mitarbeiter wollen unbefristet streiken:
»Charité-Mitarbeiter wollen unbefristet streiken … Nach langen, aber ergebnislosen Verhandlungen steht der Charité ein unbefristeter Ausstand bevor. Am 22. Juni soll es losgehen. Nicht der Streik, sondern der Normalzustand an der Klinik gefährde die Patienten, erklärt die Gewerkschaft … In dem Konflikt geht es vor allem um die Situation der Pflegekräfte: Sie beklagen eine zu dünne Personaldecke und eine sehr hohe Arbeitsbelastung. Bemühungen um einen Tarifvertrag, der etwa Forderungen nach Mindestbesetzungen auf Stationen Rechnung trägt, laufen seit 2013. Die Charité-Leitung sieht jedoch Hindernisse: Die geforderten 600 Zusatz-Pfleger seien nicht verfügbar und die Kosten dafür zu hoch.«
Nunmehr ist diese Ankündigung Wirklichkeit geworden. »Die in Verdi organisierten Charité-Beschäftigten fordern mehr Personal, auch um stressbedingte Versorgungsfehler am Krankenbett zu vermeiden. Konkret hieße das, zu den mehr als 4.000 Charité-Pflegekräften kämen Hunderte neue Stellen. Die Gewerkschaft hatte fast drei Jahre mit dem Vorstand verhandelt, der wiederholt erklärte, der Charité fehle dafür das Geld, vielmehr seien die Krankenkassen und die Bundespolitik zuständig«, kann man dem Artikel Wenn die Krankenbetten leer bleiben von Hannes Heine und Juliane Fiegler entnehmen.
An dieser Stelle sei der Hinweis darauf erlaubt, dass wir hier mit einer durchaus vergleichbaren Problematik konfrontiert werden, die bereits beim Streik der Erzieher/innen eine wichtige Rolle gespielt hat bzw. spielt: Viele Kommunen argumentieren dort, dass sie ja gerne die Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen besser bezahlen möchten, dazu finanziell aber nicht in der Lage sind, weil sie bereits heute mit der Umsetzung des vom Bundesgesetzgeber vorgeschriebenen Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab dem vollendeten ersten Lebensjahr überfordert seien. Wenn man die Fachkräfte besser bezahlen möchte, dann seien an dieser Stelle die Bundesländer und der Bund in der Verantwortung – was durchaus richtig ist, für die betroffenen Arbeitnehmer aber dazu führen kann, dass sie im Niemandsland der Nicht-Zuständigkeit der drei föderalen Ebenen hängen bleiben. Durchaus vergleichbar könnte das sein, was jetzt den Pflegekräften im aktuellen Arbeitskampf droht. Die Charité wird argumentieren, dass das Anliegen der Streikenden ja durchaus nachvollziehbar sei, hierzu aber eine bundeseinheitliche Regelung angestrebt werden müsse, weil sich das vor Ort in den einzelnen Krankenhäuser gar nicht realisieren lässt.
»Der Charité-Ausstand ist im Kern ein politischer Streik – er fordert nicht nur die Universitätsklinik, sondern das Gesundheitswesen heraus. Zu Recht«, so Hannes Heine in seinem Kommentar Ein krankes System, der schon vom 28. April 2015 datiert und über den damaligen zweitägigen Streik an der Charité berichtet hat. »Weil es den überraschend zahlreichen Streikenden nicht um die Löhne geht, sondern darum, die Spitze der Universitätsklinik zu einer anderen Personalpolitik zu zwingen, ist dieser Arbeitskampf im Kern das, was in Deutschland gar nicht erlaubt ist: ein politischer Streik«, so Heine und er findet das auch gut so. Denn ansonsten wird sich kaum etwas bewegen auf der politischen Bühne, die sich bislang darauf verlassen konnte, dass das Pflegepersonal schon nicht streiken wird und man sich weiterhin arrangieren kann bzw. die Interessen anderer Gruppen, beispielsweise der Ärzte, eher verfolgt als die der Pflege, die – wenn überhaupt – nur vor sich hin meckert.
Aber die Pflegekräfte an der Charité haben sich entschlossen, den harten, steinigen Weg eines Arbeitskampfes einzuschlagen. Vielleicht wird sich das einmal als der entscheidende Arbeitskampf im deutschen Gesundheitswesen erweisen. Noch nie wurde für mehr Kollegen gestreikt, statt für mehr Lohn. Erst einmal handelt es sich um einen lokalen Streik – die Charité behandelt etwa 20 Prozent der Berliner Patienten, Vivantes beispielsweise 30 Prozent. Vielleicht rührt daher die derzeit beobachtbare Interaktivität der Berliner Politik, die die Charité in den Streik hinein laufen lässt, ohne irgendwelche Aktivitäten erkennen zu lassen. Vielleicht ist es die Hoffnung, dass sich die Patienten eben auf die anderen Krankenhäuser verteilt werden, irgendwie, und man das ganze aussitzen kann. unsicher werden genau deswegen auch zahlreiche Zweifler ihre Bedenken vortragen, ob dieser Weg denn der richtige und vor allem der erfolgreicher sein kann.
Auch hier kann der Blick in die Vergangenheit helfen. Hannes Heine hat darauf hingewiesen:
»Führen lokale Arbeitskämpfe zu neuen Bundesgesetzen? Historisch gesehen, ja. Heute ist die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall üblich, Millionen nehmen sie in Anspruch. In den 50ern galt dieses Recht nur für Angestellte. Im Winter 1956/57 streikten die Werftarbeiter in Schleswig-Holstein heute unvorstellbare 16 Wochen lang, um die Lohnfortzahlung für Arbeiter durchzusetzen. Weil man in der Bundespolitik fürchtete, solche Tarifverträge würden bald alle wollen, fand sich bald eine Bundestagsmehrheit für eine erste Gesetzesnovelle. Volle Gleichstellung gab es dann 1970.«
Ein solches Unterfangen lebt immer von den handelnden Akteuren, die bereit sind, den steinigen Weg auch zu gehen – Hannes Heine porträtiert einen davon in seinem Artikel Von Bett zu Bett hetzen – bis einer was vergisst: Carsten Becker, 49 Jahre alt, Personalrat in der landeseigenen Charité. Und Becker kann den Streik gut begründen:
»Pro Schicht betreut eine Schwester auf der Normalstation zehn, elf, zwölf Patienten. Hetzt von Bett zu Bett. Bis sie womöglich etwas vergisst, eine Patientenakte, vielleicht aber auch das Desinfizieren der Hände. Nachts betreut eine Schwester 25 Patienten, oft sind Schwergewichtige dabei, die sie ohne Hilfe kaum umdrehen kann. Druckgeschwüre drohen. Nachts keine Schicht allein, fordern die Streikenden, tagsüber fünf Patienten pro Pflegekraft.«
„Wir brauchen mehr Leute“, sagt Becker. „Der Vorstand weiß das.“ Damit direkt angesprochen ist Karl Max Einhäupl, 68 Jahre, Neurologe. Er ist Chef der Charité.
»Einhäupl wollte den Streik vom Arbeitsgericht verbieten lassen, das Patientenwohl sei gefährdet, die Forderungen seien kaum tariffähig. Selbstverständlich, erklärte der Richter, dürfe man für mehr Personal streiken. Und mit Verdi ist vereinbart worden, Notfälle auch während des Streiks zu versorgen. Einhäupl versucht es nun beim Landesarbeitsgericht.« Aber der Streik hat erst einmal begonnen, die Karawane hat sich in Bewegung gesetzt. Und pro Streiktag verliert die Charité mindestens 500.000 Euro.
Nur für alle potenziellen Kritiker der Streikaktionen sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen: Der Arbeitskampf ist nicht vom Himmel gefallen, sondern steht am Ende einer längeren Geschichte:
»Die Pflegekräfte sehen durch den schlechten Personalschlüssel und den hohen Einsatz von Leiharbeitern die Standards nicht mehr eingehalten und deshalb die Sicherheit der Patienten gefährdet. Deshalb verhandelt ver.di seit mehr als zweieinhalb Jahren mit der Klinikleitung über eine Mindestbesetzung, die die Gewerkschaft in einem Tarifvertrag festhalten will. Unter anderem fordern sie, dass nachts auf jeder Station mindestens zwei Kollegen Dienst tun und für Intensivstationen einen Betreuungsschlüssel von einer Fachkraft für zwei Patienten. Damit orientiert sich ver.di an Empfehlungen der Fachgesellschaften. Außerdem möchte die Gewerkschaft verbindliche Verfahren zum Erfassen von Überlastungssituationen. Allein seit Beginn der Gespräche haben Beschäftigte laut ver.di mehr als 800 Gefährdungsanzeigen bei der Klinikleitung vorgebracht, um dieser die prekäre Personalsituation vor Augen zu führen und auf die Konsequenzen aufmerksam zu machen. Doch auf eine Reaktion warten sie in den meisten Fällen vergeblich«, so Claudia Wrobel in ihrem Artikel Patientengefährdung.
Auch in diesem Blog wurde bereits mehrfach über das Thema berichtet, so beispielsweise im Zusammenhang mit Erkenntnissen über die desaströse Situation bei den Nachtdiensten: Man kann sich auch zu Tode sparen. Die alles überlagernde Kostensenkungslogik trifft in der Pflege beide Seiten der Medaille hart, die Patienten und die Pflegekräfte, so beispielsweise die Überschrift eines Beitrags vom 07. 03.2015.
Letztendlich geht es um die Frage von Personal(mindest)standards. Denn die sind entgegen der Annahme vieler „normaler“ Bürger im Krankenhausbereich gerade nicht vereinbart, geschweige denn, dass ihre tatsächliche Ausprägung vor Ort entsprechend überprüft wird. Bereits am 08.09.2014 wurde dies in dem Beitrag Pflegenotstand – und nun? Notwendigkeit und Möglichkeit von Mindeststandards für die Ausstattung der Krankenhäuser mit Pflegepersonal entfaltet. Dabei handelt es sich um eine sehr lange, gleichsam unendliche Geschichte. Man kann die mit einem Kürzel belegen: PPR. Das steht für „Pflege-Personalregelung“. Die gab es schon mal – und wurde dann ganz schnell wieder eingestampft.
Die Pflege-Personalregelung wurde 1993 eingeführt, um die Leistungen der Pflege transparenter zu machen und eine Berechnungsgrundlage für den Personalbedarf zu haben. Experten gingen damals davon aus, dass sich durch konsequente Anwendung der PPR bundesweit ein Personalmehrbedarf im fünfstelligen Bereich ergeben würde. Als sich abzeichnete, dass die daraus resultierenden Mehrkosten nicht zu tragen sind, wurde die Pflege-Personalregelung schnell wieder ausgesetzt.
Wie gesagt, das war Anfang der 1990er Jahre. Heute schreiben wir das Jahr 2015. Und im Interview mit Sylvia Bühler, Bundesvorstandsmitglied bei der Gewerkschaft ver.di und Leiterin des Fachbereichs Gesundheit und soziale Dienste, unter der Überschrift „Alarmsignale in den Kliniken werden ignoriert“ muss man lesen: 162.000 Stellen fehlen in deutschen Krankenhäusern, davon allein 70.000 in der Pflege. Gegen die Personalnot fordert ver.di eine gesetzliche Regelung. Eva Quadbeck zitiert in ihrem Artikel Die Not der Klinikpfleger Andreas Westerfellhaus, den Vorsitzenden des Deutschen Pflegerats: „Seit 2007 wurden 50.000 Pflegestellen in Krankenhäusern abgebaut. Oft genug sind nur eine Krankenschwester und eine Schwersternschülerin für rund 30 Patienten zuständig“. Die Arbeitsbelastung hat nach Daten des Statistischen Bundesamtes in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Während im Jahr 2000 eine Vollzeit-Pflegekraft auf 100 Krankenhausfälle kam, musste sich diese Kraft im Jahr 2013 um 115 Fälle kümmern.
Man kann nur hoffen, dass die Pflegekräfte an der Charité Erfolg haben, nicht ausgehungert werden an der langen Leine des Tot-Stellens, wie wir es von der Arbeitgeber-Seite beispielsweise im Kita-Streik haben zur Kenntnis nehmen müssen. Es ist Zeit für einen Aufbruch der Pflegekräfte. Wenn nicht jetzt, wann dann?