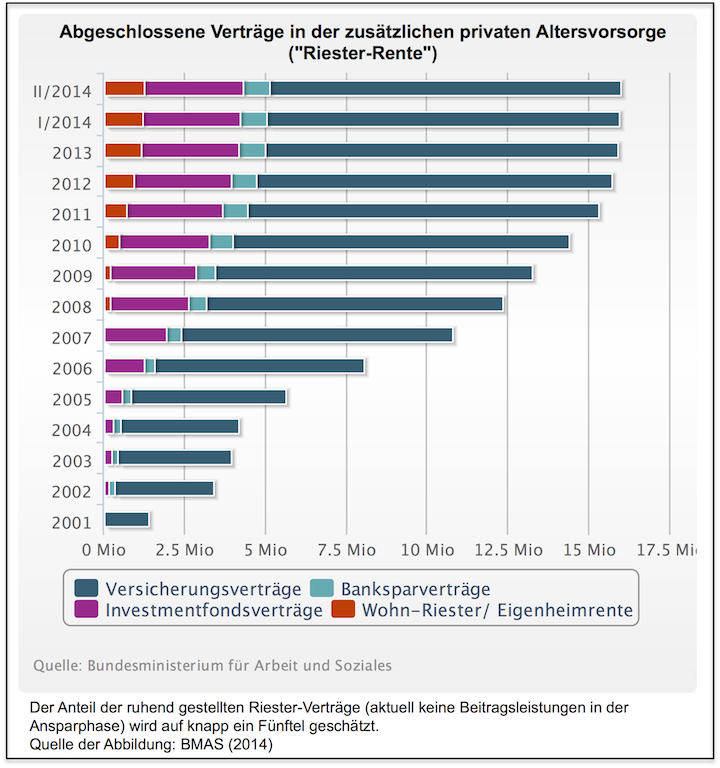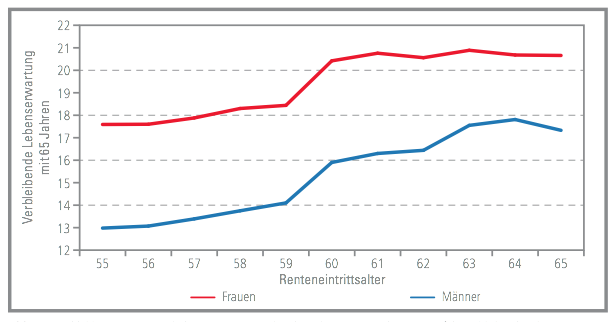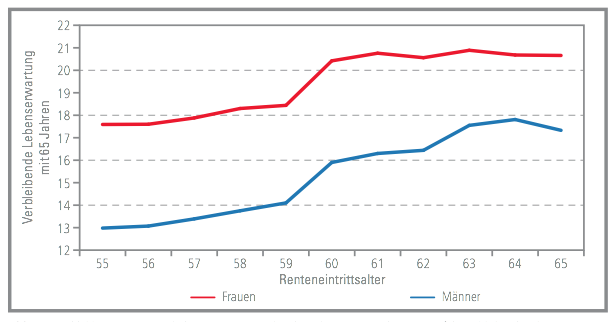Vielleicht hilft uns – hinsichtlich der ökonomischen Dimensionen – der folgende Beitrag aus dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW):
Die Wiedervereinigung – eine ökonomische Erfolgsgeschichte, so ist der DIW Wochenbericht Nr. 40/2014 gleichsam euphemistisch überschrieben, mit Beiträgen von Karl Brenke, Marcel Fratzscher, Markus M. Grabka, Elke Holst, Sebastian Hülle, Stefan Liebig, Maximilian Priem, Anika Rasner, Pia S. Schober, Jürgen Schupp, Juliane F. Stahl und Anna Weiber überschrieben. Bei so vielen Autoren muss das gewichtig sein. In diesem Heft findet sich auch der Artikel Ostdeutschland – ein langer Weg des wirtschaftlichen Aufholens von Karl Brenke. Der schreibt in seiner Einleitung:
»Der wirtschaftliche Rückstand Ostdeutschlands gegenüber Westdeutschland ist 25 Jahre nach dem Fall der Mauer immer noch groß. Beim Bruttoinlandsprodukt je Einwohner werden 71 Prozent und bei der Produktivität etwa drei Viertel des westdeutschen Niveaus erreicht. Der Aufholprozess kommt nur noch sehr langsam voran. Der entscheidende Grund für die geringe Produktivität ist der Mangel an hochqualifizierten Tätigkeiten. Zudem ist die ostdeutsche Wirtschaft vergleichsweise kleinteilig strukturiert. Das verfügbare Einkommen je Einwohner liegt in Ostdeutschland bei 83 Prozent des westdeutschen Wertes. An dieser Relation hat sich seit Ende der 90er Jahre nichts Wesentliches geändert. Die Arbeitslosigkeit ist in Ostdeutschland noch relativ hoch, in den vergangenen Jahren ist sie aber stärker als in Westdeutschland zurückgegangen. Dies ist allerdings zum Teil Folge des schrumpfenden Erwerbspersonenpotentials; besonders deutlich geht die Zahl der Jugendlichen zurück.
Die Erwartung zur Zeit der Wende, dass der Osten bei Wirtschaftskraft und Lebensstandard rasch zum Westen aufschließen wird, hat sich nicht erfüllt. Sie war auch übertrieben, denn man ging davon aus, dass eine traditionell dünn besiedelte Transformationsregion in relativ kurzer Zeit eine der leistungsfähigsten Ökonomien der Welt einholen könnte. Gleichwohl gibt es große Anpassungsfortschritte. Insbesondere ist in Ostdeutschland eine Re-Industrialisierung gelungen. Eine große Herausforderung stellt der demografische Wandel dar. Die Zahl junger Erwerbspersonen geht in Ostdeutschland deutlich stärker zurück als in Westdeutschland. Um Fachkräfte zu halten oder anzuziehen, muss in Ostdeutschland das Angebot attraktiver Arbeitsplätze mit guter Entlohnung gesteigert werden. Höhere Löhne müssen allerdings mit höherer Produktivität einhergehen und diese wiederum erfordert eine verstärkte Innovationstätigkeit.«
Auch der Beitrag von Maximilian Priem und Jürgen Schupp Alle zufrieden – Lebensverhältnisse in Deutschland, der über die Lebenszufriedenheit der Menschen in Ost- und Westdeutschland auf der Grundlage ihrer eigenen Einschätzung berichtet, kommt zu einem insgesamt erfreulichen Ergebnis:
»25 Jahre nach dem Fall der Mauer haben sich die Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland noch nicht vollständig angeglichen. Das war freilich in realistischer Betrachtung auch nicht zu erwarten. Trotz steigender Lebenszufriedenheit in den neuen Bundesländern konnte der Ost-West-Unterschied noch nicht nivelliert werden. Dies belegen die aktuellsten vom DIW Berlin in Zusammenarbeit mit TNS Infratest Sozialforschung erhobenen Daten der Langzeitstudie Sozio-oekonomisches Panel (SOEP). Demnach sind Menschen in Ostdeutschland im Jahr 2013 signifikant weniger zufrieden als in Westdeutschland, obwohl ihre Zufriedenheit so hoch ist wie noch nie im Zeitraum der Erhebung, die dort im Juni 1990 – kurz vor der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion – erstmals durchgeführt wurde. Weitere subjektive Indikatoren zeigen Differenzen in der Zufriedenheit mit dem Haushaltseinkommen, der Gesundheit und der Kinderbetreuung. Angeglichen hat sich die Zufriedenheit mit der Wohnung, der Haushaltstätigkeit, Arbeit und Freizeit. Die Menschen in Ostdeutschland sorgen sich stärker um die eigene wirtschaftliche Situation und Kriminalität, während die Sorge um Ausländerfeindlichkeit und den Arbeitsplatz in ganz Deutschland abgenommen hat. Die SOEP-Befragungen zeigen: Die Lebensverhältnisse in Deutschland sind aus Sicht der Menschen weitgehend angeglichen. Trotz etlicher Probleme im Detail, wozu in den nächsten Jahren insbesondere die Entwicklung der Neurenten in Ostdeutschland zählen wird, ist die deutsche Wiedervereinigung eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte.«
Auch das Institut für Wirtschaftsforschung Halle hat ebenfalls im Umfeld des heutigen Tages eine interessante Broschüre veröffentlicht, in der wichtige Forschungsergebnisse aus diesem Institut, das ja seinen Sitz hat in Ostdeutschland hat, über die ökonomischen Folgen der Wiedervereinigung zusammengefasst sind:
Bereits angesprochen wurde die Thematik der Lohnentwicklung in Ostdeutschland. Hierzu gibt es eine neue Veröffentlichung vom Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) von Universität Duisburg-Essen:
Gerhard Bosch, Thorsten Kalina und Claudia Weinkopf: 25 Jahre nach dem Mauerfall – Ostlöhne holen nur schleppend auf (= IAQ-Report 2014-15), Duisburg, 2014.
Die IAQ-Forscher haben interessante Befunde zusammengetragen (vgl. Bosch/Kalina/Weinkopf 2014: 1):
»Die Stundenlöhne in Ostdeutschland haben sich von knapp 54% im Jahr 1992 bis auf 77% im Jahr 2012 an das Westniveau angenähert. Ein Großteil der Annäherung erfolgte in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung; seit 1995 hat sich der Angleichungsprozess deutlich verlangsamt. Ohne Änderungen in der Lohnpolitik werden die Ostlöhne erst im Jahre 2081 das Westniveau erreichen.
Der ostdeutsche öffentliche Dienst ist Vorreiter bei der Angleichung der Löhne; im ostdeutschen produzierenden Gewerbe stockt hingegen schon seit Mitte der 1990er Jahre der Angleichungsprozess.
In beiden Landesteilen hat die Ungleichheit der Lohnverteilung zugenommen. Am stärksten stiegen die oberen Löhne im Osten, am geringsten hingegen die unteren Löhne im Westen. Wir beobachten also nicht mehr alleine einen Aufholprozess des Ostens, sondern auch den Lohnverfall für Geringverdienende im Westen.
Die ostdeutschen Frauen erreichen 2012 bei den mittleren Verdiensten bereits 85,5% des westdeutschen Niveaus. Aufgrund des schnelleren Aufholprozesses bei den Frauenlöhnen ist der gender pay gap in Ostdeutschland erheblich geringer als in Westdeutschland.
Der gesetzliche Mindestlohn kann neuen Schwung in den Aufholprozess bringen, weil erheblich mehr ostdeutsche (29,3%) als westdeutsche Beschäftigte (16,9%) davon profitieren werden.«
Die vom IAQ präsentierten Befunde markieren einen wichtigen Punkt: Wir sind nach 25 Jahren weit weg von einer einheitlichen Asymmetrie zuungunsten des Ostens und zugunsten des Westens. Dies verdeutlicht das folgende Zitat: »Am stärksten stiegen die oberen Löhne im Osten, am geringsten hingegen die unteren Löhne im Westen.«
Vergleichbare Differenzierungen sehen wir auch in der Rentenversicherung, dem wichtigsten Teilbereich des Alterssicherungssystems. Hierzu beispielsweise der Beitrag Geschlechtsspezifische Rentenlücke in Ost und West von Anika Rasner:
»25 Jahre nach dem Mauerfall kommen Männer in Ost- und Westdeutschland in der wichtigsten Säule des deutschen Alterssicherungssystems auf ein vergleichbares Niveau. Im Durchschnitt übertreffen die Renten ostdeutscher Frauen die der Westdeutschen hingegen deutlich. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in den Rentenanwartschaften ostdeutscher Männer und Frauen werden im Kohortenvergleich geringer. Dieser Rückgang ist allerdings weniger das Ergebnis höherer Rentenanwartschaften ostdeutscher Frauen, sondern eher Folge deutlicher Einbußen bei den ostdeutschen Männern. Trotz allem werden die Rentenanwartschaften ostdeutscher Frauen auch in Zukunft deutlich höher als die westdeutscher Frauen liegen. In Westdeutschland bleibt die geschlechtsspezifische Rentenlücke im Kohortenvergleich hingegen konstant groß. Die westdeutschen Frauen der Babyboomer-Jahrgänge können den Abstand zu den Männern trotz zunehmender Erwerbsbeteiligung nur unwesentlich verkleinern« (Rasner 2014: 976).
Diese wenigen Daten mögen genügen, um dafür zu werben, den Blick auf fortbestehende, aber auch neu justierte Mauern gerade in der sozialpolitischen Landschaft zu schärfen, die Vergangenheit zur Kenntnis zu nehmen und zu berücksichtigen, sich aber nicht in ihr zu verlieren.