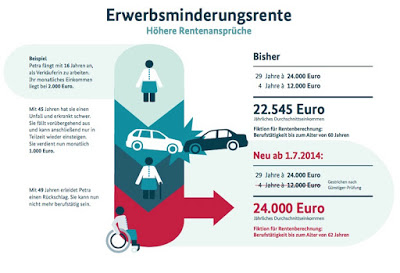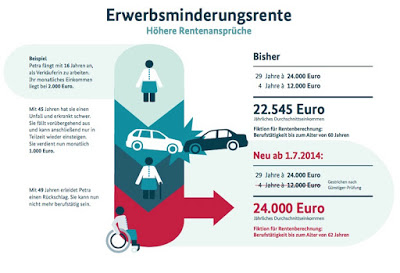Es ist sicherlich keine Übertreibung, wenn man feststellt: Die Visionen und Versprechungen, die Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre mit der staatlich geförderten kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge den Menschen in Aussicht gestellt wurden, haben sich für die meisten in Luft aufgelöst. Und zahlreiche Bürger haben schmerzhafte Erfahrungen machen müssen mit ihrem Vertrauensvorschuss, den sie der Riester-Rente gegeben haben, ausgehend von der Annahme, dass das doch eine seriöse Sache sein muss, denn der Staat unterstützt das und pampert einen sogar mit Zuschüssen aus Steuermitteln. Das würde er doch nicht machen, wenn das nicht in Ordnung ist. Weit gefehlt. Maschmeyer & Co. waren (und sind) die Gewinner des Paradigmenwechsels, den man auch so beschreiben kann: »Zu Beginn des Jahrhunderts beschloss die rot-grüne Bundesregierung eine drastische Absenkung des Rentenniveaus. Bis Anfang der 2030er Jahre wird der allgemeine Leistungsstandard der gesetzlichen Rente demnach um rund 20 Prozent sinken. Staatlich geförderte betriebliche Altersversorgung sowie private Altersvorsorge sollen die im Solidarsystem politisch aufgerissene Sicherungslücke schließen.« (Johannes Steffen, Für eine Rente mit Niveau. Zum Diskurs um das Niveau der Renten und das Rentenniveau, Berlin, August 2015).
Mittlerweile sind wir schlauer, dass das bei vielen Betroffenen nicht der Fall sein wird. Nun könnte man auf den durchaus naheliegenden Gedanken kommen, den ganzen Prozess wieder in eine andere (richtige) Richtung zu drehen und die umlagefinanzierte Alterssicherung wieder auszubauen. Gewerkschaften wie die IG Metall oder ver.di planen für dieses Jahr entsprechende Rentenkampagnen, was aber ein eigenes Thema wäre. Oder aber man versucht, auf der Grundlage der mittlerweile vorliegenden zahlreichen Kritikpunkte einen neuen Vorstoß in die Welt der kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge – und genau das versucht man unter dem Begriff „Deutschland-Rente“ zu leisten.
Was soll diese „Deutschland-Rente“ sein? Man kann es technisch zu beschreiben versuchen (was gleich geleistet wird), man kann aber auch darauf hinweisen, dass es sich (auch) um ein (potenzielles) politisches Gemeinschaftsprojekt einer bislang erst rudimentär etablierten politischen Konstellation – nämlich schwarz-grün – handelt, denn der Vorschlag kommt aus Hessen, von den hessischen Landesministern Tarek Al-Wazir (Grüne), Stefan Grüttner und Thomas Schäfer (beide CDU).
Am Tag vor dem Heiligen Abend wurde die Idee unter die Weihnachtsbäume der Bundesbürger gelegt – mittels eines Gastbeitrags der Minister in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die FAZ berichtete darüber unter der Überschrift CDU und Grüne schlagen „Deutschland-Rente“ vor.
„Wir schlagen eine einfache, sichere und günstige zusätzliche Altersvorsorge vor: die Deutschland-Rente, ein Standardprodukt für jedermann. Sie wird zum Selbstkostenpreis von einem zentralen Rentenfonds verwaltet, damit das Geld, das Bürger für ihre zusätzliche Altersvorsorge beiseite legen, sicher vor überteuerten Angeboten ist. Sie sorgt für Orientierung in einem unübersichtlichen Markt, schafft Vertrauen und hilft vor allem, der Altersarmut vorzubeugen. Der Staat organisiert sie und steht dafür mit seinem guten Namen: Daher nennen wir sie die Deutschland-Rente“, so werden die drei von der FAZ zitiert. Und ganz offensichtlich greifen sie eine mittlerweile weit verbreitete Kritik und Ablehnung der Riester-Rentenprodukte der staatlich subventionierten Versicherungswirtschaft auf: Die „zum Teil völlig überteuerten Riester-Produkte“ verunsicherten viele Bürger, kritisieren die Minister. „Wir brauchen für alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die nicht selbst aktiv werden wollen, ein einfaches, kostengünstiges und transparentes Standardprodukt, das der Staat organisiert.“ Da werden viele erst einmal zustimmend nicken.
Natürlich kann man sich die Vorschläge der drei Minister auch im Original anschauen, sie haben ein Positionspapier dazu ins Netz gestellt: Die Deutschland-Rente – Staat soll zentralen Rentenfonds organisieren. Vorschlag für einfache und sichere zusätzliche Altersvorsorge
In diesem Papier wird der Grundgedanke des neuen Instruments so beschrieben:
»Arbeitgeber führen die Beiträge für das Standardprodukt an die Deutsche Rentenversicherung ab, ähnlich wie die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung. Die Einzahlung erfolgt daher unbürokratisch auf bereits etabliertem Weg. Die Anlage der eingezahlten Beiträge obliegt dann dem Deutschlandfonds, einem eigenständigen zentralen Rentenfonds, der ohne eigenes Gewinninteresse auf Selbstkostenbasis arbeitet und geschützt vor politischem Zugriff ist. Das kapitalgedeckte Standardprodukt kann im Wege der betrieblichen und privaten Altersvorsorge angespart werden und wäre damit grundsätzlich auch für die Riester-Förderung zulagenfähig. Mit einem solchen Standardprodukt fallen Komplexität und hohe Verwaltungskosten vor allem für kleine Unternehmen weg. Gleichzeitig können Arbeitnehmer bei dem zentralen Rentenfonds darauf vertrauen, dass sie keinen überteuerten Angeboten aufsitzen werden. Natürlich verbleibt den Unternehmen sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die freie Entscheidung, ob sie betriebliche oder private Altersvorsorge über den Deutschlandfonds oder über andere Anbieter durchführen wollen.«
Zugleich will man einen weiteren Paradigmenwechsel en passant miterlerdigen, denn das bisherige „Opt-in“ soll durch ein „Opt-out“ ersetzt werden. Anders gesagt: Arbeitnehmer betreiben betriebliche bzw. private Altersvorsorge, sofern sie gegenüber dem Arbeitgeber nicht aktiv widersprechen. Wollen sie das nicht, müssen sie aktiv werden und sich entsprechend verabschieden, heute haben wir die umgekehrte Situation, dass die Einzelnen selbst tätig werden müssen, um eine entsprechende Vorsorge zu leisten, vor allem bei der privaten Altersvorsorge.
Das ist ja auch einer der vielen gewichtigen Kritikpunkte, dass die Rentenkürzungen im wichtigsten System der Alterssicherung, also der Gesetzlichen Rentenversicherung, ausnahmslose für alle und ohne Einschränkungen gilt, während die versprochene Kompensation der dadurch aufgerissenen Budgetlöcher im Ruhestand durch eine private Altersvorsorge lediglich freiwillig ausgestaltet worden ist – mit der empirisch beobachtbaren Folge, dass die mittleren und höheren Einkommen (von denen viele auch so gespart hätten, also ohne eine staatliche Subventionierung) die Förderung „mitnehmen“, während gerade die, die eine zusätzliche Alterssicherungsleistung benötigen, weil ihre normale Rente wegen niedriger Einkommen und/oder Arbeitslosigkeitsphasen in der individuellen Erwerbsbiografie sehr gering ausfallen wird, so dass sie auf die Kompensation besonders angewiesen wären, die sie aber nicht bekommen werden, weil sie in einem nur sehr geringem Umfang geriestert haben. Zugleich sind das dann auch noch die Menschen, die unterdurchschnittlich bis gar nicht von betrieblicher Altersvorsorge profitieren können.
Mit dem Wechsel zum „Opt-out“-Modell verbinden die drei Minister eine Menge Hoffnung:
»Andere Länder erreichen mit dem „Opt-out“ einen Verbreitungsgrad von etwa 90 Prozent. Auch in Deutschland können wir auf diesen „sanften“ Zwang nicht verzichten, wenn wir ernsthaft Altersarmut bekämpfen wollen.«
Ganz offensichtlich will man hier – Stichwort „sanfter“ Zwang – auf das durchaus umstrittene verhaltensökonomisch fundierte Instrument des „Nudging“ zurückgreifen (vgl. hierzu beispielsweise Nico Kuhlmann: Der sanfte staatliche Schubs in die „richtige“ Richtung).
»In der Deutschlandrente soll der Arbeitgeber – zusätzlich zum Pflichtbeitrag – einen Teil des Lohnes aller Beschäftigten in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Mit den Geldern der Mitarbeiter wird ein Kapitalstock für die Altersvorsorge aufbaut. Man könnte auch von einer „gesetzlichen Betriebsrente“ sprechen«, so die Formulierung von Mirco Wenig in seinem Artikel Deutschlandrente – Auf halber Strecke zwischen Norwegen und Nahles.
Norwegen? Wieso Norwegen? In dem Papier der hessischen Minister bezieht man sich explizit auf dieses Land:
»Der zentrale Rentenfonds setzt auf ein breit gestreutes Anlageportfolio, zum Beispiel mit einem höheren Aktienanteil als viele derzeitige Altersvorsorgeprodukte. Der sehr langfristige Anlagehorizont und die Möglichkeiten einer starken Streuung aufgrund der Größe des Deutschlandfonds verringern die Anlagerisiken erheblich und sorgen gleichzeitig für höhere Renditen. Die Erfahrungen von großen Staatsfonds aus anderen Ländern bestätigen dies. So kommt der norwegische Staatsfonds seit seiner Gründung im Jahr 1997 auf eine durchschnittliche Rendite von über 5 Prozent. Durch einen höheren Aktienanteil könnte gleichzeitig mehr Kapital für den Aktienmarkt und Börsengänge junger Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, um Wachstum und Innovationen zu finanzieren.«
Mit Rendite-Angaben ist das ja immer so eine Sache, deshalb muss man da vorsichtig sein. So kommt Mirco Wenig in seinem Artikel zu einer anderen Größenordnung, erläutert zugleich aber auch eine der Besonderheiten: Nach seinen Angaben hat der norwegische »Pensionsfonds Oljefondet, der zwischen 1998 und 2012 eine jährliche Rendite von durchschnittlich 3,14 Prozent (abgeworfen). Es gibt Kapital-Anlagen, mit denen man mehr Rendite erwirtschaften kann, doch der norwegische Fonds hat sich auch hohen sozialen Standards verpflichtet. Das Aufsicht führende Finanzministerium verbietet etwa Investments in Firmen, die Nuklearwaffen, Landminen oder Streubomben produzieren. Unternehmen, die schwere Umweltschäden verursachen oder Menschenrechte verletzen, können nicht auf Geld aus dem Fonds hoffen. Auch mit Lebensmitteln wird nicht spekuliert.«
Der norwegische Staatsfonds ist der größte der Welt und hat ein Volumen von deutlich mehr als 800 Milliarden Dollar, die angelegt werden (müssen). Die Mittel stammen vor allem – das wäre ein wichtiger Unterschied – aus den Öleinnahmen des kleinen Landes ( das – und die Dimensionen mal klar zu machen) mit 5 Millionen Einwohnern weniger Menschen beherbergt als der Großraum Berlin-Brandenburg).
Natürlich ist auch und gerade eine derart gewaltige Kapitalsammel- und -anlagestelle von den Verwerfungen auf den internationalen Finanzmärkten, vor allem der seit Jahren anhaltenden Niedrigstzinsphase massiv betroffen. Von daher überrascht es nicht, wenn man nicht nur teilweise erhebliche Wertminderungen verbuchen muss, sondern auch die Klage hört, man finde nicht genug rentierliche Anlagemöglichkeiten.
Ein Teil der Kritiker setzen an dieser Stelle an, beispielsweise Heiner Flassbeck in seinem Blog-Beitrag Riester-Rente gescheitert, nun ein Staatsfonds, aber immer die gleiche Konfusion. So verweist er beispielsweise au die »Frage, in welchen Papieren der Staat das Geld der Bürger anlegen soll. Alle halbwegs sichereren Fonds der Welt investieren zu einem erheblichen Teil in Staatsanleihen. Dann nimmt der deutsche Staat Geld von seinen Bürgern und gibt es an sich selbst zurück. Warum kann der Bürger dann nicht gleich Staatsanleihen kaufen, um vorzusorgen? Soll der Staat vielleicht in Aktien spekulieren? Hat man gehört, dass Beamte des Finanzministeriums besonders gut sind beim Zocken mit hoch riskanten Papieren? Oder soll unser Staat Staatsanleihen anderer Staaten aufkaufen? Das würde darauf hinauslaufen, dass Deutschland andere Staaten direkt finanziert? Das ist bisher selbst dann abgelehnt worden, wenn es um europäische Krisenstaaten ging, an deren Rettung wir selbst großes Interesse haben.« Und er legt einen weiteren grundsätzlich problematischen Aspekt nach, in dem er ausführt, »dass es derzeit auf der ganzen Welt, in Deutschland aber ganz besonders, offensichtlich schon viel zu viel Sparkapital gibt, das Anlage sucht, aber keine Schuldner findet. Was man daran leicht erkennen kann, dass sich die langfristigen Zinsen überall ganz nahe bei Null befinden, was übrigens auch den staatlichen norwegischen Fonds in arge Schwierigkeiten bringt. Deutschland hat ausweislich seiner Leistungsbilanzsalden derzeit einen Sparüberschuss von 250 Milliarden Euro jährlich (unser Leistungsbilanzüberschuss), der nur dadurch existieren kann, dass bisher andere Länder (die Staaten oder die Privaten dort) bereit waren, sich jedes Jahr neu in dieser Größenordnung zu verschulden.« Vgl. zu seiner Argumentation auch das Interview mit ihm „Dann wird der Zins noch nuller als null“.
Aber der Vorschlag der drei Minister zu den Grundlinien einer „Deutschland-Rente“ adressiert weitere, für die rentenpolitische Diskussion wichtige grundsätzliche System-Stellschrauben, an denen gedreht werden soll. So schreiben sie in ihrem Positionspapier:
»Das Standardprodukt könnte als reine Beitragszusage ausgestaltet werden („pay and forget“). Die Arbeitgeber müssten dann nicht mehr nach vielen Jahrzehnten mit Haftungsrisiken rechnen. Daneben ist es auch wichtig darüber nachzudenken, ob man betriebliche und private Altersvorsorge in der Zukunft nicht bzw. nur noch zum Teil auf die Grundsicherung im Alter anrechnet.«
Das nun wieder berührt in erheblichem Maße zwei große Baustellen, die wir in Deutschland mit Blick auf die zweite und dritte Säule haben – also zum einen die geforderte Nicht- bzw. nur Teil-Anrechnung der Einkünfte aus betrieblicher und privater Altersvorsorge im Grundsicherungssystem, denn das ist ein ganz wunder Punkt gerade für die Menschen mit geringen Einkommen, die wissen oder ahnen, dass ihnen diese Einkünfte im Alter nichts nutzen werden, sofern sie aufstockende Grundsicherungsleistungen beziehen müssen, sowie zum anderen die Attraktivitätssteigerung der betrieblichen Altersvorsorge für viele Betriebe durch den vorgeschlagenen Weg („pay and forget“). Zugleich wäre das natürlich ein massiver Wettbewerbsnachteil für die bestehenden Anbieter aus dem finanz-industriellen Komplex und für viele würde sich in diesem Bereich die Existenzfrage stellen (und dieses Geschäftsfeld erledigen). Gert G.Wagner, der Vorsitzende des Sozialbeirats der Bundesregierung, stellt genau auf diesen Punkt ab, wenn er in seiner Kommentierung „Deutschland-Rente“ und Rentenniveau schreibt:
»Pfiffig am Hessen-Vorschlag ist auch, dass er für Arbeitgeber attraktiv sein kann: Beiträge zur Deutschland-Rente könnten als reine Beitragszusage („pay and forget“) komplizierte betriebliche Vorsorgesysteme und jahrzehntelange Haftungsrisiken ersetzen.«
Vor der hier skizzierten Kulisse nicht wirklich überraschend ist der sich überall formierende Widerstand aus den Reihen der Finanzindustrie, die natürlich erkennen, dass ihnen hier möglicherweise bislang sehr ertragreiche Claims streitig gemacht werden. Dazu nur als ein Beispiel und ebenfalls nicht überraschend die heftige Ablehnung des ehemaligen IG Metall-Funktionärs, Bundesarbeitsministers und Sozialdemokrat Walter Riester – bezeichnenderweise auf einer Veranstaltung der Versicherungsgruppe „die Bayerische“ in Heidelberg: »Den jüngsten Vorschlägen einer „Deutschland-Rente“ erteilt der frühere Bundesarbeitsminister Walter Riester (SPD) eine Absage: „Das einzig Neue daran ist der Name … Die Idee selbst ist uralt und wurde bereits in der Vergangenheit als nicht praxisgerecht verworfen.“« (
Walter Riester kritisiert Deutschlandrente). Der ehemalige Minister tingelt ja seit Jahren auf der Payroll der Banken und Versicherungen durch die Lande und wirbt für die „public private partnership“ zugunsten der Finanzindustrie. Das man dort erkannt hat, dass das so lukrative Abgreifen staatlicher Zuschüssen und des Sparkapitals der Arbeitnehmer mittlerweile erheblich in Gefahr ist, weil immer mehr Menschen erkannt haben, dass es sich hier um ein sehr einseitiges Geschäftsmodell handelt, kann man auch daran erkennen, dass sich als Lobby-Versuch die Initiative „pro Riester“ (
www.proriester.de) gebildet hat.
Auch aus einer ganz anderen politischen Perspektive wird der Vorschlag heftig kritisiert, vgl. hierzu beispielhaft die Kommentierung Warum die „D-Rente“ wohl ein Rohrkrepierer wird von Nils Röper, seines Zeichens politischer Ökonom am „Department of Politics and International Relations“ der University of Oxford, der sich vor allem mit der behaupteten Bekämpfung der Altersarmut beschäftigt. Er ist da mehr als kritisch:
»Nach aktuellem Forschungsstand widersprechen die Bekämpfung von Altersarmut und kapitalgedeckte Lösungen einander. Diejenigen, die für eine zusätzliche Altersvorsorge infrage kommen, sind zumeist nicht von Altersarmut bedroht.
Gefährdete können sich hingegen eine Zusatzrente oft nicht leisten. Zudem sind sie häufig in Branchen beschäftigt, in denen Arbeitgeber voraussichtlich überproportional aus der D-Rente herausoptieren. Ähnlich wie die Riester-Rente würde die D-Rente Altersarmut kaum lindern und tendenziell Einkommensungleichheit im Alter verstärken.«
Weitaus interessanter und für die sozialpolitische Diskussion in Deutschland relevanter ist dieser Hinweis von Mirco Wenig auf eine (mögliche) Kollision mit den bislang aus dem Hause der Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) bekannt gewordenen Überlegungen über eine Reform der Betriebsrenten, die auf den ersten Blick ebenfalls in Richtung einer staatlichen Betriebsrente hinauslaufen:
»Andrea Nahles will Pensionskassen und -fonds zwischen den Tarifpartnern aushandeln lassen und bei Versorgungswerken ansiedeln. Das gibt auch den Arbeitnehmern und Gewerkschaften als klassischer SPD-Wählerklientel Verhandlungsmacht darüber, wie diese Fonds ausgestaltet sein sollen. Das Ministerium von Nahles schlägt vor, das Betriebsrenten-Gesetz um einen neuen § 17 zu erweitern, der neuartige Versorgungswerke zwischen den Tarifparteien ermöglichen soll. Es würde ein Flickenteppich verschiedener Einrichtungen entstehen, abhängig nach Branchen: etwa ein Versorgungswerk für Chemiearbeiter und eines für die Metallindustrie. Entgegen dem Nahles-Modell sieht die jetzt vorgeschlagene „Deutschlandrente“ einen großen staatlichen Topf vor, der auch zentral verwaltet würde.«
Dennoch – immerhin hat es die Idee der „Deutschland-Rente“ nun schon in den Bundestag geschafft. Also ein wenig, in Form eins Antrags der grünen Bundestagsfraktion:
„Für eine faire und transparente private Altersvorsorge und ein stabiles Drei-Säulen-System“, so ist der Antrag der Grünen (Bundestags-Drucksache 18/7371 vom 27.01.2016) überschrieben worden. In diesem Antrag wird die Bundesregierung aufgefordert, »ein einfaches und kostengünstiges Basisprodukt in Form eines Pensionsfonds als Standardweg der kapitalgedeckten Altersvorsorge einzuführen, bei dem Ein- sowie Auszahlungsweg staatlich organisiert werden und der Staat die Rahmenbedingungen für die Anlage festlegt« (S. 2).
Allerdings finde man in dem Papier auch Hinweise, dass es Handlungsbedarf in der eigentlich relevanten Säule der Alterssicherung gibt und man den nicht vergessen möchte: »Neben den in diesem Antrag geforderten Reformen zur dritten Säule ist es daher an der Zeit, neu über Beitragssatz und Rentenniveau zu diskutieren und die gesetzliche Rentenversicherung in ihrer Funktion als wesentlicher Säule zu stärken.«
Auch ansonsten dem linken Spektrum zuzurechnende Grüne können dem Projekt „Deutschland-Rente“ einiges abgewinnen. Hierzu als Beispiel die Anmerkungen des grünen Bundestagsabegordneten Wolfgang Strengmann-Kuhn auf seiner Facebook-Seite:
»Die Deutschlandrente, die von drei hessischen Ministern vorgeschlagen wird ist nur ein Teil der Lösung, aber ein richtiger und guter Vorschlag.
Richtig an der Argumentation in dem Papier ist, dass die bestehende Riesterrente gescheitert ist und auch die betriebliche Alterssicherung nicht ausreicht, um die Lücke, die die durch das absinkende Rentenniveau entsteht, zu schließen. Ein öffentlich organisiertes kapitalgedecktes Standardprodukt als Ergänzung (!) der gesetzlichen Rentenversicherung ist deswegen genau der richtige Vorschlag. Falsch an der Argumentation ist, dass es dabei um Bekämpfung der Altersarmut geht, vielmehr geht es um einen Beitrag zur Lebensstandardsicherung (!) im Alter. Altersarmut und die Basis der Lebensstandardsicherung muss staatlich – und zwar am Besten im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung – organisiert werden. Dazu sind zwei grundlegende Reformen der Rentenversicherung notwendig: erstens die Weiterentwicklung zu einer Bürgerversicherung: a) aus Gerechtigkeitsgründen und b) um die Finanzierung und damit auch das Rentenniveau zu stabilisieren und zweitens die Einführung einer Garantierente als Minimum innerhalb (!) der Rentenversicherung. Ohne diese beiden Maßnahmen wäre auch die Deutschlandrente auf Sand gebaut. Wichtig ist, dass die Deutschlandrente dabei nicht auf die Garantierente angerechnet wird, damit sich die Vorsorge tatsächlich für Alle lohnt. Auch das wird in dem Papier angesprochen: „Daneben ist es auch wichtig darüber nachzudenken, ob man betriebliche und private Altersvorsorge in der Zukunft nicht bzw. nur noch zum Teil auf die Grundsicherung im Alter anrechnet“.
Fazit: Der Dreiklang aus Bürgerversicherung für die Rente, einer Garantierente innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung und einer Deutschlandrente, die nicht auf die Garantierente angerechnet wird, als Ergänzung, ist geeignet, um unser Rentensystem insgesamt zukunftsfest zu machen.« (Quelle: https://www.facebook.com/wolfgang.strengmannkuhn/posts/538947752948965, 28.12.2015)
Die Diskussion wird weitergehen und entscheidend sind die Grundfragen einer zukünftigen Rentenpolitik, die dabei (wieder) aufgerufen werden müssen. Also welche grundsätzliche Konfiguration soll das Alterssicherungssystem insgesamt haben. Wie stark sollen die zweite und dritte Säule sein (und vor allem welche Funktion kann man von ihnen erwarten – hier ist der Hinweis von Strengen-Kuhn auf die Unterschiede zwischen Bekämpfung der Altersarmut versus Lebensstandardsicherung zutreffend)? Soll die umlagefinanzierte Säule, also die Gesetzliche Rentenversicherung wieder gestärkt werden, gerade mit Blick auf das hier erreichbare Rentenniveau und das Niveau der Renten (was unterschiedliche Tatbestände sind)? Brauchen wir den Schritt hin zu einer wirklichen Erwerbstätigenversicherung oder gar die Abkehr von der lohnbezogenen Finanzierung in Richtung auf eine wertschöpfungsbasierte Finanzierung?