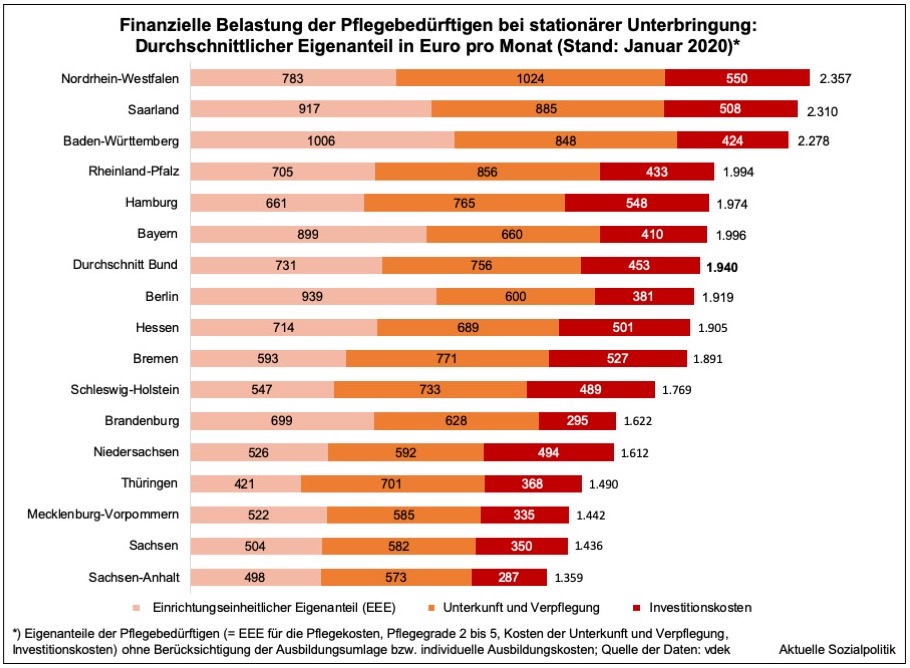Es sind schlichtweg Zahlen des Grauens: »In immer mehr Pflegeheimen kommt es zu Infektionen durch das Corona-Virus. Deutschlandweit ist es inzwischen in über 300 Heimen aufgetreten, bislang sind dadurch mindestens 226 Covid-19-Infizierte gestorben.« Das kann man der am 7. April 2020 veröffentlichten Meldung Covid-19-Infektionen in mindestens 331 Pflegeheimen entnehmen, wobei man auf das „mindestens“ achten muss: »Die Zahl der Pflegeheime, die Covid-19-Infektionen melden, steigt fast täglich. Nach Recherchen des ARD-Magazins FAKT sind bundesweit mindestens 331 Pflegeheime betroffen. Das hat eine Umfrage des Magazins bei den zuständigen Ministerien aller Bundesländer ergeben. Bayern, das Saarland und Sachsen-Anhalt machten allerdings keine Angaben.« Also drei Bundesländer sind noch gar nicht enthalten.
Solche Zahlen gehören zu der Kategorie dieser überaus vergänglichen Wasserstandsmeldungen, die schon am nächsten Tag überholt sind. Und dass es noch viel mehr Opfer der Coronavirus-Pandemie in unseren Pflegeheimen geben wird, liegt auch an den strukturellen Besonderheiten dieser Einrichtungen. Dazu bereits ausführlicher der Beitrag Aus den Untiefen der Verletzlichsten und zugleich weitgehend Schutzlos-Gelassenen: Pflegeheime und ambulante Pflegedienste inmitten der Coronavirus-Krise vom 29. März 2020. Für alle wird immer deutlicher und schmerzhafter erkennbar, dass gerade die Pflegeheime besonders betroffenen sind und sein werden von der tödlichen Seite der Pandemie.