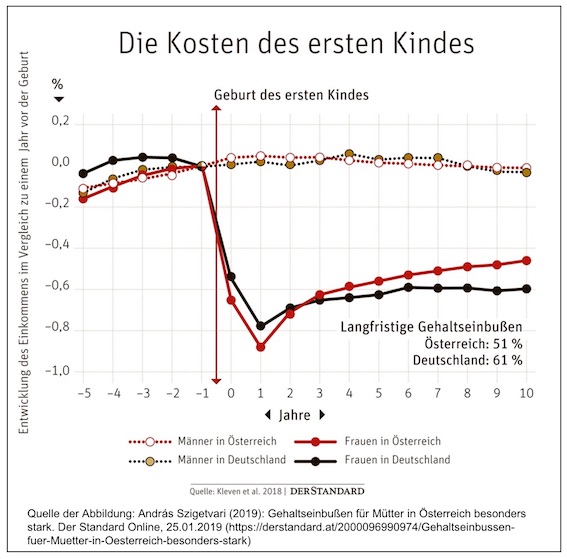Das Thema „Kita-Notstand“ füllt mittlerweile Regalmeter an Berichten. »Das System kollabiert leise, jeden Tag ein bisschen mehr. Noch läuft der Alltag, weil Erzieherinnen und Erzieher sich aufreiben, um die Lücken zu schließen. Aber in vielen Kitas reichen die Kräfte nicht mehr. Deutschlandweit meldeten Kitas den Jugendämtern im vergangenen Kita-Jahr tausendfach, dass sie die Betreuung nicht mehr gewährleisten konnten und früher oder zeitweise ganz schließen musste. Weil sie zu wenig Personal hatten«, so beginnt beispielsweise dieser Artikel, der im November 2023 veröffentlicht wurde: Kitanotstand: Wie das System versagt. Und aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen wird diese Tage berichtet: »Eine neue Studie macht Eltern keine Hoffnung – und Kita-Beschäftigten auch nicht: Im Jahr 2030 werden mindestens 16.000, im schlechteren Fall mehr als 20.000 Fachkräfte fehlen.« Dabei beziehen sich die Zahlen zu den fehlenden Fachkräften „nur“ auf die Kindertageseinrichtungen, andere Betreuungsbereiche mit Personalbedarf, wie die Ganztagsbetreuung an Grundschulen, sind hier noch gar nicht berücksichtigt, so der Artikel Dramatischer Personalmangel in NRW-Kitas bleibt für viele Jahre. Die Zahlen basieren auf einer umfassenden Studie, die Thomas Rauschenbach, der ehemalige Leiter des Deutschen Jugendinstituts (DJI) im nordrhein-westfälischen Landtag präsentiert hat. Sein ernüchterndes Fazit: „Es gibt mit Blick auf die Zukunft keine Signale: Es wird alles wieder gut.“
➔ Bereits derzeit fährt das System auf Verschleiß und die Ausfälle häufen sich – mit fatalen Folgen für die Familien (und auch für die Beschäftigten selbst): »Im Januar übermittelten nordrhein-westfälischen Einrichtungen den Landesjugendämtern über 2.700 Mal die Meldung, dass die normale Betreuung nicht zu gewährleisten sei. In der Folge gab es fast hundert Schließungen und knapp 1.400 Teil- oder Gruppenschließungen.« In einem Monat.
Dabei haben wir Jahre hinter uns, in denen es einen gewaltigen Wachstumsschub gegeben hat – sowohl bei der Zahl der Kinder in öffentlich geförderter Kindertagesbetreuung wie auch mit Blick auf das Personal in diesem Bereich.