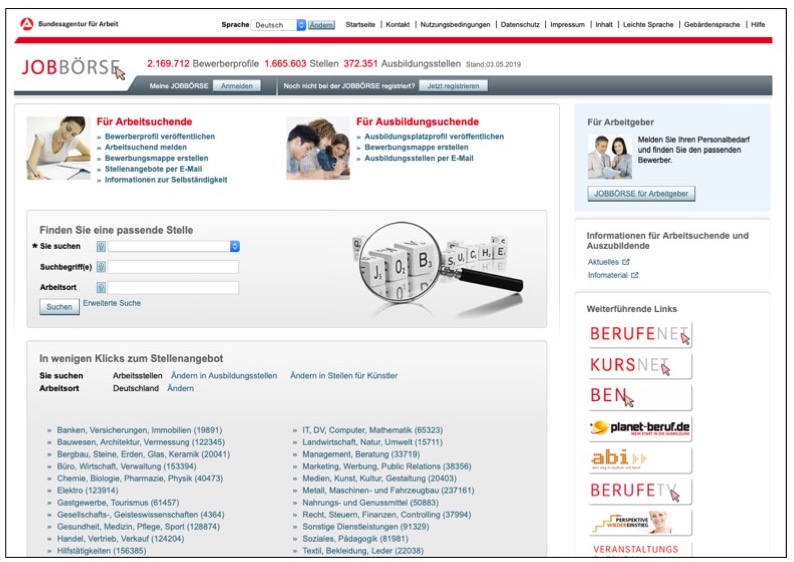Das Thema Sanktionen gegen Hartz IV-Empfänger ist ein Dauerbrenner in der Debatte über die Ausgestaltung der – eben nicht-bedingungslosen – Grundsicherung nach SGB II. Während für die einen die Sanktionierung, also der in Prozentsätzen gestufte Entzug eines Teils der Hartz IV-Leistungen oder der gesamten Geldleistungen aufgrund von Pflichtverletzungen des Leistungsbeziehers, eine notwendige Maßnahme darstellt, um die Mitwirkung des Hilfeempfängers sicherzustellen (oder eben die Nicht-Mitwirkung zu bestrafen), laufen seit Jahren Betroffene und zahlreiche Organisationen Sturm gegen die Absenkung dessen, was das „sozio-kulturelle Existenzminimum“ eines Menschen sicherstellen soll. Und schon vor Jahren ist die Grundsatzfrage, ob Sanktionen an sich gegen das Verfassungsrecht verstoßen, per anfangs zurückgewiesener, dann doch in einem erneuten Anlauf angenommener Richtervorlage seitens des Sozialgerichts Gotha dem höchsten Gericht unseres Landes, also dem Bundesverfassungsgericht, vorgelegt worden.
Das laufende Jahr wurde mit einer großen Anhörung zum Thema Sanktionen beim Bundesverfassungsgericht eröffnet: Am 15. Januar 2019 hat diese in Karlsruhe stattgefunden – mit einem umfangreichen Fragenkatalog des Gerichts (vgl. dazu Verhandlungsgliederung in Sachen „Sanktionen im SGB II“). Und seitdem ist wieder Stille eingekehrt – seit 2016 warten wir nun auf die ausstehende Entscheidung des hohen Gerichts zu dieser im wahrsten Sinne des Wortes existenziellen Frage.