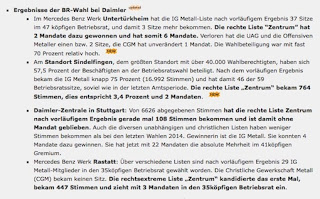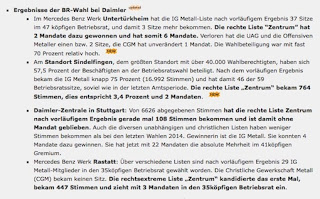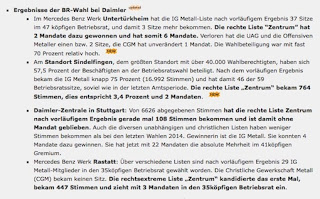
Man kann es drehen und wenden wie man will – aber es ist sicher keine Übertreibung, wenn man behauptet, wir haben es mit einem „rechtspopulistischen“ Zeitgeist zu tun. Das zeigt sich nicht nur an den europaweiten Wahlerfolgen entsprechender Parteien, zuletzt in Italien, sondern auch bei uns in Deutschland. Dazu zählt nicht nur der Aufstieg der AfD, die nunmehr sogar als Oppositionsführerin im Bundestag agieren kann, nachdem klar ist, dass die arg geschrumpfte „Große“ Koalition wiederbelebt wird. Auch in den Medien, vor allem den sogenannten „sozialen Medien“ wird man mit einer Flut an offensichtlich völlig enthemmten Kommentaren konfrontiert. Und auch wenn die Wirklichkeit wie immer komplizierter ist, ganz offensichtlich können rechtspopulistische Parteien auch – manche behaupten sogar überdurchschnittlich ausgeprägt – bei Arbeitnehmern landen, selbst bei Gewerkschaftern. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, wenn nun von rechter Seite aus versucht wird, auch in den Betriebsräten Fuß zu fassen. Und das ist nun wieder nicht isoliert zu sehen, sondern sollte eingebettet werden in einen strategischen Ansatz eines Flügels der AfD, der sich bewusst auf dem Feld der Sozialpolitik profilieren will (vgl. dazu ausführlicher den Beitrag Konturen einer rechtspopulistischen Sozialpolitik? „Soldarischer Patriotismus“ als umstrittenes Angebot innerhalb der AfD und was das mit der Rente und Betriebsräten zu tun hat vom 1. Februar 2018).
In diesem Beitrag wurde auch auf das „Zentrum Automobil“ und dessen Aktivitäten bei Daimler hingewiesen. Das ARD-Politikmagazin „Report Mainz“ berichtete am 30.01.2018 unter der Überschrift Neue Gewerkschaftsfront: Rechte wollen Macht in Betriebsräten ausbauen: »Zentrum Automobil, eine Gewerkschaft beim Autobauer Daimler, gilt als die Keimzelle einer neuen Gewerkschaftsfront von rechts. Bei den bevorstehenden Betriebsratswahlen will diese Gewerkschaft jetzt in die gesamte Automobil- und Metallbranche expandieren.«
Das Zentrum Automobil versteht sich als „alternative Arbeitnehmervertretung für Mitarbeiter in der Automobilindustrie“. Report Mainz berichtet über diesen Verein: »Seit Jahren ist das Zentrum Automobil im Daimler Stammwerk Untertürkheim mit vier Betriebsräten aktiv. Nach Recherchen … haben mehrere Vorstandsmitglieder eine rechtsextreme Vergangenheit … Auch der Chef und Gründer vom Zentrum Automobil, Oliver Hilburger, hat eine einschlägige Vergangenheit. Er war rund 20 Jahre Gitarrist der Neonazi-Kult-Band „Noie Werte“.« Über deren Aktivitäten wurde auch an anderer Stelle berichtet: Rechte wollen Einfluss im Betriebsrat ausbauen. Dort erfahren wir zum Zentrum Automobil: »Erklärter Hauptfeind: die IG Metall. Deren „linke Vorherrschaft“ soll beendet werden. Unterstützung kommt von der neuen Rechten, die sich seit den Erfolgen der AfD im Aufwind fühlt.«
Über deren Aktivitäten und darüber hinaus über die Herausforderungen für die etablierten Gewerkschaften hat der Soziologe Klaus Dörre geforscht und mehrfach Stellung bezogen, zuletzt in einem Interview, das die Frankfurter Rundschau veröffentlicht hat: „Völkische Ideologie ist ein Sprengsatz für Solidarität“: »Der Soziologe Klaus Dörre spricht im Interview über rechte Betriebsräte, die Frustration bei Arbeitern und die Antwort der AfD auf die soziale Frage.«
Nun haben die Betriebsratswahlen stattgefunden und es ist natürlich vor diesem Hintergrund von großem Interesse zu erfahren, wie denn das „Zentrum Automobil“ abgeschnitten hat – was man nicht nur im Kontext zahlreicher kritischer Medienberichte vor den Wahlen sehen muss, sondern auch angesichts solcher expliziter Distanzierungen: Erklärung des Betriebsrates Werk Untertürkheim und Entwicklung Pkw vom 20. Februar 2018: »Der Betriebsrat distanziert sich strikt von allem rechtsradikalen und neonazistischen Gedankengut und den Aktivitäten einzelner Mitglieder«.
Erste vorläufige Ergebnisse wurden unter der Überschrift Ergebnisse der BR-Wahl bei Daimler von LabourNet Germany veröffentlicht (siehe dazu auch die Abbildung am Anfang dieses Beitrags). Dort wird gemeldet, dass das „Zentrum Automobil“ an einigen Standorten sogar zulegen konnte:
- Im Mercedes Benz Werk Untertürkheim hat die IG Metall-Liste nach vorläufigem Ergebnis 37 Sitze im 47 köpfigen Betriebsrat, und damit 3 Sitze mehr bekommen. Die rechte Liste “Zentrum” hat 2 Mandate dazu gewonnen und hat somit 6 Mandate.
- Am Standort Sindelfingen, dem größten Standort mit über 40.000 Wahlberechtigten, haben sich 57,5 Prozent der Beschäftigten an der Betriebsratswahl beteiligt. Nach dem vorläufigen Ergebnis bekam die IG Metall knapp 75 Prozent (16.992 Stimmen) und hat damit 46 der 59 Betriebsratssitze, soviel wie in der letzten Amtsperiode. Die rechte Liste „Zentrum“ bekam 764 Stimmen, dies entspricht 3,4 Prozent und 2 Mandaten.
- Mercedes Benz Werk Rastatt: Über verschiedene Listen sind nach vorläufigem Ergebnis 29 IG Metall-Mitglieder in den 35köpfigen Betriebsrat gewählt worden. Die Christliche Gewerkschaft Metall (CGM) bekam keinen Sitz. Die rechtsextreme Liste „Zentrum“ kandidierte das erste Mal, bekam 447 Stimmen und zieht mit 3 Mandaten in den 35köpfigen Betriebsrat ein.
- Die einzige Ausnahme: Daimler-Zentrale in Stuttgart: Von 6626 abgegebenen Stimmen hat die rechte Liste Zentrum nach vorläufigem Ergebnis gerade mal 108 Stimmen bekommen und ist damit ohne Mandat geblieben.
Natürlich kann man jetzt argumentieren, dass das mehr als überschaubare Zahlen sind angesichts der Gesamtheit der Betriebsräte. Auf der anderen Seite muss man zur Kenntnis nehmen, dass das rechte „Zentrum Automobil“ einige Sitze dazu gewonnen hat. Das sollte einem mehr als zu denken geben.
Abbildung: Ergebnisse der BR-Wahl bei Daimler, Abruf am 06.03.2018