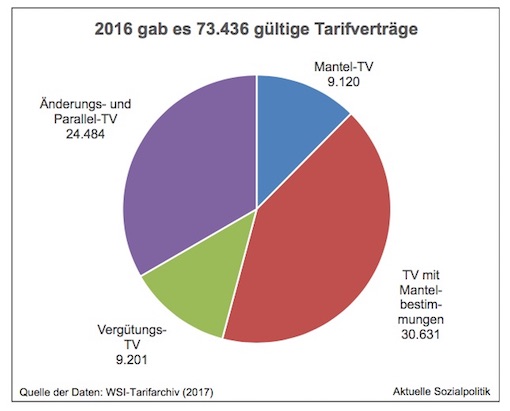Man sollte ja meinen, dass es ganz einfach ist: Wenn Arbeitnehmer unter einem Tarifvertrag arbeiten (können und dürfen), dann stellen sie sich besser, als wenn es keinen Tarifvertrag gibt. Denn Tarifverträge sollen die Situation der Arbeitnehmer verbessern – höhere Löhne, bessere Rahmenbedingungen des Arbeitens im Verglich zu denen, bei denen der Arbeitgeber frei schalten und walten kann.
Und für die Beschäftigten, die keiner Tarifbindung unterliegen, gelten dann nur bzw. wenigstens die vom Gesetzgeber formulierten Schutzbestimmungen, beispielsweise die Regelungen im Arbeitszeitgesetz oder im Teilzeit- und Befristungsgesetz.
Im Arbeitsrecht gilt (eigentlich) das „Günstigkeitsprinzip“. Dahinter verbirgt sich eine an sich nachvollziehbare Hierarchie der Rechtsquellen: Höherwertige Arbeitsrechtsquellen haben in aller Regel Vorrang vor nachgeordneten Bestimmungen. So darf ein Bundesgesetz nicht gegen das Grundgesetz verstoßen, Tarifverträge dürfen nicht gesetzliche Bestimmungen, Betriebsvereinbarungen nicht Regelungen aus Tarifverträgen verletzen. Aber jetzt kommt der hier relevante Einschub: Vereinbarungen in einem Arbeitsvertrag dürfen nicht zu Lasten der Arbeitnehmer von einer höherwertigen Rechtsnorm abweichen, es sei denn, die höherrangigere Norm lässt eine ungünstigere Regelung ausdrücklich zu.
Wenn man das weiß, dann wird der folgende Beitrag des Politikmagazins „Kontraste“ (ARD) vom 31.08.2017 schon etwas verständlicher: Tarifverträge hebeln gesetzliche Schutzbestimmungen aus. Und zwar zuungunsten der Arbeitnehmer, was sicher viele erst einmal mehr als überraschen wird. Und schon die Anmoderation des Beitrags legt den Finger auf eine Wunde, die man mit dem technischen Begriff von den „tarifdispositiven Regelungen“ verbinden muss:
»Lange galt als sicher: Wer nach Tarif bezahlt wird, der bekommt eine gut gefüllte Lohntüte mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld – anders als in den Unternehmen, die sich dem Tarif verweigern! Doch der gute alte Tarifvertrag wird plötzlich von Arbeitgebern dazu genutzt, um gesetzliche Mindeststandards zum Schutz der Arbeitnehmer zu unterlaufen. Und die Gewerkschaften? Sie machen dabei sogar mit.«
Wie kann das sein, wird der eine oder andere völlig berechtigt fragen. Dazu müssen wir uns beschäftigen mit dem Instrument der „tarifdispositiven Regelungen“. Dazu haben die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages Anfang 2017 eine Ausarbeitung vorgelegt: Tarifdispositives Arbeitsrecht. Ausgewählte Beispiele. Darin findet man diesen Hinweis: »In einigen Fällen enthalten Arbeitnehmerschutzbestimmungen jedoch in unterschiedlichem Umfang Öffnungsklauseln für abweichende tarifvertragliche Regelungen.« Und es folgt der Versuch einer Legitimation dieser für den Arbeitnehmer überraschenden Abweichung nach unten (und eben nicht „nach oben“, wie man es von Tarifverträgen normalerweise annehmen würde):
»Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass zwar der einzelne Arbeitnehmer aufgrund seiner sozialen Unterlegenheit des gesetzlichen Schutzes bedarf, Tarifverträge aber zwischen den beiden gleichstarken Sozialpartnern ausgehandelt werden, die den hinreichenden Schutz des Arbeitnehmers gewährleisten können. Das tarifdispositive Gesetzesrecht soll es den Tarifpartnern ermöglichen, für einen bestimmten Wirtschaftszweig einen vom Gesetz abweichenden sachgemäßen Interessenausgleich zu schaffen.«
Und schon sind wir mittendrin in der Grundsatzfrage, ob man dieser Annahme auch wirklich folgen kann (und darf). Ist es wirklich so, dass wir es mit „gleichstarken Sozialpartnern“ zu tun haben, die auf Augenhöhe miteinander verhandeln und sich einigen? Dazu gleich mehr.
Aber illustrieren wir erst einmal, was man sich praktisch unter dem Terminus „tarifdispositive Regelungen“ vorstellen muss. Wo tauchen die in der Realität überhaupt auf. Dazu einige ausgewählte Beispiele:
Nehmen wir eine Beschäftigungsform, die völlig zu Recht mehr als kritisch gesehen und diskutiert wird, die sich aber einer wachsenden Beliebtheit in bestimmten Branchen erfreut, vor allem im Einzelhandel, in dem Millionen Arbeitnehmern, darunter vor allem Frauen beschäftigt sind: Arbeit auf Abruf. Vgl. dazu bereits den Beitrag Kapo – was? Der DGB nimmt mit der Arbeit auf Abruf das Schmuddelkind der Arbeitszeitflexibilisierung ins Visier vom 26. September 2016.
Wir reden hier nicht über ein Orchideenthema. Nach einer Untersuchung des DGB sind bis zu 1,9 Millionen Arbeitnehmer betroffen. Nicht nur im Einzelhandel. In der Gastronomie arbeiten mindestens zwölf Prozent der Beschäftigten auf Abruf.
Auch für diese Beschäftigungsform gibt es eine gesetzliche Regelung: Arbeit auf Abruf ist in § 12 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) geregelt und liegt vor, wenn Beschäftigte ihre Arbeitsleistung entsprechend des betrieblichen Arbeitsanfalls – also nach Bedarf – zu erbringen haben. Der Arbeitgeber kann kurzfristig die Lage und teilweise auch das Volumen der von dem/der Beschäftigten zu erbringenden wöchentlichen Arbeitsleistung festlegen. Der bzw. die Beschäftigte in Arbeit auf Abruf ist immer nur dann zur Arbeitsleistung verpflichtet, wenn der Arbeitseinsatz mindestens vier Tage im Voraus angekündigt wird. Und auch der Umfang der Mindestarbeitszeit pro Woche ist hier normiert: „Wenn die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, gilt eine Arbeitszeit von zehn Stunden als vereinbart.“
Zusammenfassend: Es müssen mindestens 10 Stunden pro Woche sein und die Betroffenen müssen mindestens vier Tage vorher informiert werden, wann sie wie viel arbeiten sollen. Das sind die beiden untersten Schutzlinien, die das Gesetz normiert – und die sind wahrlich nicht üppig.
Man muss aber weiterlesen: Im Absatz 3 des § 12 findet man dann diese Unterlaufensregelung:
»Durch Tarifvertrag kann von den Absätzen 1 und 2 auch zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden, wenn der Tarifvertrag Regelungen über die tägliche und wöchentliche Arbeitszeit und die Vorankündigungsfrist vorsieht. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen Regelungen über die Arbeit auf Abruf vereinbaren.«
Das muss man sich mal vorstellen: Die sowieso nicht üppigen Schutzvorschriften für die Arbeitnehmer können durch tarifvertragliche Regelungen – die ja eigentlich einer Besserstellung der Arbeitnehmer zu dienen haben – noch unterlaufen werden. Und gleichsam als Krönung gibt es dann die Option für nicht-tarifvertraglich organisierte Arbeitgeber (und Arbeitnehmer) in diesem Fall einer schlechteren Regelung für die Arbeitnehmer als im Gesetz sich auf den Tarifvertrag, den man ja ansonsten nicht befolgen will, zu beziehen, um davon auch profitieren zu können.
Und Ausnahmen von der an sich ja nicht zu unterschreitenden Lohnuntergrenze wurden im Mindestlohngesetz (MiLoG) gerade dann zugelassen, wenn dieses Unterschreiten tarifvertraglich vereinbart war. Dazu die Wissenschaftliche Dienste in ihrer Ausarbeitung:So enthält § 24 Abs. 1 Satz 1 des im Rahmen des Tarifautonomiestärkungsgesetzes vom 11. August 2014 eingeführten Mindestlohngesetzes (MiLoG) eine Übergangsregelung, wonach vom gesetzlichen Mindestlohn abweichende Regelungen eines Tarifvertrages repräsentativer Tarifvertragsparteien bis zum 31. Dezember 2017 in Kraft bleiben, sofern ab 1. Januar 2017 ein Mindestentgelt von 8,50 Euro nicht unterschritten wird. Nach der Gesetzesbegründung soll „sachnahen und für die Branche repräsentativen Tarifpartnern damit die Möglichkeit eingeräumt [werden], für ihre Branche eine abweichende Mindestlohnhöhe zu bestimmen und so der spezifischen Ertragskraft der Unternehmen in ihrer Branche Rechnung zu tragen.“
Auch in diesem Passus wird erneut der strategische Ansatz der tarifdispositiven Regelungen offenbar, denn es geht um eine Besserstellung von Unternehmen einer bestimmten Branche durch eine (temporäre oder dauerhafte) Schlechterstellung der Arbeitnehmer dieser Unternehmen.
Man hat also mit dieser Regelung ermöglicht, dass in bestimmten Branchen – auf tarifvertraglicher Basis! – auch nach dem 1. Januar 2015 ein Lohn gezahlt werden kann, der unter der eigentlichen Lohnuntergrenze von 8,50 Euro lag – wenn ab dem 1. Januar 2017 die 8,50 Euro erreicht werden. Aber man muss immer Obacht geben bei den Formulierungen in den Gesetzen – denn da steht ja: „… sofern ab 1. Januar 2017 ein Mindestentgelt von 8,50 Euro nicht unterschritten wird.“ Nun haben wir aber zwischenzeitlich eine Anhebung auf 8,84 Euro pro Stunde beim gesetzlichen Mindestlohn, die zitierte Formulierung verlangt aber eben nicht, dass die nunmehr erfolgte Anpassung auch mitvollzogen werden muss. Das führt dann zu so einem Beispiel:
Die Gewerkschaft Nahrung – Genuss – Gaststätten (NGG) veröffentlichte am 30.08.2017 diese aufschlussreiche Pressemitteilung: „Fleischwirtschaft muss endlich raus aus den Negativschlagzeilen“. Tarifverhandlungen über „Fleisch-Mindestlohn“. Die Gewerkschaft appelliert an die Arbeitgeber der Fleischwirtschaft, »noch in diesem Jahr einen neuen, zukunftsweisenden Tarifvertrag abzuschließen, der den am 31. Dezember 2017 auslaufenden Mindestlohn-Tarifvertrag nahtlos ablöst.«
Man muss wissen: In der deutschen Fleischwirtschaft arbeiten rund 165.000 Beschäftigte. Für die Fleischwirtschaft gilt bereits seit Juli 2014 ein deutschlandweiter Branchenmindestlohn, der seitdem in mehreren Stufen erhöht wurde und aktuell bei 8,75 Euro pro Stunde liegt. Er gilt für alle Beschäftigten der Branche – auch für ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Auftrag von Subunternehmen in den deutschen Betrieben arbeiten. Man muss das so lesen: Für diese nun wirklich mehr als harte Arbeit wird derzeit – im August 2017 – mit 8,75 Euro pro Stunde weniger gezahlt als der gesetzliche Mindestlohn von 8,84 Euro eigentlich vorsieht.
Und weiter geht es mit den Beispielen. Werfen wir einen Blick auf das so wichtige Arbeitszeitgesetz. Dort sind beispielsweise tägliche und wöchentliche Höchstarbeitszeiten normiert und die dem Arbeitnehmer zu gewährenden Ruhezeiten zwischen Arbeitseinsätzen. Aber auch hier werden wir mit „tarifdispositiven Regelungen“ konfrontiert:
»Tarifvertragliche Abweichungen vom gesetzlichen Arbeitszeitrecht sind nach §§ 7 und 12 des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) zulässig.«
Davon hat man durchaus umfänglich Gebrauch gemacht, in Form von Verlängerungen der täglichen Arbeitszeit über 10 Stunden hinaus bei Bereitschaftszeit/Arbeitsbereitschaft, durch flexible Regelungen von Ausgleichs- und Ruhezeiten und der Ausdehnung der Arbeit an Sonn- und Feiertagen.
Und dann das nicht nur aktuell höchst relevante, sondern mit einer grundsätzlich fragwürdigen Bedeutung versehene Beispiel der Leiharbeit, die im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) verankert ist. Hier wurde die massive Deregulierung der Leiharbeit 2003 im Kontext der Hartz-Gesetze durch den damaligen Arbeits- und Wirtschaftsminister Wolfgang Clement verbunden mit einer Art „Tarifzwang“ für die Branche, denn:
Es geht um die Regelungen in den §§ 3 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 und 9 Nr. 2 Halbsatz 2 AÜG, wonach ein Tarifvertrag von dem Grundsatz der Gleichbehandlung in der Leiharbeit abweichen kann. Anders formuliert: Eigentlich müssten die Leiharbeiter die gleiche Entlohnung bekommen wie die Stammbeschäftigten in den entleihenden Unternehmen (Grundsatz des „equal pay“). Man kann sie aber (teilweise deutlich) schlechter bezahlen, wenn es einen Tarifvertrag gibt, der das vorsieht. Und den bzw. die gibt es.
Und aktuell kann man gerade im Bereich der Leiharbeit studieren, welche fragwürdigen Ausformungen die „tarifdispositiven Regelungen“ annehmen können. Zum 1. April 2017 wurden einige Regelungen im AÜG eigentlich und scheinbar verschärft im Sinne einer Verstärkung der Schutzfunktion für die Leiharbeiter. So wurde festgelegt, dass ein Leiharbeiter maximal 18 Monate lang an denselben Betrieb ausgeliehen werden darf.
Man ahnt schon, was jetzt kommt: Es sind jedoch Ausnahmen möglich, wenn Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften abweichende Vereinbarungen treffen.
Und genau das ist zwischenzeitlich auch passiert – und zwar erneut zuungunsten der Arbeitnehmer, in diesem Fall der Leiharbeiter. Und dann auch noch von der nach außen immer so stark auftretenden IG Metall. Dazu ausführlich der Beitrag Wenn die Leiharbeiter in der Leiharbeit per Tarifvertrag eingemauert werden und ein schlechtes Gesetz mit gewerkschaftlicher Hilfe noch schlechter wird vom 19. April 2017. Dort wurde eine tarifvertragliche Regelung mit den Arbeitgebern vereinbart, mit folgendem Ergebnis: In der Metall- und Elektroindustrie können Leiharbeiter künftig bis zu 48 Monate in einem Betrieb beschäftigt werden – statt 18 Monaten, wie es das seit 1. April in Kraft getretene Gesetz vorsieht. Und sogar darüber hinaus öffnen sich die Tore für die Arbeitgeber, denn: Wenn Sachgründe vorliegen, etwa in Form konkreter Projekte, so solle – auf freiwilliger Basis – eine über 48 Monate hinausgehende Verleihdauer möglich sein.
Verkehrte Welt? Wie kann das alles sein? Da begrenzt ein Gesetz die für Leiharbeiter zulässige Überlassungshöchstdauer auf 18 Monate und die Gewerkschaft schließt mit den Arbeitgebern einen Tarifvertrag, der diese Höchstdauer nicht etwa nach unten begrenzt, sondern sie erheblich verlängert? Warum macht die IG Metall so etwas mit?
Hier bewegen wir uns als Beobachter natürlich auf einer spekulativen Ebene, aber eine durchaus plausible Vermutung könnte so lauten: Die IG Metall ist wie jede Gewerkschaft eine Mitgliedsorganisation, aber nicht alle Mitglieder sind gleich. Neben dem normalen Mitglied gibt es die Funktionäre, die Gewerkschaftsführung und eben auch besonders einflussreiche Mitglieder, die eine wesentlich größere Bedeutung haben als die normalen Mitglieder. Dazu gehören sicherlich die Betriebsräte der großen Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie, in denen die Industriegewerkschaft quantitativ und qualitativ verankert ist. Und bei den Betriebsräten beispielsweise der deutschen Automobilhersteller ist klar, dass deren Unternehmen die Leiharbeiter als flexible Randbelegschaft fest eingeplant haben, dass sie nicht auf sie verzichten wollen und werden, wenn man sie dazu nicht zwingt. Und das – hier wird es heikel – die schlechteren Bedingungen, unter denen die Leiharbeiter arbeiten müssen, gleichsam eingepreist sind in den wesentlich besseren Bedingungen der Stammbelegschaft, die also von der Randbelegschaft gleichsam „profitiert“.
Keine Spekulation hingegen ist ein weiterer „Hammer“, den man hinsichtlich der gesetzgeberischen Ausgestaltungen der „tarifdispositiven Regelungen“ (nicht nur) am Beispiel der Leiharbeit hervorheben muss.
Zuvor aber soll ausdrücklich darauf hingewiesen werden, wie die sozialdemokratische Bundesarbeitsministerin Andres Nahles ihre Präferenz für diese Öffnungsklausel von gesetzgeberischen Regelungen über tarifvertragliche Vereinbarungen zu begründen versucht: Sie will damit das Tarivertragssystem (wieder) stärken. Sie will die Unternehmen davon überzeugen, wieder stärker in die Tarifbindung zurückzukehren, denn dann profitieren sie ja von der Flexibilität, die ihnen durch die Öffnungsklauseln ermöglicht werden.
Nun muss man kein Held der Logik sein um sofort zu erkennen, wie voraussetzungsvoll ein solches Unterfangen ist. Offensichtlich einleuchtend ist dieser Punkt: Wenn das funktionieren soll, dann muss es sich um eine tarifexklusive Regelung handeln, also die Arbeitgeber dürfen nur dann davon profitieren (können), wenn sie sich auf die Tarifbindung (wieder) einlassen.
Und wie sieht das bei der Leiharbeit aus? Hier haben im AÜG neu eine Obergrenze von 18 Monaten und eine (+ x)-Öffnungsklausel, wenn die tarifvertraglich gestaltet wird. Damit gibt es im Fall der tarifvertraglichen Regelung nach oben keine definierte Grenze bei der Überlassungsdauer und wir haben gerade am Beispiel der IG Metall gesehen, wie man das dann konkret umsetzt. Aber es kommt noch „besser“: Diese Option gilt nicht nur für tarifgebundene Unternehmen auf der Entleiher-Seite, denn: Im Geltungsbereich eines Tarifvertrages der Einsatzbranche können auch nicht tarifgebundene Entleiher von der Höchstüberlassungsdauer abweichende tarifvertragliche Regelungen durch Betriebs- oder Dienstvereinbarungen übernehmen. Sie werden dann zwar auf maximal 24 Monate begrenzt – aber auch sie können von der eigentlichen maximalen Entleihet von 18 Monate noch weitere 6 Monate abweichen, in dem sie sich in diesem einen Punkt auf die tarifvertragliche Öffnungsklausel beziehen, ohne deshalb die anderen Bestandteile der tariflichen Regelwerks übernehmen zu müssen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt.
Fazit: Das Ziel einer Stärkung der Tarifparteien (das hebt die Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) immer so hervor) wird erkennbar, zugleich aber hinten rum wieder ausgehebelt. Die zitierte Öffnungsklausel konterkariert im Ergebnis die Besserstellungsabsicht der Tarifebene, da den nicht-tarifgebundenen Unternehmen ein weitgehend gleicher Vorteil ermöglicht wird, so dass mehr als begründungsbedürftig ist, wo hier eine anvisierte Stärkung der Tarifbindung angereizt werden soll. Eher das Gegenteil ist der Fall.
Und abschließend nur noch der Hinweis auf den nächsten Hammer aus diesem Gemurkse mit den „tarifdispositiven Regelungen“, mit denen angeblich die Tarifbindung wieder gestärkt werden soll. Auch im gerade verabschiedeten Betriebsrentenstärkungsgesetz finden wir den Ansatz. Dazu ausführlich der Beitrag Die halbierte Betriebsrentenreform, eine „kommunikative Herausforderung“ gegenüber den Arbeitnehmern und das von vielen totgesagte Pferd Riester wird erneut gedopt vom 3. Juni 2017.
Ein Kernbestandteil der Betriebsrentenreform von Nahles & Co. ist die verschleiernd „Zielrente“ im „Sozialpartnermodell“ genannte Variante einer im Ergebnis „entkernten“ Betriebsrente:
Der Arbeitgeber muss seinen Beschäftigten damit nicht mehr eine bestimmte Rentenhöhe zusagen, sondern nur sicherstellen, dass die Sparbeiträge ordnungsgemäß zurückgelegt und verwaltet werden. Die gerade in der Niedrigzinsphase oft drückenden Kapitalmarkt- und Haftungsrisiken sind die Unternehmen im Modell der Zielrente los. Eingeführt wird also die Möglichkeit einer reinen Beitragszusage ohne weitere Verpflichtungen – für die Arbeitgeber besonders attraktiv, folgt das doch dem Modell „pay and forget“. Gerade durch die Enthaftung erhöht man ohne Zweifel die Anreize für die Unternehmen.
Die Bundesarbeitsministerin Nahles jubelt und hebt hervor, dass es diesen für manchen Arbeitgeber sicher attraktiven Weg nur im „Sozialpartnermodell“ geben kann. Das ist Stärkung der Tarifparteien. Auch hier aber lohnt sich ein genauerer Blick auf die teuflischen Details:
Ursprünglich sollten die Tarifparteien branchenweite Fonds für die Verwaltung der Beiträge einführen; dazu wäre es nötig geworden, ihre Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären, also auch jenen Betrieben vorzuschreiben, die nicht im Arbeitgeberverband sind. Das wäre durchaus eine Art „trojanisches Pferd“ für ein anderes Ziel, die Stärkung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen zu befördern. Man kann sich vorstellen, dass die Arbeitgeber davon not amused waren und dieser Zahn wurde dann auch gezogen. Und was haben wir bekommen?
Voraussetzung für die Zielrente ist ein Tarifvertrag, der von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände in den einzelnen Branchen abgeschlossen werden muss. Nicht-tarifgebundene Betriebe sollen sich den Zielrenten-Vereinbarungen der Tarifparteien und deren Versorgungskassen anschließen dürfen. Auch deren Beschäftigte hätten dann Aussicht auf eine Zielrente. Und aus der inneren Systemlogik haben die Tarifparteien sogar ein Interesse daran, die „Trittbrettfahrer“ mit aufzunehmen – weil hohe Teilnehmerzahlen und große Anlagetöpfe Vorteile bei der Kapitalanlage bringen. Nur als sicher von vielen, die bis hierhin durchgehalten haben, auch erwartete Fußnote: die nicht tarifgebundenen Unternehmen müssen alle anderen Teile der Tarifverträge „natürlich“ nicht übernehmen.
Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages kommen in ihrer Ausarbeitung vom Januar 2017 zu dieser Feststellung (vgl. ergänzend dazu die am 15. Juni 2017 veröffentlichte Ausarbeitung Tarifdispositives Arbeitsrecht in der juristischen Diskussion):
»Von Tarifverträgen werden nach § 3 des Tarifvertragsgesetzes grundsätzlich nur die tarifgebundenen Parteien erfasst. Charakteristisch für die aufgeführten tarifdispositiven Regelungen ist es jedoch, dass sie im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages in der Regel auch nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ausdrücklich die Möglichkeit eröffnen, die Anwendung der tarifvertraglichen Regelungen individualvertraglich zu vereinbaren, um eine Vereinheitlichung der Arbeitsvertragsbedingungen zu ermöglichen.«
Das muss alles vor dem Hintergrund der Tatsache gesehen werden – und damit sind wie wieder am Anfang des Beitrags -, dass man eben nicht von „gleichstarken Tarifparteien“ ausgehen kann. Selbst nicht bei scheinbar so starken Gewerkschaften wie der IG Metall, denn auch dort haben die Arbeitgeber eine Menge Folterwerkzeuge im Koffer, um die Gewerkschaft und vor allem die eigenen Betriebsräte auf die „richtige Schiene“ zu setzen. Bei diesem Thema hier ist das besonders kritisch zu sehen, denn es geht hier ja darum, dass gesetzliche Schutzbestimmungen (die für alle gelten sollen) im Sinne einer Abweichung nach unten über das Instrument des Tarifvertrags ausgehebelt werden.
Im politischen Raum haben nur wenige das Thema aufgegriffen. Ein Beispiel wäre das von der Bundestagsabgeordneten der Linken, Jutta Krellmann, verfasste Positionspapier Schlechter mit Tarifvertrag? Wie die Bundesregierung die Tarifpolitik auf den Kopf stellt und Gewerkschaften systematisch schwächt vom 30. Mai 2017. Darin wird auch auf die „Nutznießer“ dieser Entwicklungen hingewiesen: Für die Regierenden hat diese Strategie unzweifelhaft Vorteile: »Strittige Themen und Regelungen werden einfach an die Tarifvertragsparteien, die betrieblichen Akteure oder sogar an einzelne Beschäftigte zur Verhandlung weitergereicht.« Und zu den Gefahren kann man dem Papier entnehmen:
»Durch tarifdispositive Regelungen verschiebt sich der politische Diskurs argumentativ in Richtung Arbeitgeber. Interessenvertretungen der Beschäftigten nehmen von vornherein eine defensive Rolle ein, wenn es erst einmal darum geht, die scheinbar legitime, weil per Gesetz erlaubte, Verschlechterung zu verhindern. Dann geht der Kampf darum, die gesetzlichen Mindeststandards zu halten. Von Verbesserungen ist erst gar nicht mehr die Rede. Zudem müssen Gewerkschaften immer mehr Aspekte in Tarifverhandlungen regeln. Damit wird ihre Kampfkraft und Verhandlungsbasis für Lohnerhöhungen und Arbeitszeitverkürzung geschwächt.«
Auch aus dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) in der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung kommen kritische Anmerkungen. So findet man beispielsweise in den Folien zu einem Vortrag von Thorsten Schulten (Ansätze zur Stärkung der Tarifbindung am 16. Juni 2016) diese skeptische Bilanzierung der Frage, ob man durch tarifdispositive Regelungen eine Stärkung der Tarifbindung (von oben) erreichen kann:
Er sieht das Grunddilemma tarifdispositiver Regelungen, also die Verschlechterung gesetzlicher Standards durch Tarifverträge und konstatiert für die bisher existierenden tarifdispositiven Regelungen nur „begrenzte Effekte“. Mit Blick auf internationale Erfahrungen, beispielsweise aus unserem Nachbarland Österreich, kommt er zu dem Befund: Eine Förderung des Arbeitgeberinteresse an Tarifverträgen erreicht man nur bei sehr weitreichenden gesetzlichen Regelungen (nach unten).
Sein Fazit: »Tarifdispositive können nur sehr bescheidenen Beitrag zur Stärkung der Tarifbindung leisten.«
Das könnte man noch deutlicher ausdrücken. Angesichts der eben nicht gegebenen „gleichen Augenhöhe“ zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern (vgl. zu dazu beispielsweise Wie viel Macht haben Gewerkschaften noch?) ist dieser Weg ein ganz gefährliches Abenteuer, bei dem die meisten Gewerkschaften auf einer Rutschbahn nach unten landen werden müssen.