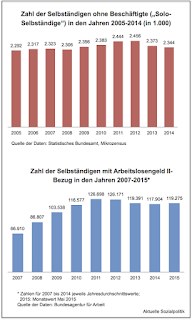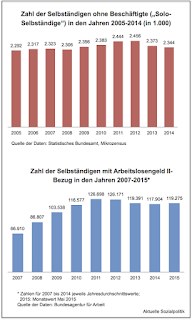»Ursprünglich war einmal geplant, dass sich 80 Prozent der Beschäftigten in den mehr als 400 Jobcentern darum kümmern sollten, Arbeitslose zu fördern und zu vermitteln. Derzeit gilt dies aber nur für knapp die Hälfte der Mitarbeiter. Die anderen sind mit der Berechnung von Leistungen beschäftigt«, so Thomas Öchsner in seinem Artikel Grüne pochen auf weniger Regeln für Hartz IV. Man muss an dieser Stelle an den – eigentlich – fundamentalen Paradigmenwechsel erinnern, der im Gefolge der Hartz-Gesetze mit der Einführung der Grundsicherung (SGB II) im Jahr 2005 vollzogen werden sollte: Die beiden – unterschiedlichen Logiken folgenden – bedürftigkeitsabhängigen Leistungssysteme Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe wurden zusammengelegt mit dem Versprechen, dass mit der Einführung eines pauschalierten Regelsatzes, derzeit 399 Euro pro Monat für eine alleinstehende Person, eine enorme Verwaltungsvereinfachung einhergehen werde, da man nunmehr auf komplizierte einzelfallbezogene Berechnungen der Leistungen verzichten könne und auch ein Großteil der bis dahin in der Sozialhilfe auf Antrag gewährten einmaligen Leistungen für bestimmte Lebenstatbestände wurde gestrichen und mit dem neuen Regelsatz verrechnet. Aber wie so oft im Leben – was sich auf dem Papier so plausibel darstellen lässt, stößt in der wirklichen Wirklichkeit auf zahlreiche unterschiedliche Fallkonstellationen, deren zumindestens teilweise Berücksichtigung einen Teil der Verwaltungsvereinfachung sofort wieder außer Kraft setzt. Viele Details mussten geregelt werden, die nicht im pauschalierten Regelsatz enthalten waren bzw. sind.
Auch die Rechtsprechung hat im Laufe der Jahre dazu beigetragen, dass das grundsätzliche und nicht auflösbare Spannungsverhältnis zwischen Einzelfallgerechtigkeit auf der einen und den Effizienzvorteilen eines pauschalierende Leistungssystems auf der anderen Seite immer wieder zu Gunsten der Berücksichtigung des Einzelfalls im Ergebnis das System verkompliziert hat. Wenn man ehrlich is, muss man zu dem ernüchternden Ergebnis kommen, dass wir mittlerweile in einer Harz IV-Welt angekommen sind, in der letztendlich alle Beteiligten massiv unzufrieden sind. Viele Betroffene deshalb, weil eben nur ein wenig Einzelfallgerechtigkeit berücksichtigt wird, ansonsten ein Verweis auf die Regelsatzleistung erfolgt. Und die andere Seite ist gezwungen, beispielsweise durch Anrechnungsregelungen immer umfassendere Nachweise von den Leistungsempfängern einzufordern und dann zu prüfen, was davon für die Grundsicherungsleistung relevant ist oder nicht. Hinzu kommt, dass sich natürlich viele Anrechnungstatbestände permanent verändern.
Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass die durchschnittliche Akte eines der 3,4 Millionen Hartz-IV-Haushalte einen Umfang von etwa 650 Seiten hat. Öchsner nennt scheinbar skurrile Fragen, die geregelt werden müssen und natürlich zu entsprechendem Aufwand bei Klärung und Bescheidung führen: »Dabei kann es um Extras wie orthopädische Schuhe, das Warmwasser aus einem Boiler oder gar um die Frage gehen, wie viel Kleister einem Hartz-IV-Empfänger fürs Tapezieren der Wände zusteht.«
Nun muss man sich darüber im klaren sein, dass das hier angesprochene Problem grundsätzlich nur dann gelöst werden könnte, wenn man eine radikale Variante der Pauschalierung durchsetzt. Das würde aber auch bedeuten, dass viele Betroffene unter die Räder der Pauschalierung geraten würden, denn ihre nicht selten durchaus berechtigten abweichenden Bedürfnisse können einem solchen System nicht mehr abgebildet werden. Man kann sich die letztendliche Konsequenz eines solchen Weges am Beispiel der hoch umstrittenen Wohnkosten verdeutlichen, die immer wieder nicht nur im Mittelpunkt sozialgerichtliche Verfahren stehen. Das SGB II arbeitet hier mit dem unbestimmten Rechtsbegriff der „angemessenen Wohnkosten“, die übernommen werden. Diese Formulierung führt nun dazu, dass man gezwungen ist, eine Grenze zu definieren, ab der die „Angemessenheit“ überschritten wird. Wenn nun aber in der betreffenden Region gar keine Wohnungen mehr vorhanden sind, die von den Harz IV-Empfängern zu den vorgegebenen Mietpreisobergrenzen erreicht werden können, dann bedeutet das, dass die Betroffenen den übersteigenden Betrag aus ihrem Regelsatz decken müssen, der dafür aber gar keine Position enthält, da die Wohnkostenübernahme außerhalb des Regelsatzes geregelt ist. Man kann es drehen und wenden wie man will: Pauschalierung ist auf der einen Seite aus Sicht der Verwaltung überaus effizient, auf der anderen Seite muss es zwangsläufigerweise immer zu Ungerechtigkeiten kommen, da die Pauschalen im Regelfall kalkuliert werden auf der Basis von Durchschnitten, die immer diejenigen benachteiligten müssen, die oberhalb des jeweiligen Durchschnitts liegen.
Öchsner weist in diesem Zusammenhang darauf hin:» Schon vor mehr als einem Jahr schlug deshalb eine Kommission von Bund, Ländern und Bundesagentur für Arbeit vor, das Hartz-IV-System zu vereinfachen. Doch passiert ist nichts.« Das hört sich interessant an, deshalb werden wir an dieser Stelle einen genaueren Blick auf diesen Vereinfachungsansatz.
Gemeint ist die „Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Vereinfachung des passiven Leistungsrechts – einschließlich des Verfahrensrechts – im SGB II (AG Rechtsvereinfachung im SGB II)“. So heißt die wirklich. Das BMAS, die BA, die Bundesländer und die Kommunalen Spitzenverbände haben darin miteinander über mögliche Rechtsvereinfachungen im SGB II geredet und verhandelt. Wohlfahrtsverbände oder gar Vertreter der Betroffenen waren „natürlich“ nicht beteiligt.
Bereits im Sommer des vergangenen Jahres wurde der Bericht über die Ergebnisse der Bund-Länder-Arbeitsgruppe vom 2. Juli 2014 vorgelegt. Die Arbeitsgruppe nahm im Juni 2013 ihre Tätigkeit auf und hatte am 4. September 2013 einen Bericht über die Ergebnisse der ersten drei Workshops vorgelegt. Bis April 2014 wurden in weiteren fünf Workshops die weiteren Rechtsänderungsvorschläge diskutiert und bewertet. Der Bericht wurde am 2. Juli 2014 von der Arbeitsgruppe beschlossen. Rechtsvereinfachungsbedarfe wurden unter anderem zu den Themen „Einkommen und Vermögen“, „Verfahrensrecht“, „Kosten der Unterkunft und Heizung sowie Bedarfsgemeinschaft“, „Mehrbedarfe, Leistungen nach § 24 SGB II und Bildungs- und Teilhabepaket“, „Anspruchsvoraussetzungen“, „Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung“ und „Sanktionen“ identifiziert und mögliche Lösungsansätze wurden erarbeitet. Der Katalog der Kommission besteht aus 36 Vorschlägen für Gesetzesänderungen im Hartz-IV-System. Unter anderem sollten die Jobcenter die staatliche Grundsicherung für zwölf statt für sechs Monate bewilligen, um die Flut von Hartz-IV-Bescheiden zu begrenzen.
Es ist hier nicht der Platz, die vielen einzelnen und in der Regel sehr kleinteiligen Vorschläge zu würdigen und ggfs. zu kritisieren. Verwiesen sei stellvertretend dafür auf das Papier Einschätzung der im Rahmen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Rechtsvereinfachung im SGB II eingebrachten Änderungsvorschläge der Bundesanstalt für Arbeit der Sozialrechtlerin Anne Lenze von der Hochschule Darmstadt aus dem vergangenen Jahr:
»Der Begriff Rechtsvereinfachung kommt ganz unschuldig daher – wer kann schon etwas dagegen haben, dass komplizierte rechtliche Tatbestände oder Rechtspraktiken vereinfacht werden!? Die Erfahrungen der letzten Jahre aber zeigen, dass unter dem Deckmantel von „Vereinfachung“, „Vereinheitlichung“ oder gar „Gleichbehandlung“ häufig Verschlechterungen zu Lasten der Betroffenen durchgesetzt wurden. Schaut man das Potpourri an Veränderungswünschen an, das die Leistungsträger im weitesten Sinn hier zusammengetragen haben, dann lassen sich natürlich Vorschläge finden, die eine „echte“ Vereinfachung zum Gegenstand haben, es sind aber auch etliche Vorschläge zu finden, die das Leistungsrecht komplett verändern würden – leider die meisten zum Nachteil der Betroffenen.«
Sie berührt in ihrer sowohl die positiven wie auch die negativen Aspekte würdigenden Auseinandersetzung eine Grundproblematik von Prozessen, wie sie mit der Bund-Länder-Arbeitsgruppe formatiert werden: Im Mittelpunkt steht meistens bis ausschließlich die Perspektive der Administration, die sich Entlastung verschaffen will. Eine Besserstellung der Betroffenen ist dann – wenn überhaupt – als Nebenfolge der Effizienzsteigerung der Verwaltungsabläufe zu erwarten.
Aber auch wenn man diesen kritischen Einwurf ausklammert – die Vorschläge der Bund-Länder-Arbeitsgruppe wurden wie gesagt Anfang Juli 2014 veröffentlicht und an den Gesetzgeber weitergereicht. Nun haben wir bekanntlich Oktober 2015, der auch schon bald vorbei ist. Und passiert ist – nichts.
Warum?
Der eine oder andere wird es schon ahnen – die Akteure auf der hier relevanten Gesetzgebungs-, also auf der Bundesebene, haben sich gegenseitig kalt gestellt. Vereinfacht gesagt: Die SPD wollte bzw. will die heute bestehenden verschärften Sanktionen für unter 25-Jährige im SGB II zurückführen (wohlgemerkt nicht abschaffen, sondern mit den Regelungen bei den über 25jährigen Hartz IV-Empfängern gleichstellen), was auf großen Widerstand in der Union, vor allem aber in der bayerischen CSU gestoßen ist. Nun wollen die Bayern (aber nicht nur die, auch Länder wie Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz befinden sich hier im Lager der Bayern) dafür etwas anderes, was bislang blockiert wird: Sie wollen eine Veränderung bzw. Abschaffung des sogenannten „Problemdruckindikators“ bei der Verteilung der Mittel für arbeitsmarktpolitische Fördermaßnahmen im SGB II. Was ist das nun wieder, wird der eine oder andere aufstöhnen. Versuchen wir es mit einer kurzen Erklärung, die man beispielsweise dem Papier Position zum Problemdruckindikator des Deutschen Caritasverbandes aus dem Januar 2015 entnehmen kann:
»Die finanziellen Mittel, die den einzelnen Jobcentern für Eingliederungsleistungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) zugewiesen werden, sind unterschiedlich hoch. Die Verteilung wird durch die Eingliederungsmittel-Verordnung jährlich geregelt. Sie richtet sich grundsätzlich nach dem Anteil der örtlich zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsempfänger. Zusätzlich erhalten Jobcenter mit einer überdurchschnittlich hohen Grundsicherungsquote einen Zuschlag, solche mit einer unterdurchschnittlichen Quote einen Abschlag (sog. Problemdruckindikator).«
Es geht hier angesichts mehrerer Milliarden Euro um richtig viel Geld. Zugespitzt formuliert hat die Verwendung dieses Mittelverteilungssystems dazu geführt, dass manche Jobcenter im Süden oder Südwesten der Republik kaum noch Mittel für Fördermaßnahmen im SGB II zur Verfügung haben, weil bei ihnen die allgemeine Quote an Hartz IV-Empfängern niedrig ist im Vergleich zu anderen Regionen. Wie so oft in der Sozialpolitik stand am Anfang des Problemdruckindikators, der seit 2004 eingesetzt wird (und der in der jährlich aktualisierten Eingliederungsmittel-Verordnung geregelt ist), eine gute Absicht: »Die Idee war dabei, Kreise mit sehr hohem “Problemdruck“ im Sinne von hoher Langzeitarbeitslosigkeit in der Ausgestaltung der Eingliederungsmittel besser zu stellen als Gebiete mit niedriger Langzeitarbeitslosenrate.« Das klingt doch plausibel. Im Ergebnis führt das dazu, dass für Jobcenter in Bayern und Baden-Württemberg nur halb so viel Eingliederungsmittel je Leistungsberechtigten zur Verfügung stehen wie für das Jobcenter in Berlin-Neukölln. Und wo ist jetzt das Problem?
Gerade »in Regionen mit guter Arbeitsmarktlage sind die zugewiesenen Mittel pro erwerbsfähigen Leistungsberechtigten besonders gering. Allerdings weisen gerade in diesen Regionen die Personen, die noch im Leistungsbezug sind, häufig besondere, verfestigte Problemlagen auf. Sie brauchen daher oftmals besonders kostenintensive (z. B. § 16e SGB II), langwierige oder mehrere Fördermaßnahmen. Wenn für sie pro Kopf wenige Mittel zur Verfügung stehen, können diese Menschen nicht angemessen gefördert werden«, so der Deutsche Caritasverband in seinem Positionspapier. Man kann es auch so sagen: Dem Problemdruckindikator liegt die Annahme zugrunde, dass bei einer guten Arbeitsmarktlage und einer geringen Quote an Grundsicherungsempfängern weniger Eingliederungsmittel erforderlich seien – möglicherweise aber, so die Kritiker, ist genau das Gegenteil der Fall, dass bezogen auf die einzelnen Individuen hier sogar höhere Aufwendungen anfallen, da die, die sich hier im Grundsicherungsbezug befinden, durch noch schwierigere persönliche Verhältnisse auszeichnen als in Regionen, in denen viele andere auch im SGB II-Bezug sind.
Hinzu kommt – und das wird leider oft vergessen: Diese unterschiedliche Mittelverteilung wird natürlich dann vor allem zu einem Problem, wenn zugleich die Mittel insgesamt erheblich gekürzt werden. Und genau das ist seit dem Jahr 2011 imm Bereich des Eingliederungstitels passiert, um gut 50 Prozent sind die Mittel runter gefahren worden.
An diesen Stellen hat man sich also meinen müssen zu bekriegen seit dem Sommer des vergangenen Jahres. Nichts ist seitdem passiert. Thomas Öchsner berichtet in seinem Artikel: »In Regierungskreisen ist nun zu hören, man nähere sich einem kleinsten gemeinsamen Nenner an, auf den man sich einigen könne. Von dem ursprünglichen Vereinfachungskatalog der Reformkommission dürfte dann aber nicht allzu viel übrig bleiben.«
Das wäre natürlich angesichts der schon sowieso gegebenen begrenzten Reichweite der Vorschläge ein Desaster. Kein Wunder, dass die oppositionellen Grünen an dieser Stelle neues Holz aufs Feuer legen und über ihre arbeitsmarktpolitische Sprecherin im Bundestag, Brigitte Pothmer, eine „Entbürokratisierungs-Offensive“ einfordern. »Sie rechnet vor: Könnten sich nur zehn Prozent der Mitarbeiter, die mit der Gewährung von Leistungen beschäftigt sind, durch eine Rechtsvereinfachung anderen Aufgaben widmen, ließen sich 2.200 Vollzeitstellen mobilisieren.«
Der einzige Schönheitsfehler in der Argumentation der Grünen: Diese Stellen sollen frei geschaufelt werden, »damit mehr Mitarbeiter in den Jobcentern für die Flüchtlinge zur Verfügung stehen.« Das mag zwar derzeit en vogue sein, aber der Personaleinsatz sollte nicht an den Status Flüchtlinge gebunden werden. Die zusätzlichen Stellen dafür muss die Bundesregierung auch zusätzlich zur Verfügung stellen. Auf eine bessere Betreuung, wie sie durch die frei werdenden Personalkapazitäten theoretisch möglich werden könnte, warten die vielen Langzeitarbeitslosen, die Verlierer des deutschen „Jobwunders“, schon lange.