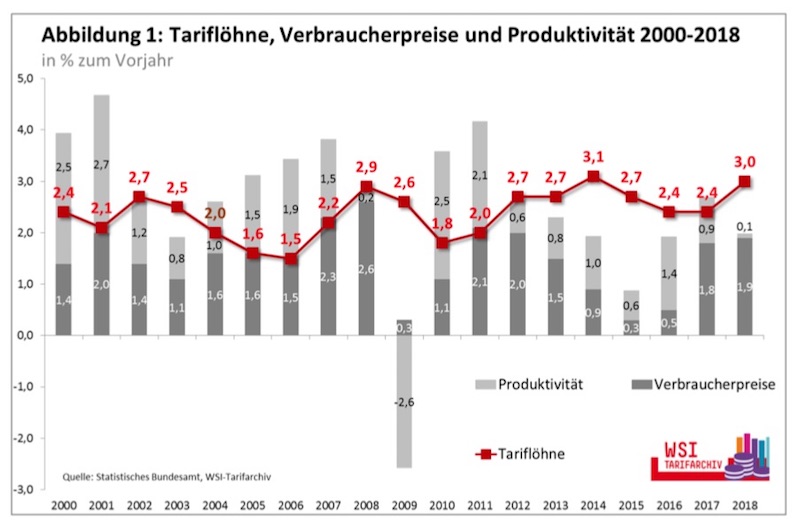Gestern war es wieder soweit: Der „Kampftag der Arbeiterklasse“ stand auf der Tagesordnung. Na ja, selbst der Deutsche Gewerkschaftsbund hat seine nicht nur an Lehrer gerichtete Darstellung der Geschichte des 1. Mai so überschrieben: Vom Kampftag zum Feiertag. Und das drückt dann wohl ziemlich genau aus, wie die meisten Menschen den gestrigen Tag wahrgenommen und genutzt haben.
An die Umrisse, was ein „Kampftag“ in einer ganz unmittelbaren Form auch bedeuten kann, erinnern nicht nur Bilder aus der fernen Vergangenheit: »Frankreich ringt um die Reformen von Präsident Macron. Mehr als tausend Vermummte greifen in der Hauptstadt Sicherheitskräfte an. In der Türkei geht die Polizei hart gegen Demonstranten vor«, kann man dieser Meldung entnehmen: Straßenschlachten in Paris, 80 Festnahmen in Istanbul. Ja, es gibt sie, die Länder wie die Türkei, in der engagierte Menschen sogar ihr Leben aufs Spiel setzen, um an diesem Tag auf die Straße gehen zu können.
Davon sind wir in Deutschland – glücklicherweise – ganz weit weg. Hier hat man aber sogar dem Rot der DGB-Plakate zum 1. Mai jeden aggressiven Grundton entzogen und um ganz sicher zu gehen auch inhaltlich auf amorphe, jedenfalls keinen wirklich beunruhigende Nicht-Aussagen gesetzt: „Europa. Jetzt aber richtig!“ Das könnte so erst einmal auch ein Christian Lindner von der FDP unterschreiben.