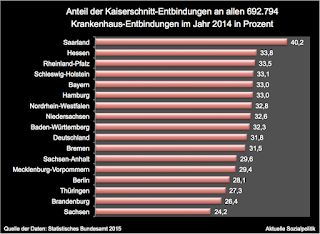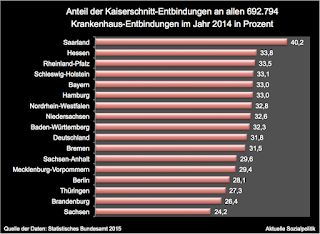Vor kurzem hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen im Auftrag der Bundesregierung ein Sondergutachten zum Thema Krankengeld vorgelegt und darin revolutionär daherkommende Vorschläge zur Veränderung der bisherigen Praxis der Krankschreibung von Arbeitnehmern, die dem Entweder-Oder-Modell folgt, zur Diskussion gestellt. Vgl. hierzu den Blog-Beitrag Ein Viertel Krankschreibung könnte doch auch mal gehen. Experten haben sich Gedanken über das Krankengeld gemacht vom 07.12.2015. »An erster Stelle der 13 Vorschläge steht die Teilkrankschreibung nach schwedischem Modell. Statt der in Deutschland geltenden „Alles-oder-nichts-Regelung“ könnte ein Arbeitnehmer je nach Schwere der Erkrankung und in Abstimmung mit seinem Arzt zu 100, 75, 50 oder 25 Prozent krankgeschrieben werden«, so Andreas Mihm in seinem Artikel Braucht Deutschland den Teilzeit-Kranken?
Dieser Vorschlag ist vielerorts auf Skepsis und Ablehnung gestoßen. So bilanziert der Beitrag In Zukunft nur noch teil-krank? Abschied von der Arbeitsunfähigkeit im Betriebsrat Blog: »Worin die angepriesene Flexibilität für Arbeitnehmer liegt und welche Vorteile ihnen die Neuregelung bietet, bleibt erstmal unklar. Sehr greifbar sind dagegen bereits jetzt die Nachteile, denn der Druck auf die Beschäftigten wird durch derartige Regelungen unweigerlich zunehmen. Bereits beim Arztbesuch geriete man als Kranker zukünftig in eine Art Verhandlungssituation: 100% oder vielleicht doch nur 75%? Oder sogar nur 50? Wieviel soll’s denn sein? Und anschließend geht es dann mit der Rechtfertigung bei den Kollegen und Vorgesetzten weiter: Denn mit nur 25% teil-krank ist man ja eigentlich gefühlt noch ziemlich gesund und mit 50% irgendwie noch nicht so richtig voll-krank. Wie krank aber ist krank?« Die Schlussfolgerung überrascht dann nicht: »Unterm Strich erweisen sich die Vorschläge jedenfalls als zu 50% unausgegoren, zu 75% praxisfern und darüberhinaus zu vollen 100% als sozialunverträglich. Dennoch: Der Angriff auf die sozialen Systeme und Standards hat schon vor längerer Zeit begonnen. Dies hier dürfte ein Teil davon sein. Da wird noch einiges kommen.«
Und was sagen die Ärzte zu den Vorschlägen des Sachverständigenrats, die das ja mit den Patienten umsetzen müssten? Die Idee haut Ärzte nicht vom Hocker, so haben Anno Fricke und Jana Kötter ihren Beitrag dazu überschrieben. Sie sehen nicht, wie sich die Teil-AU in der Praxis umsetzen lassen könnte. Hier einige Stimmen, die in dem Beitrag zitiert werden:
„Eine an sich vernünftige Idee“, sagte Ulrich Weigeldt, Vorsitzender des Deutschen Hausärzteverbands, der „Ärzte Zeitung“. Dann jedoch folgte das große Aber: Die Umsetzung dürfte für Ärzte eine enorme, zusätzliche Last bedeuten, weil Arzt und Patient über den Prozentsatz des Restleistungsvermögens diskutieren müssten, sagte Weigeldt.
„Kein Vorschlag, der bis zum Ende durchdacht ist“, lautete auch die erste Einschätzung von Dr. Wolfgang Wesiack, Präsident des Berufsverbands Deutscher Internisten (BDI). Krankheit habe eine objektive und eine wenig konstante subjektive Komponente. Hier zu objektivieren sei nicht möglich. Die Empfehlung des Sachverständigenrates sei geeignet, Ärzte in ein Verhandlungsgeschäft mit den Patienten zu treiben, für das es keine Kriterien gebe, sagte Wesiack der „Ärzte Zeitung“.
Es bestünden erhebliche Unterschiede zwischen einem Sachbearbeiter, einem Dachdecker und einem Piloten, sagte der stellvertretende Vorsitzende des NAV-Virchow-Bundes, Dr. Veit Wambach. Nicht alle Arbeitnehmer könnten gleichermaßen teilgesund geschrieben werden. „Unsere Gesellschaft muss sich fragen, was schwerer wiegt: die ökonomische Leistungsfähigkeit der Arbeitswelt oder Arbeitnehmerschutz und Patientenwohl.“
Immer wieder hervorgehoben werden (mögliche bzw. erwartbare) Probleme in der Rechtssicherheit. Schon heute sei es für einen praktizierenden Arzt „gar nicht möglich, etwa in einem BU/EU-Gutachten rechtssicher genaue prozentuale Abstufungen des verbliebenen Leistungsvermögens vorzunehmen“, wird ein Arzt zitiert.
Vor dem Hintergrund der deutlichen Kritik und Ablehnung ist es natürlich interessant, was die Urheber dieser Diskussion an Argumenten für ihren Vorschlag vortragen. Hierzu hat die Ärzte Zeitung ein Interview mit dem Vorsitzenden des Sachverständigenrates, Professor Ferdinand Gerlach, geführt: „Die jetzige Praxis der Krankschreibung ist realitätsfern“, so ist das Gespräch mit ihm überschrieben. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie sich die Teilzeit-Krankschreibung praktisch umsetzen lässt.
Einleitend verweist Gerlach darauf, dass es das Modell einer Teil-AU auch bei uns schon längst geben würde:
»Was wir vorschlagen, gibt es in Deutschland ja schon. Ab der siebten Woche können Krankgeschriebene nach dem Hamburger Modell schrittweise in den Arbeitsprozess zurückkehren. Das wird gerne genutzt und hat sich in Deutschland absolut bewährt. Wir sagen lediglich, dass man diese Möglichkeit zukünftig nicht erst ab der siebten Woche zur Verfügung haben sollte, sondern in Fällen, in denen das passt, auch schon vorher.«
Bei dem von ihm angesprochenen „Hamburger Modell“ geht es um eine stufenweise Wiedereingliederung in das Arbeitsleben: Ziel der stufenweisen Wiedereingliederung ist es, Beschäftigte unter ärztlicher Aufsicht wieder an die volle Arbeitsbelastung zu gewöhnen. Die stufenweise Wiedereingliederung ist eine Maßnahme der medizinischen Rehabilitation. Grundsätzlich haben alle Beschäftigten nach längerer Krankheit Anspruch auf eine stufenweise Wiedereingliederung durch die Kranken- oder Rentenversicherung. Allerdings gibt es Abweichungen zu den Vorschlägen der Sachverständigen, denn die fordern in ihrem Modell einer Teil-AU die Zahlung eines Teil-Krankengeldes. Das ist im Fall der Rehabilitation anders: Beschäftigte beziehen während der stufenweisen Wiedereingliederung Krankengeld oder Übergangsgeld. Sie gelten auch in dieser Zeit als arbeitsunfähig. Die Gesetzliche Krankenversicherung zahlt während der stufenweisen Wiedereingliederung Krankengeld in voller Höhe. Es gelten dieselben Voraussetzungen, die auch für Zahlung von Krankengeld für Arbeitsunfähigkeit gelten. Bei der Rentenversicherung wird Übergangsgeld gezahlt.
Aber wieder zurück zur Argumentation von Gerlach für die neuen Vorschläge. Er verweist auf vorliegende internationale Erfahrungen:
»In Schweden wird das seit 25 Jahren genau so praktiziert, wie wir das jetzt auch für Deutschland vorschlagen. Das Modell ist dort ausführlich evaluiert worden. Aufgrund der sehr positiven Erfahrungen haben auch Dänemark, Norwegen und Finnland es übernommen. In Österreich wird aktuell darüber diskutiert, es ebenfalls einzuführen. Das könnte allen zu denken geben, die glauben, dass die Teil-AU eine vollkommen abwegige Idee wäre.«
Er betont die Freiwilligkeit der Teil-AU, denn sie »soll nur dann angewendet werden, wenn Arzt und Patient davon überzeugt sind, dass das im Einzelfall eine sinnvolle Maßnahme ist. Ein Fernfahrer kann nicht teilweise arbeiten, ein Dachdecker muss bei seinen Einsätzen zu 100 Prozent fit sein.«
Und für wen könnte das neue Modell passen?
»Denken wir mal an eine Verkäuferin die schwanger ist und sich geschwächt fühlt. Sie sagt, acht Stunden Stehen halte ich nicht mehr durch. Ich könnte vielleicht einen halben Tag arbeiten. Hier hat der Arzt keine Alternative. Er muss sie komplett krankschreiben.
Ein anderes Beispiel: Sie kommen aus dem Skiurlaub zurück und haben sich den Fuß verstaucht. Es gibt viele Arbeitsplätze, an denen Sie dann trotzdem noch am Schreibtisch sitzen und Ihre E-Mails bearbeiten könnten.«
Angesprochen auf die beiden häufigsten Auslöser von Langzeit-Krankschreibungen, Rückenbeschwerden und psychische Störungen, argumentiert Gerlach so:
»… in beiden Fällen wissen wir, dass es vielfach nicht sinnvoll ist, dass Patienten entweder sechs Wochen lang alleine zuhause sitzen, ohne soziale Kontakte, oder sich sechs Wochen lang ins Bett legen und sich schonen.
Im Gegenteil: Es ist medizinisch sinnvoll, dass sie nicht ganz aussteigen, dass sie weiter unter Leute kommen, dass sie sich bewegen. Für den ein oder anderen Patienten mit Rückenleiden könnte es in den ersten sechs Wochen einer Krankschreibung durchaus sinnvoll sein, dass er vormittags zum Beispiel vier Stunden arbeiten und nachmittags zur Physiotherapie geht. Ich weiß aus meiner eigenen zwanzigjährigen Praxiserfahrung, dass es auch viele Patienten gibt , die von sich aus sagen, sie würden gerne wieder arbeiten gehen, weil ihnen sonst zu Hause die Decke auf den Kopf falle.Sie wissen, dass ihre Kollegen für sie mitarbeiten müssen, aber sie selbst halten, auch angesichts der heutigen Arbeitsverdichtung, noch nicht wieder den vollen Stress aus.«
Aus sozialpolitischer Sicht interessant ist natürlich der Vorwurf, hier gehe es nur darum, auf Kosten der Arbeitnehmer zu sparen, was auch durch den Auftrag an den Sachverständigenrat verstärkt wird, denn die Bundesregierung wollte Vorschläge haben, wie man den starken Anstieg der Krankengeldausgaben der Kassen eindämmen kann. Hier verweist Gerlach darauf, dass das nicht der Fall sei, sondern ganz im Gegenteil sogar eine Verbesserung für den Arbeitnehmer erreicht werden könne:
»In den ersten sechs Wochen bekommt jeder Versicherte eine vollständige Lohnfortzahlung. Ab der siebten Woche kommt das Krankengeld, das 70 Prozent des Bruttolohns ausmacht, maximal 90 Prozent vom Netto.
Wenn Sie jetzt das Hamburger Modell anwenden, so wie es heute ist, und Sie gehen halbtags arbeiten, dann bekommen Sie trotzdem nur das Krankengeld. Sie bekommen auch dann nicht mehr, wenn Sie 75 Prozent arbeiten gehen. Der Arbeitgeber muss ja erst dann wieder einen Cent zahlen, wenn Sie 100 Prozent gesund sind.«
Und das Modell des Sachverständigenrates sieht ja vor, dass Krankengeld nur noch als Teil-Leistung für die Teil-AU geleistet wird, während für die Zeit, wo gearbeitet wird, der Arbeitgeber Zahlen muss. Man muss aber genauer hinschauen: Eine Verbesserung im Vergleich zum heutigen „Hamburger Modell“ kann man schon erkennen, keine Frage. Aber die Vorschläge des Sachverständigenrates mit der Teil AU zielen ja vor allem darauf, von Anfang an mit diesem Instrumentarium einer Teil-Kranzschreibung zu arbeiten, also auch in den ersten sechs Wochen, in denen die betroffenen Arbeitnehmer Anspruch haben auf volle Lohnfortzahlung des Arbeitgebers. Wenn man jetzt von Anfang an zu 50 Prozent krank geschrieben wird, dann bekommt man natürlich auch nur 50 Prozent volle Lohnfortzahlung, aber 50 Prozent reduziertes Krankengeld – und muss zugleich noch 50 Prozent arbeiten, so bereits der Hinweis in meinem ersten Blog-Beitrag zu den Vorschlägen.
Aber auch Gerlach sieht diese Problematik und benennt sie auch – er differenziert die „Gewinner und Verlierer“-Bewertung entlang der Scheidelinie einer AU, die in die ersten sechs Wochen mit Lohnfortzahlungsanspruch fällt und eine AU, die darüber hinaus andauert:
»Wenn unser Vorschlag umgesetzt würde, dann hätten die Betroffenen mehr Geld im Portemonnaie. Würde jemand halbtags arbeiten, hätte er nach unserem Modell für diesen halben Tag den vollen Lohn und für die andere Tageshälfte dann die 70 Prozent Krankengeld. Das könnte sogar ein Anreiz sein für die Versicherten, von der Wiedereinstiegsmöglichkeit Gebrauch zu machen.
Während der ersten sechs Wochen hätte allerdings der Arbeitgeber den Vorteil, weil er im Gegensatz zu heute einen Teil der Arbeitskraft als Gegenleistung für die Lohnfortzahlung bekäme.«