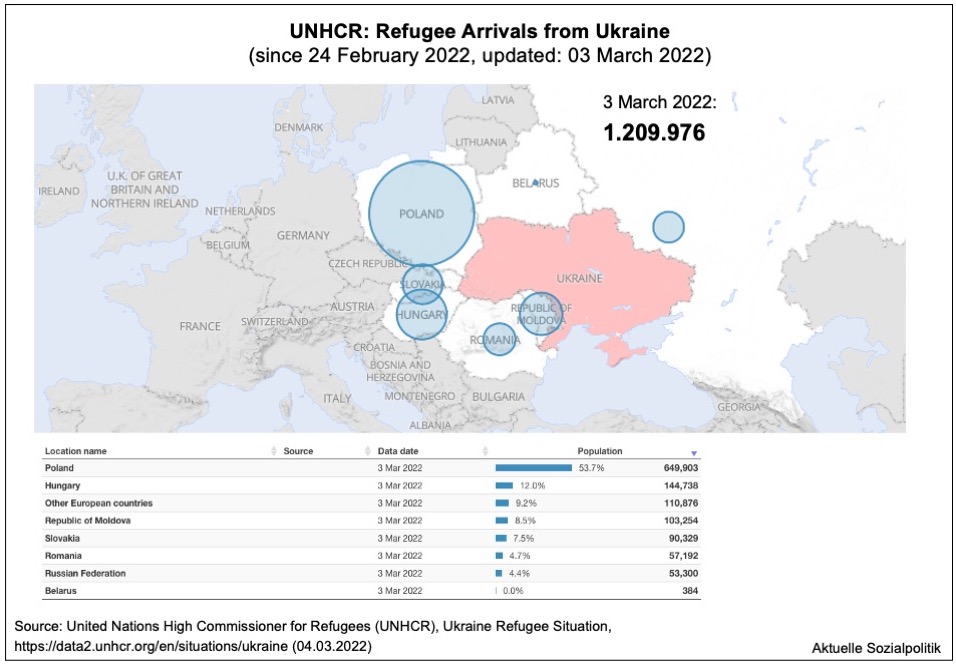Vor gut vier Jahren wurde in diesem Blog inmitten des zu dieser Zeit alles beherrschenden Themas Flüchtlinge dieser Beitrag veröffentlicht: Soll man oder soll man nicht? Und wenn ja, wie? Zur aktuellen Debatte über eine Wohnsitzauflage für Flüchtlinge. Nicht nur in Deutschland. Der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte angekündigt, eine „Integrationsgesetz“ vorzulegen und ein Bestandteil dieses Gesetzes sollte „eine Wohnsitzauflage für Flüchtlinge, um die Integration zu erleichtern“ sein. Der Minister sagte, er wolle Ghetto-Bildung vermeiden: „Deswegen wollen wir regeln, dass auch anerkannte Flüchtlinge – jedenfalls solange sie keinen Arbeitsplatz haben, der ihren Lebensunterhalt sichert – sich an dem Ort aufhalten, wo wir das als Staat für richtig halten, und nicht, wo der Flüchtling das für richtig hält.“ Und des gab damals durchaus parteiübegreifend Zustimmung für diesen restriktiven Teil eines Integrationsgesetzes.
Das überrascht auch nicht angesichts der Zeile bzw. Hoffnungen, die man mit so einem Eingriff verbunden hat. Eine der Hauptargumentationslinien ging so:
➔ Verhinderung von Ghettobildung und Erleichterung der Integration in Arbeitsmarkt und Gesellschaft: Studien hätten gezeigt, dass eine hohe ethnische Konzentration in gewissen Gebieten zu einem geringeren oder jedenfalls langsameren Erlernen der Landessprache führt. Ein Umstand, der sich negativ auf spätere Arbeitsmarktchancen auswirkt. Auch sonstige Integrationsaufgaben wie etwa die Wertevermittlung – z. B. die Einstellung zur Erwerbstätigkeit von Frauen – wären wohl schwieriger, auch deswegen, weil viele ehrenamtliche Strukturen, die häufig im ländlichen Raum angeboten werden, nicht gut genutzt werden können.
Das klingt bei einer ersten Inaugenscheinnahme plausibel. Aber bereits damals wurden auch kritische Fragen und skeptische Anmerkungen vorgetragen.
mehr