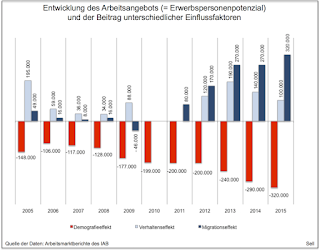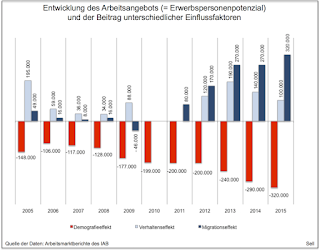Bei so einer Meldung spitzt man die sozialpolitischen Ohren: Wolfgang Schäuble will Hartz IV für Asylbewerber senken. Und reibt sich anschließend die Augen ob der Begründung, die in dem Artikel kolportiert wird: »Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble will den Hartz-IV-Satz für Flüchtlinge senken. „Können wir nicht wenigstens die Kosten für die Eingliederungsleistungen abziehen?“, fragte Schäuble am Dienstag in Berlin. „Wir werden darüber noch diskutieren müssen.“ Sonst erhalte ein Flüchtling, der noch die Sprache und zum Teil Lesen und Schreiben lernen müsse, ebenso viel wie jemand, der 30 Jahre gearbeitet habe und nun arbeitslos sei.« Allein in dieser Aussage sind zwei richtig große Klöpse enthalten. Zum einen sein Hinweis auf die Eingliederungsleistungen. Der ist richtig putzig, denn er vermittelt den Eindruck, die werden den Hartz IV-Empfängern ausgezahlt. Was nun wirklich nicht der Fall ist, denn es handelt sich hierbei um Mittel, die verwendet werden können beispielsweise für Arbeitsgelegenheiten oder Qualifizierungsmaßnahmen, wenn sie denn da sind. In den vergangenen Jahren wurden diese Eingliederungsmittel erheblich gekürzt und außerdem bedienen sich viele Jobcenter an diesem Topf, denn die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Budget für Verwaltungsausgaben, also werden Gelder für die Förderung umgewidmet für die Verwaltungsausgaben der Jobcenter (vgl. hierzu beispielsweise Unterfinanzierte Jobcenter: Von flexibler Nutzung zur Plünderung der Fördergelder für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen). Also das war schon mal nichts.
Wie aber ist es mit seinem zweiten Punkt? Man müsse Hartz IV absenken, »erhalte ein Flüchtling, der noch die Sprache und zum Teil Lesen und Schreiben lernen müsse, ebenso viel wie jemand, der 30 Jahre gearbeitet habe und nun arbeitslos sei.« Das nun wiederum ist eine totale Verkennung der Grundprinzipien des Grundsicherungssystems. Denn das von ihm wohl offensichtlich in spalterischer Absicht vorgetragene Argument ist keines, denn dieses Problem stellt sich auch in einer Hartz IV-Welt ohne Flüchtlinge.
In der alten Prä-Hartz-Welt gab es neben dem beitragsfinanzierten Arbeitslosengeld die bedürftigkeitsabhängige, allerdings am früheren Arbeitseinkommen orientierte Arbeitslosenhilfe und als eigenes, letztes Auffangsystem die Sozialhilfe. Mit den „Hartz-Reformen“ hat man die beiden unteren Etagen zusammengelegt, dabei allerdings den Bezug auf das frühere Arbeitseinkommen beseitigt. Das bedeutet im Klartext für den Normalfall: Ein Arbeitnehmer, der seinen Job verliert und ein Jahr lang Arbeitslosengeld I als Versicherungsleistung bezieht, fällt in das Grundsicherungssystem (SGB II) mit dem Arbeitslosengeld II – und bekommt genau so viel oder wenig wie eine Person, die ihr Leben lang nie gearbeitet hat. Sollte der Herr Bundesfinanzminister hier ein Problem sehen oder ar eine Ungerechtigkeit, dann hätte er das schon längst thematisieren können und müssen. Ganz offensichtlich geht es hier um etwas ganz anderes: Er bedient die Abgrenzungsgefühle nach unten gegen die Gruppe der Flüchtlinge bei denjenigen, die selbst ganz unten angekommen sind.
Ansonsten hätte man von einem Bundesminister schon erwartet, dass er die Rechtsprechung des höchsten deutschen Gerichts kennt und berücksichtigt. Das Bundesverfassungsgericht hat sich in der hier interessierenden Causa mit einem wegweisenden Urteil bereits zu Wort gemeldet und vor allem dieser eine Satz aus der Entscheidung des BVerfG aus dem Jahr 2012 sollte auch dem Bundesfinanzminister bzw. seinen Zuarbeitern bekannt sein und seine Zitation könnte die weitere Auseinandersetzung mit den Gedankenspielereien des Ministers beenden:
»Die in Art. 1 Abs. 1 GG garantierte Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren.« (BVerfG, Urteil vom 18. Juli 2012 – 1 BvL 10/10, Randziffer 121)
Dieses Urteil des BVerfG ist insofern von besonderer Relevanz für die aktuelle Debatte, als die Verfassungsrichter hier eine wichtige Klarstellung vorgenommen haben: Regelungen zu den Grundleistungen in Form der Geldleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz verfassungswidrig, so die Pressemitteilung des Gerichts zur damaligen Entscheidung. Die klare Botschaft der damaligen Entscheidung: Es gibt die Verpflichtung zur Sicherstellung des Grundrechts auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums. Und das Gericht spricht hier von Existenzminimum im Singular, keineswegs im Plural – genau darum aber geht es Schäuble mit seinem Vorschlag (oder sagen wir besser: mit seiner Idee). Er will offensichtlich Existenzminima in den politischen Raum stellen. Das nun ist durch die höchstrichterliche Rechtsprechung nicht gedeckt.
Warum dann dieser Vorstoß? Man kann es hinsichtlich der Interpretation so halten, wie es in dem Artikel Schäuble irritiert mit Kürzungsvorschlag für Flüchtlinge vorgetragen wird:
»Möglicherweise war der Minister bei dem von der Journalistin Nina Ruge moderierten Gespräch schlicht in Plauderlaune. So berichtete er auch von einem Scherz, den er sich vergangene Woche bei der Herbsttagung von IWF und Weltbank erlaubt habe. „Ich hab gesagt, als ich in Peru war, in Lima bei der IWF-Tagung, ich könnt‘ ja schnell nach Chile fliegen – ist nicht mehr so weit und die Frau Honecker lebt ja noch – und fragen, wie hat’s eigentlich der Erich gemacht mit der Mauer?“«
Sehr witzig. Vielleicht war es ja auch in Wirklichkeit so, dass der Bundesfinanzminister einfach seiner Plauderlaune erneut freien Lauf gelassen hat. Bei dem Thema wäre das allerdings mehr als fragwürdig, es geht hier immerhin um die Frage des Existenzminimums.
Es könnte natürlich auch sein, dass hinter dem Vorstoß eine bestimmte Strategie steckt, die sich darüber bewusst ist, dass der konkrete Vorschlag – gleichsam als Bauernopfer – gar keine Chance hat, sehr wohl aber das dahinter stehende Einsparmotiv.
Da verwundert es auch nicht, dass gewisse journalistische Hilfstruppen sogleich dem an sich nur plaudernden Finanzminister beigesprungen sind – immer im Dienst der Sache, hier des Abbaus sozialer Leistungen. So kommentiert Heike Goebel in der Online-Ausgabe der FAZ unter der Überschrift Sozialleistungen müssen überprüft werden und zugleich – wenn schon, denn schon – den Bogen weiter spannend: »Die Sozialleistungen für Flüchtlinge müssen auf Fehlanreize überprüft werden. Das allein wird aber nicht reichen, um den Anstieg der Sozialausgaben zu bremsen. Hält der starke Zustrom an, müssen die Sozialleistungen durchforstet werden. Es wird Kürzungen geben, nicht nur für die Flüchtlinge.« Aber so ganz sicher ist sich die Apologetin des Sozialabbaus nun auch wieder nicht, denn sie stellt etwas verunsichert – man weiß ja nie – die Frage in den Raum: »Oder wollte Schäuble mit seinem Hinweis auf Hartz IV das Feld für höhere Steuern und Schulden vorbereiten?«
Das mag alles vielleicht so sein. Sicher ist hingegen, dass der Bundesfinanzminister weiß, was auf ihn bzw. den Bundeshaushalt zukommen wird, wenn auch nur in Umrissen, die aber genügen. „Im Hartz-IV-System fehlen Milliarden“, konnte man in der Print-Ausgabe der FAZ am 6. Oktober 2015 lesen. Da bekommt man einen ersten Eindruck von den Größenordnungen, über die wir hier sprechen – und erneut werden wir auch wieder mit den Verwaltungskosten der Jobcenter konfrontiert:
»Die 408 deutschen Jobcenter sollen nach dem Willen von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) im kommenden Jahr bis zu 3,3 Milliarden Euro zusätzlich vom Bund erhalten, damit sie die Mehrausgaben für die vielen Flüchtlinge decken können. Der Betrag ist aber womöglich viel zu knapp kalkuliert – selbst wenn man die bisherige Prognose von 800 000 Asylbewerbern in diesem Jahr zugrunde legt. Das zeigen Berechnungen der Bundesländer. Danach müsste nun allein das Budget der Verwaltungskosten, mit denen die Jobcenter ihr Personal und ihren laufenden Betrieb finanzieren, um 1,1 Milliarden Euro im Jahr steigen … Bisher sieht Nahles’ Etat für 2016 insgesamt 4 Milliarden Euro für Verwaltungskosten der Jobcenter vor, ebenso viel in diesem Jahr und 650 Millionen Euro weniger als noch 2014. Die Verwaltungskosten machen knapp ein Zehntel aller Hartz-IV-Ausgaben aus; der größte Posten ist mit gut 19 Milliarden Euro das Arbeitslosengeld II. Überträgt man diese Kostenverteilung auf die von Nahles nun angestrebte Budgetaufstockung um 3,3 Milliarden Euro, dann wären darin rund 300 Millionen für Verwaltungskosten enthalten – also nur etwas mehr als ein Viertel dessen, was nun nach gemeinsamer Überzeugung der Länder nötig ist … Seit Jahren buchen Jobcenter laufend Gelder aus dem Topf für Eingliederungs- und Fördermaßnahmen für Arbeitslose um, damit sie ihre eigenen Personal-, IT- und Heizkosten bezahlen können. Schon 2014 hatten sie dafür fast 500 Millionen Euro aus dem Fördertopf entnommen, der ebenfalls ein Gesamtvolumen von rund vier Milliarden Euro hat. In diesem Jahr werden es sogar fast 650 Millionen Euro sein.«
Und dann erfahren wir auch den wohl wahrscheinlichsten Grund für die Schäuble’sche Plauderei: Die Bundesarbeitsministerin Nahles verhandelt derzeit mit Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) über jene 3,3 Milliarden. Details werden voraussichtlich erst im November nach der neuen Steuerschätzung festgezurrt. Und bis dahin kann man ja ein wenig herumzündeln, denn auch wenn es inhaltlich wie gezeigt keine Substanz hat – bei vielen Menschen bleibt die Botschaft hängen, die unters Volk gebracht werden sollte. Insofern kann und darf man das nicht nur abtun als Merkwürdigkeit eines Bundesfinanzministers, der sich ein wenig hat gehen lassen. Wir haben es hier immerhin mit einem echten Profi zu tun.