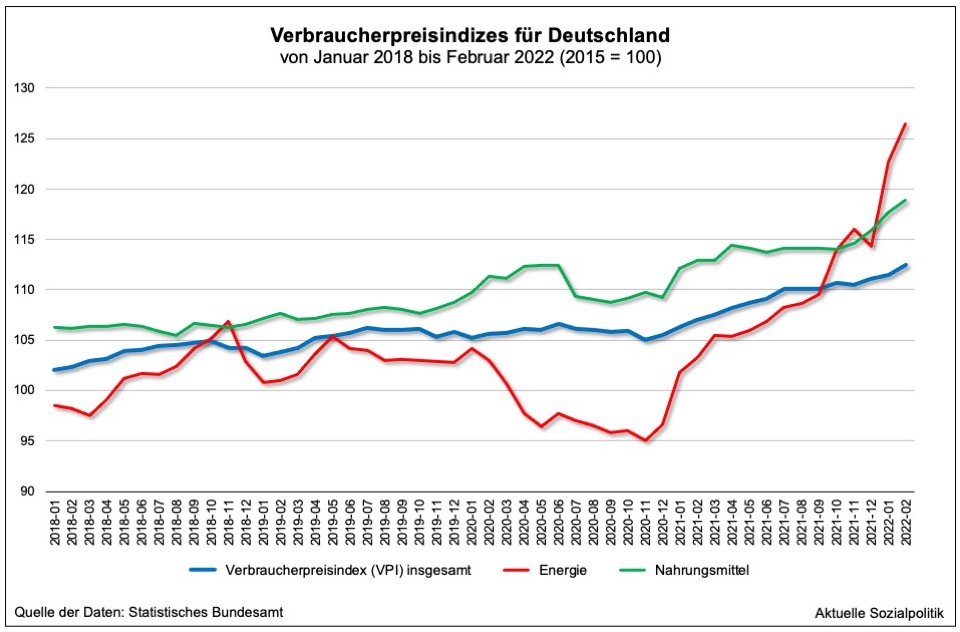Am Tag der Arbeit des Jahrs 2022 wurde die vom Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nunmehr auch als Gesetzentwurf in das Parlament eingebrachte, im Wahlkampf des vergangenen Jahres versprochene Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde sicher in vielen Reden als eine erfreuliche und erfolgreiche Sache hervorgehoben. Ansonsten hätte es noch Jahre gedauert, bis man die 12 Euro erreicht hätte. Im Umfeld des „Entwurfs eines Gesetzes zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen Mindestlohn und zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung“, BT-Drs. 20/1408 vom 13.04.2022 gibt es nun natürlich einen Aufschrei aus dem Lager der Arbeitgeberfunktionäre, die schlagzeilenträchtig mit einer möglichen Klage vor dem Bundesverfassungsgericht drohen – und dafür zwei Auftragsgutachten eingekauft haben (vgl. dazu 12 Euro waren schon beschlossen – Jetzt eskaliert der Streit um den „Staatslohn“). Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) hat gleich zwei Gutachten in Auftrag gegeben, die – wenig überraschend – zum Schluss kommen, dass der Mindestlohn in die Tarifautonomie eingreife und womöglich sogar gegen das Grundgesetz verstoße. Die Einschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit eines solchen Vorstoßes: »Allzu große Chancen räumen Juristen dem Verband allerdings nicht ein.«
In der öffentlichen Diskussion wenig beachtet wird der gesetzliche Mindestlohn an einer ganz anderen Stelle tatsächlich vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt. Da geht es allerdings nicht um seine Erhöhung, sondern um die Nicht-Gewährung dieser Lohnuntergrenze. Konkret geht es um die Vergütung der Arbeit der Strafgefangenen in den Justizvollzugsanstalten unseres Landes.