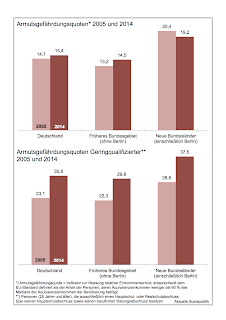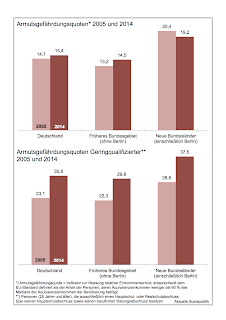Eigentlich müsste man, aber … Das Muster kennt man von vielen sozialpolitischen Baustellen. Vor wenigen Tagen wurde hier berichtet: Zahlen können geduldig sein. Hartz IV ist nach den vorliegenden Daten zu niedrig, doch bei den eigentlich notwendigen Konsequenzen sollen sich die Betroffenen – gedulden. Da ging es um die Tatsache, dass eigentlich eine Neuberechnung der Hartz IV-Leistungen erforderlich ist angesichts der Tatsache, dass die neuen Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2013 mittlerweile vorliegen und die bisherigen Leistungen noch auf der Datengrundlage der EVS 2008 bemessen worden sind, so dass eine Anpassung erfolgen müsste, wenn der Gesetzgeber seine eigene Vorschrift im § 28 SGB XII „Ermittlung der Regelbedarfe“ umsetzen würde. Will er auch, aber eben nicht so schnell: Mit einer Erhöhung der Regelsätze aufgrund der neuen Daten können die Hartz IV-Empfänger erst Anfang 2017 rechnen, denn – so das Bundesarbeitsministerium – zunächst werde man die Ergebnisse der EVS prüfen und bei den Statistikern neue Sonderauswertungen in Auftrag geben. Bloß nichts überstürzen. Das an sich ist schon mehr als kritikwürdig.
Nunmehr erreicht uns eine weitere Hiobsbotschaft für die eigentlich erforderliche sorgfältige Systematik bei der Bestimmung der Leistungen, mit denen immerhin das „soziokulturelle Existenzminimum“ abgesichert werden soll: Nahles wegen Hartz-IV-Berechnung in der Kritik, so beispielsweise Thomas Öchsner in der Süddeutschen Zeitung. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles lässt die Hartz-IV-Sätze nach einem Modell berechnen, dass schon Vorgängerin Ursula von der Leyen verwendete. Diese Berechnungsmethode hatte Nahles vor Jahren heftig kritisiert. Neben der Tatsache, dass wir wieder einmal Zeuge werden müssen, dass das Motto „Was schert mich mein Geschwätz von gestern“ offensichtlich eine Konstante im politischen Geschäft ist, geht es hier um das „Eingemachte“ im Grundsicherungssystem.
Zum besseren Verständnis muss man etwas zurückblicken. Dazu Thomas Öchsner in seinem Artikel: Als die damalige Bundessozialministerin Ursula von der Leyen (CDU) 2010 die Hartz-IV-Regelsätze neu berechnen ließ, warfen ihr die Kritiker vor, getrickst zu haben, um Geld zu sparen. »Ihre Nachfolgerin Andrea Nahles, damals in der Opposition, war ebenfalls empört. Von der Leyen, sagte die SPD-Politikerin, habe die Hartz-IV-Sätze „künstlich heruntergerechnet“. Nun muss Nahles selbst neu rechnen lassen – und orientiert sich dabei an den von ihr heftig kritisierten Vorgaben der Vorgängerin.« Worum geht es genau?
Bei der Berechnung kommt es entscheidend darauf an, welche Vergleichsgruppe der nach Einkommen geschichteten Ein-Personen-Haushalte herangezogen wird.
»Von der Leyen geriet in die Kritik, weil sie die einkommensschwächsten 15 Prozent heranzog, um den Hartz-IV-Satz für Alleinstehende zu ermitteln . Zuvor hatten die unteren 20 Prozent als Basis gedient. Ein finanziell gewichtiger Unterschied, da die Gruppe der unteren 15 Prozent ein geringeres Einkommen hat als die unteren 20 Prozent der Haushalte.«
Aus der Vergleichsgruppe der einkommensschwächsten 15 Prozent der Haushalte rechnete das Ministerium die Hartz-IV- und Sozialhilfeempfänger selbst heraus, um sogenannte Zirkelschlüsse zu vermeiden. So weit, so richtig, aber: Auch die „Aufstocker“ hätte man heraus nehmen müssen, so die Kritiker, also Hartz-IV-Bezieher, die zusätzlich erwerbstätig sind und so wenig verdienen, dass sie aufstockenden Grundsicherungsleistungen in Anspruch nehmen müssen. Und dann gab (und gibt) es noch die so genannten „verdeckt Armen“, also Menschen, die eigentlich Anspruch hätten auf SGB II-Leistungen, diese aber nicht in Anspruch nehmen (vgl. dazu grundsätzlich die Studie vor Irene Becker, Verdeckte Armut in Deutschland. Ausmaß und Ursachen, aus dem Jahr 2007). Immer noch (und für den „Kostenträger“: Gott sei Dank) keine kleine Gruppe. Die hätte man auch herausfiltern müssen. Hat man aber nicht.
In einer Antwort auf eine Anfrage der Linken im Bundestag, aus der Öchsner zitiert, »kündigt das Arbeitsministerium nun an, es bei der Referenzgruppe für Alleinlebende bei den „unteren 15 Prozent“ zu belassen. Auch werde man daraus nur Haushalte herausrechnen, „die über kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit verfügen“. Die Aufstocker bleiben also drin, genauso wie die verdeckt Armen.«
Schon 2010 hätte der Regelsatz im Hartz IV-System um mindestens 30 Euro höher liegen müssen, wenn man der eigentlich gebotenen Berechnungslogik gefolgt wäre.
Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, verlangt von Nahles, „zu einer seriösen Herleitung der Regelsätze zurückzukehren“. Auch der Caritasverband spricht sich dafür aus, wieder die unteren 20 Prozent der Haushalte heranzuziehen und sich nicht von fiskalischen „Überlegungen zur Ausgabenbegrenzung“ leiten zu lassen.
Aber daraus wird – jedenfalls nach dem derzeitigen Stand der Dinge – nichts. Es wird wieder ein zu geringer Betrag herauskommen und das dann auch noch aufgrund der bereits erwähnten Verschiebetaktik viel zu spät.
Wir reden hier bekanntlich nicht von üppigen Beträgen, ganz im Gegenteil, es gibt zahlreiche Kritiker, die die gegebene Höhe des Hartz IV-Regelsatzes – also bei alleinstehenden Personen derzeit noch 399 Euro, ab dem neuen Jahre dann fünf Euro mehr – für eindeutig zu niedrig klassifizieren. Vgl. dazu beispielsweise Irene Becker, Bedarfsbemessung bei Hartz IV. Zur Ableitung von Regelleistungen auf der Basis des „Hartz-IV-Urteils“ des Bundesverfassungsgerichts, eine Expertise aus dem Jahr 2010, aus diesem Jahr auch Anne Lenze, Regelleistung und gesellschaftliche Teilhabe, sowie den Artikel Die Kosten für ein menschenwürdiges Leben.
»Was braucht ein Mensch zum Leben? Früher errechneten Experten die nötigen Tageskalorien und packten Kartoffeln in imaginäre Warenkörbe. Heute runden sie Statistiken ab«, so Lisa Caspari in ihrem Artikel Definiere Existenz und Minimum aus dem Januar 2015. Bis in die 1980er Jahre wurde das Existenzminimum nach der „Warenkorb“-Methode ermittelt. Der Warenkorb geriet in Verruf – auch weil er zwischen 1976 und 1986 einfach mal zehn Jahre nicht aktualisiert wurde. Aber die neue, heute gängige Methode hat offensichtlich auch ihre Tücken.
Gewissermaßen an der alten Methode setzen Fundamental-Kritiker der gegenwärtigen Bestimmung der Regelleistungen im Hartz IV-System an – und sie bilden damit das obere Ende des Antwortspektrums ab, wie hoch denn der Regelsatz sein müsste/sollte. Diese Frage wird sicher unweigerlich von vielen aufgerufen werden. So wird derzeit beispielsweise aus den Reihen der Wohlfahrtsverbände statt der 399 Euro pro Monat ein Regelsatz von 485 Euro gefordert. Aus der Perspektive der Fundamental-Kritiker ist auch das noch viel zu wenig.
Erst 730 Euro Hartz-IV-Satz decken das soziokulturelle Existenzminimum, so ist ein Interview mit einem ausgewiesenen Vertreter dieser Richtung überschrieben: Lutz Hausstein.
Der versucht schon seit Jahren eine ganz eigene Art der Ermittlung dessen, was die Menschen bräuchten. Die neuste Ausgabe seiner Berechnungen:
Lutz Haustein: Was der Mensch braucht. Empirische Analyse zur Höhe einer sozialen Mindestsicherung auf der Basis regionalstatistischer Preisdaten. Stand: Mai 2015
Was kritisiert Hausstein?
»Viele Menschen können sich unter den Bedingungen von Hartz IV auch einfachste Selbstverständlichkeiten nicht mehr leisten, weil sie zu wenig Geld zur Verfügung haben.
350.000 Haushalten wurde 2013 etwa der Strom abgeschaltet, weil sie die Rechnung nicht mehr bezahlen konnten. Und 1,5 Millionen Menschen müssen jede Woche den für sie demütigenden Weg zu einer Lebensmitteltafel antreten, weil ihr Geld nicht fürs Essen reicht.«
Ihn bewegen die vielen demütigenden Umstände, viele zwangsweise Verzichte auf einfache Dinge, die für jeden anderen in unserer Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit sind. Und dann geht es gegen die amtliche Berechnungsmethodik. Sein zentraler Ansatzpunkt dagegen:
»Immer wieder wird durch Politiker gegenüber der Öffentlichkeit gebetsmühlenartig wiederholt, dass damit der Bedarf ermittelt würde. Doch eben dies ist überhaupt nicht Inhalt der Statistik-Methode auf Grundlage der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS), … Mithilfe der … Statistikmethode wird nur das Ausgabeverhalten eines ebenfalls armen Bevölkerungsteils ermittelt, der aufgrund seines eigenen, sehr niedrigen Einkommens auch nur wenig Geld zur Verfügung hat. Mit einer Bedarfs- Ermittlung hat dies jedoch nichts zu tun.«
Und er bringt seine Kritik an diesem methodischen Ansatz mit einem Bild auf den Punkt:
»Ich vergleiche das gern mit der absurden Situation, wenn sich jemand mit einem Digitalthermometer an die Autobahn stellen würde, um damit die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Autos zu messen. Das Thermometer liefert absolut exakte Daten, sogar bis auf die zweite Kommastelle genau. Wenn man diese Zahlen nun allerdings öffentlich als gemessene Geschwindigkeiten bezeichnen würde, wäre das Gelächter riesengroß. Zurecht. Wenn allerdings die Ausgaben eines ebenfalls armen Bevölkerungsteils, der selbst bereits Mangel leidet, als „Bedarf“ einer immer größer werdenden Bevölkerungsgruppe dargestellt werden, herrscht andächtige Stille.«
Hausstein outet sich als Anhänger der Warenkorb-Methode: »Die benutzte Aufstellung eines Warenkorbs ist ja nun keineswegs eine Erfindung von mir. Denn von 1955 bis 1990 wurden schon mithilfe des Warenkorbmodels soziale Sicherungsleistungen berechnet.«
Um seine eigene, subjektive Wahrnehmung zu reduzieren, wurde jede einzelne Bedarfsposition in seiner Studie zudem von mehreren, unabhängigen Personen auf Plausibilität überprüft, um somit am Ende zu größtmöglicher Objektivität zu gelangen.
Das Ergebnis seiner Berechnungen:
»Um unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Voraussetzungen mit einem Minimum an Lebensstandard leben zu können, werden rund 730 Euro monatlich benötigt. Zuzüglich der regional erheblich differierenden Wohnkosten.
Der aktuell gültige Betrag von 399 Euro hingegen reicht gerade einmal knapp dafür aus, die grundlegenden, physischen Lebensbedürfnisse abzudecken. Eine soziokulturelle Teilhabe ist damit jedoch keinesfalls möglich oder muss durch einen Verzicht physischer Notwendigkeiten schmerzhaft „gegenfinanziert“ werden.«
Nun haben wir also – ausgehend von en derzeit 399 Euro Regelsatz – das Spektrum dessen aufgemacht, dass von den Kritikern als erstrebenswert ausweisen wird: Es bewegt sich zwischen 485 Euro und 790 Euro, wohlgemerkt: Zuzüglich der zu übernehmenden angemessenen Wohnkosten.
Womit wir übrigens bei einer weiteren Problembaustelle des Grundsicherungssystem angekommen wären, die hier zumindest erwähnt werden soll: Die („angemessenen“) Kosten der Unterkunft, die übernommen werden müssen. Die Frage der „Angemessenheit“ der Unterkunftskosten ist ein leidiges Streitthema und Gegenstand vieler sozialgerichtlicher Verfahren. Denn viele Jobcenter weigern sich, bestimmte Miethöhen voll zu übernehmen und verweisen auf die Nicht-Angemessenheit. Mit gravierenden Folgen: Hartz-IV-Empfänger zahlen bei Miete mit, so hat Stefan Vetter seinen Artikel in der Saarbrücker Zeitung überschrieben. Das Problem: »399 Euro bekommt ein Hartz-IV-Empfänger, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Doch oft müssen sie davon auch einen Anteil an ihren Mietkosten zahlen.« Damit verschärft sich natürlich das bereits verhandelte Grundproblem, dass die 399 Euro an sich schon zu niedrig angesetzt sind. Jetzt wird davon also noch was abgezogen für einen anderen Bereich. Und es handelt sich hier nicht um Peanuts: »Nach einer Datenübersicht der Bundesagentur für Arbeit … mussten die Bedarfsgemeinschaften im vergangenen Jahr rund 620 Millionen Euro aus ihren Regelleistungen für die Unterbringung beisteuern … Den Daten zufolge fehlen einem Hartz-IV-Haushalt damit im Schnitt rund 16,50 Euro im Monat beziehungsweise 197 Euro im Jahr für anderweitige Ausgaben.«
Durch zu niedrige Angemessenheitsgrenzen spart der Staat auf Kosten der Betroffenen, die sich zum Beispiel beim Essen oder ihrer Mobilität einschränken müssen, um das gegenfinanzieren zu können.
Und auch in einem anderen Bereich haben die Grundsicherungsempfänger echte Probleme – bei den Stromkosten von Hartz-IV-Haushalten, die, anders als Miete und Heizkosten, nicht als sogenannte Kosten der Unterkunft gesondert gezahlt werden. »Bislang ist der Stromverbrauch Teil des Regelsatzes, aus dem auch Essen und Kleidung bezahlt werden muss. Aufgrund der gestiegenen Preise gilt als sicher, dass der im Hartz-IV-Satz eingerechnete Anteil für Strom längst nicht mehr ausreicht und die Stromrechnung zulasten anderer Ausgabenpositionen geht«, so Axel Fick in seinem Artikel Neue Hartz-IV-Sätze erst Ende 2016.
Bleibt natürlich die Frage, warum der Gesetzgeber so einen Widerstand und so eine Verzögerungstaktik an den Tag legt, wenn es um eine systematisch eigentlich gebotene Anpassung der Regelleistungen nach oben geht. Die nicht wirklich überraschende Antwort lautet natürlich: wegen der Kosten, die damit verbunden sind. Und das in mehrfacher Hinsicht.
- Die Höhe der Regelleistungen im Grundsicherungssystem hat Auswirkungen auf den Grundfreibetrag im Einkommenssteuerrecht, der sich daran orientiert – und jede Anhebung führt zu milliardenschweren Steuerausfällen. Das ist eine der wichtigsten Bremsen innerhalb des gegebenen Systems.
- Eine Anhebung hätte natürlich entsprechende Auswirkungen in der Grundsicherung für Ältere nach dem SGB XII. Angesichts der stark steigenden Altersarmut würden damit die aufstockenden Leistungen entsprechend ansteigen müssen.
- Eine mögliche Anhebung hätte natürlich auch Folgen für den „Lohnabstand“ bei den unteren Einkommensgruppen, der entsprechend verkleinert würde mit der unmittelbaren Folge, dass die Zahl der Aufstocker bei den Niedrigeinkommensbeziehern steigen würde.
- Und insgesamt ist mit der Frage der konkreten Leistungshöhe aus Sicht der verantwortlichen Politiker natürlich auch immer verbunden die Frage der gesellschaftlichen Legitimation – einmal gegenüber denjenigen, die mit ihren Steuern diese Leistungen finanzieren müssen, zugleich aber auch hinsichtlich der Signalfunktion an die Leistungsempfänger, sich nicht in dem Sicherungssystem einzurichten, sondern auch bereit zu sein, schlecht bezahlte Erwerbsarbeit aufzunehmen.
Wenn man diese Aspekte aufaddiert, dann wird verständlich, warum es so massive Widerstände gegen eine an sich gebotenen Anhebung der Leistungen gibt. Das ändert aber gar nichts an der Notwendigkeit einer sachlichen Diskussion über die Angemessenheit der Grundsicherungsleistungen.