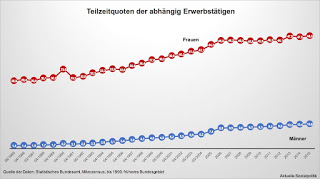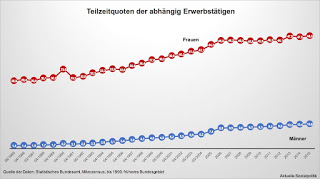Dass immer mehr wichtige Entscheidungen in der großen weiten Welt des Arbeits- und Sozialrechts auf die Letztebene des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) verlagert werden, ist mittlerweile wohl allen klar geworden. Regelmäßig werden folgenreiche Entscheidungen des EuGH in den Medien diskutiert – man denke hier nur an die Entscheidungen den Sozialleistungsanspruch von „EU-Ausländern“ in einem EU-Mitgliedsstaat betreffend ((vgl. dazu nur die Blog-Beiträge vom 17.06.2016, vom 25.02.2016, vom 02.01.2016 oder vom 06.12.2015). Die Rückwirkungen auf die Gestaltung unserer Arbeits- und Sozialsysteme sind nicht zu unterschätzen – erst jüngst konnte man das beobachten anlässlich einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zur Frage der Leiharbeitnehmereigenschaft von Rotkreuzschwestern, Das Bundesarbeitsgericht hatte die Frage, ob die deutsche Regelung zu den Rotkreuzschwestern mit der europäischen Leiharbeitsrichtlinie vereinbar ist, 2015 dem EuGH vorgelegt. Der EuGH erkannt im November 2016 (Urteil vom 17. November 2016 – C-216/15) den Sonderstatus der DRK-Schwestern nicht an, übertrug die Entscheidung aber den deutschen Richtern. Was die zwischenzeitlich gemacht haben – mit der brisanten Folge, dass die Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) nun extra für das DRK eine Rechtsänderung ins Parlament eingebracht hat, mit der die Rotkreuzschwestern quasi in eine Dauer-Leihe gegeben werden können (vgl. dazu den Beitrag Dauer-Leih-Schwestern vom DRK: Auch in Zukunft im Angebot? Da muss die Ministerin selbst Hand anlegen, um das hinzubiegen vom 1. März 2017).
Nun erreicht uns eine neue Entscheidung des hohen Gerichts. Asklepios muss eingekauften Mitarbeitern wohl weiter Tarif zahlen, so ist ein Bericht über das neue Urteil, um das es hier geht, überschrieben worden. Man merkt es schon an der Überschrift – so ganz einfach ist der Spruch des EuGH nicht zu übersetzen. Er hat aber wohl, wenn die Interpretation richtig ist, erhebliche Auswirkungen auf die nationale Rechtsprechung, in diesem Fall auf die Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts. »Das Unternehmen wird verkauft – gilt dann für die Mitarbeiter noch der alte Tarifvertrag mit all seinen Gehaltssteigerungen? Eine EuGH-Entscheidung stärkt die Rechte von Arbeitnehmern« – unter bestimmten Bedingungen zumindest.
Ein Gärtner und eine Stationshelferin haben im Tarifstreit mit einer Privatklinik in Hessen höchstrichterlichen Beistand bekommen. Zum konkreten Sachverhalt der beiden miteinander verbundenen Rechtssachen finden wir in EuGH, Urteil vom 27.04.2017, C‑680/15 und C‑681/15 die folgenden Erläuterungen:
»Die Arbeitnehmer waren im Krankenhaus Dreieich-Langen (Deutschland) beschäftigt, das damals in Trägerschaft einer kommunalen Gebietskörperschaft stand. Herr Felja ging dort seit 1978 einer Beschäftigung als Hausarbeiter/Gärtner nach, Frau Graf übte dort seit 1986 die Tätigkeit einer Stationshelferin aus. Nachdem die kommunale Gebietskörperschaft das Krankenhaus im Jahr 1995 an eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) veräußert hatte, ging der Betriebsteil, in dem die Arbeitnehmer beschäftigt waren, im Jahr 1997 auf die KLS Facility Management GmbH (im Folgenden: KLS FM) über.
Die zwischen KLS FM, die keinem Arbeitgeberverband angehörte, der an Tarifverhandlungen und der Annahme eines Tarifvertrags beteiligt war, und den Arbeitnehmern geschlossenen Arbeitsverträge enthielten eine „dynamische“ Verweisungsklausel, wonach sich ihr Arbeitsverhältnis – wie vor dem Übergang – nach dem Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe (im Folgenden BMT‑G II), aber zukünftig auch nach den diesen ergänzenden, ändernden und ersetzenden Tarifverträgen richten sollte.
Später wurde KLS FM Teil eines Krankenhaus-Konzerns.
Zum 1. Juli 2008 ging der Betriebsteil, in dem die Arbeitnehmer beschäftigt waren, auf eine andere Konzerngesellschaft, nämlich Asklepios, über. Wie KLS FM war und ist auch Asklepios bis heute nicht durch die Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband an den BMT‑G II und den diesen seit dem 1. Oktober 2005 ersetzenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und den Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts gebunden.
Die Arbeitnehmer beantragten die gerichtliche Feststellung, dass gemäß der in ihren jeweiligen Arbeitsverträgen enthaltenen „dynamischen“ Verweisungsklausel auf den BMT‑G II die Bestimmungen des TVöD und der diesen ergänzenden Tarifverträge sowie die Bestimmungen des Tarifvertrags zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts in ihrer zum Zeitpunkt ihres Antrags gültigen Fassung auf ihre jeweiligen Arbeitsverhältnisse Anwendung finden.
Asklepios vertritt die Auffassung, der nach dem nationalen Recht vorgesehenen Rechtsfolge einer solchen „dynamischen“ Anwendung der arbeitsvertraglich in Bezug genommenen Kollektivregelungen des öffentlichen Dienstes stünden die Richtlinie 2001/23 und Art. 16 der Charta entgegen. Dies führe nach dem Übergang der betroffenen Arbeitnehmer auf einen anderen Arbeitgeber zu einer lediglich „statischen“ Anwendung dieser Regelung in dem Sinne, dass nur die in dem mit dem Veräußerer arbeitsvertraglich vereinbarten Arbeitsbedingungen aus den in diesem Arbeitsvertrag genannten Kollektivverträgen dem Erwerber entgegengehalten werden könnten.«
Die Instanzen in Deutschland hatten für die Arbeitnehmer und gegen Asklepios entschieden. Die Erwartungshaltung das AuGH-Urteil betreffend wird so beschrieben:
»Beobachter hatten eher mit einer arbeitgeberfreundlichen Entscheidung der Luxemburger Richter gerechnet. Der Generalanwalt hatte argumentiert, dass Asklepios ja weder an den Tarifvertragsverhandlungen teilnehmen noch den Arbeitsvertrag der Kläger aushandeln konnte. Wäre das Gericht dieser Linie gefolgt, hätte das Bundesarbeitsgericht seine Rechtsprechung in vergleichbaren Fällen wohl geändert.«
Doch es ist anders gekommen: Beide Arbeitnehmer hatten mit ihrem ursprünglichen Arbeitgeber frei vereinbart, dass sich ihre Arbeitsverträge auch der Weiterentwicklung der damals gültigen Tarife anpassen. An diese Klauseln sei der neue Arbeitgeber gebunden, erklärte der EuGH in seinem Urteil, „sofern das nationale Recht sowohl einvernehmliche als auch einseitige Anpassungsmöglichkeiten für den Erwerber vorsieht“. Genau diesen Punkt soll nun das Bundesarbeitsgericht (BAG) für Deutschland abschließend bescheiden.
Das ermöglicht es dem BAG, an seiner bisherigen Rechtsauffassung festzuhalten: Dynamische Anpassungklauseln in Arbeitsverträgen behalten ihre Gültigkeit auch bei einem Unternehmensverkauf. »Will der neue Arbeitgeber daran etwas ändern, bleibt ihm nur, eine Änderungskündigung auszusprechen, bei der dem Arbeitnehmer ein neuer Arbeitsvertrag angeboten wird. An solche Kündigungen stellen die Gerichte aber hohe rechtliche Anforderungen. Sie sind nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig und kommen für die Unternehmen selten in Frage.«
Hier haben wir also einen „klassischen“ Fall, dass eine Grundsatzfrage auf der Ebene des EuGH entschieden wird (bzw. die Umrisse) und die nationalen Gerichte dann damit weiterarbeiten können. Der Verfahrensgang ist deshalb „klassisch“, weil die eigentlich zuständigen nationalen Instanzen durchlaufen worden sind und das höchste deutsche Arbeitsgericht eine grundlegende Fragestellung an das EuGH weitergeleitet hat mit der Bitte, diese zu klären.
Auf der Suche nach einem überhaupt zuständigen Gericht
Mit einer anderen Fallkonstellation beschäftigt sich dieser Bericht: Wo sollen wir klagen? Ryanair-Personal sucht zuständiges Gericht. Da wird sich der juristische Laie erst einmal verwundert die Augen reiben. Wieso ist das überhaupt eine Frage? »Welches Gericht ist zuständig für das Flugpersonal von Ryanair? Die arbeitsrechtlichen Verflechtungen machen die Antwort schwierig. Der Generalanwalt am EuGH hat eine Sechs-Punkte-Prüfung zur Lösung der Frage entwickelt.«
Auch hier ein Blick auf den Sachverhalt: Einige frühere Mitgliedern des Bordpersonals der irischen Ryanair wollen gegenüber der Fluggesellschaft und dem ebenfalls irischen Personaldienstleister Crewlink die Zahlung verschiedener Beträge geltend machen, unter anderem wegen nachträglicher Gehaltsanpassungen.
»Doch wo sie klagen sollen, wissen sie nicht. Denn Ryanair hatte das Flugpersonal – Staatsangehörige aus Portugal, Spanien und Belgien – entweder selbst eingestellt oder Crewlink hatte die Stewards eingestellt und an Ryanair abgeordnet. In den Arbeitsverträgen ist dabei der Flughafen Charleroi in Belgien als Heimatbasis der Arbeitnehmer angegeben. Die Arbeitnehmer waren dabei vertraglich verpflichtet, weniger als eine Stunde von ihrer Heimatbasis entfernt zu wohnen und traten am Flughafen Charleroi morgens ihren Dienst an für innereuropäische Flügen und beendeten ihn auch dort.
In den Arbeitsverträgen ist aber gleichzeitig vereinbart, dass das Gehalt auf ein irisches Bankkonto überwiesen werde, irisches Recht anwendbar sei und die irischen Gerichte für Rechtsstreitigkeiten zuständig seien. Das Arbeitsgericht Charleroi erklärte sich daher für die Klagen für unzuständig und wies sie ab.
Dagegen legten die Arbeitnehmer ein Rechtsmittel beim Arbeitsgerichtshof Mons in Belgien ein. Der legte dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) die Frage vor, wie die Verordnung Nr. 44/2001 über die gerichtliche Zuständigkeit auszulegen sei. Darin ist unter anderem geregelt, dass der Arbeitgeber auch an dem Ort verklagt werden kann, an dem der Arbeitnehmer gewöhnlich seine Arbeit verrichtet.«
Und was wird den Richtern des EuGH zur Entscheidung vorgelegt? »In seinen Schlussanträgen vom Donnerstag schlägt Generalanwalt Henrik Saugmandsgaard Øe vor, die ständige Rechtsprechung beizubehalten. Danach wäre bei Arbeitsverträgen, die im Hoheitsgebiet mehrerer Mitgliedstaaten erfüllt werden, das Gericht des Ortes zuständig ist, an dem oder von dem aus der Arbeitnehmer seine Verpflichtungen gegenüber seinem Arbeitgeber hauptsächlich erfüllt.«
Das aber hört sich einfacher an, als es wohl kommen wird, denn: Das nationale Gericht müsse diesen Ort im Licht aller relevanten Umstände ermitteln. Dabei seien vor allem diese sechs Aspekte zu berücksichtigen:
»Zunächst einmal den Ort, wo der Arbeitnehmer seine Arbeitstage beginnt und beendet. Als zweites, wo die Flugzeuge, an Bord deren er tätig ist, ihren gewöhnlichen Standort haben. Als drittes, wo er von Anweisungen seines Arbeitgebers Kenntnis erlangt und seinen Arbeitstag organisiert. Weitere Gesichtspunkte seien die Fragen, wo der Arbeitnehmer aufgrund vertraglicher Verpflichtung wohnen muss und wo sich ein vom Arbeitgeber zur Verfügung gestelltes Büro befindet. Als letztes Kriterium sei heranzuziehen, wohin sich der Arbeitnehmer im Fall der Arbeitsunfähigkeit und im Fall disziplinarischer Probleme begeben muss.«
Das hört sich wie eine große Arbeitsbeschaffungsmaßnahme an. »Der Generalanwalt ließ durchblicken, dass nach diesen sechs Kriterien viel für die Zuständigkeit der Gerichte des Ortes spricht, an dem sich der Flughafen Charleroi befindet.« Aber ob es so kommt wird erst noch zu entscheiden sein. Denn die Richter können dem Schlussplädoyer des Generalanwalts folgen, müssen das aber nicht.
Auf alle Fälle interessant – wieder einmal geht es um den Billigflieger Ryanair. Und der war in diesem Blog schon mehrfach Thema aufgrund der miesen Arbeitsbedingungen. Zuletzt in diesem Beitrag vom 25. März 2017: Das moderne Prekariat sitzt nicht (nur) in sozialen Brennpunkten. Sondern auch im Cockpit und fliegt über den Wolken.
Nachtrag: Am 28.04.2017 erreicht mich eine Mail des Pressebüros von Ryanair mit folgendem Hinweis: „Ryanair wird die unverbindliche Empfehlung des Generalanwalts zu dem aktuellen Fall am Arbeitsgerichtshof Mons untersuchen, die kürzlich bekannt gegeben wurde“, so Robin Kiely, Head of Communications bei Ryanair.