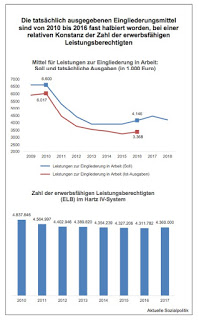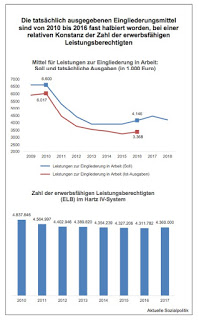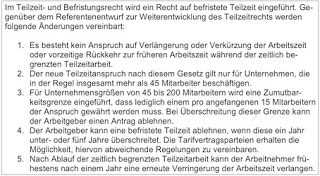Die Koalitionsverhandlungen stehen nun an und die SPD-Verhandler brauchen mit Blick auf die Ergebnisse der Sondierung einige vorzeigbare „Opfer“ von der anderen Seite (wobei die keineswegs so geschlossen ist, wie es der Medienberichterstattung zufolge erscheint). Neben dem Feld der Gesundheitspolitik nach dem Wegwischen der Forderung nach einer „Bürgerversicherung“ und dem Familiennachzug in der Flüchtlingspolitik sollen die Emissäre der SPD auch die Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen im Arbeitsrecht durchsetzen.
An dieser Stelle kann man dann auch illustrieren, dass die Gegenseite keineswegs einer Meinung ist: CDU-Arbeitnehmer schwenken auf SPD-Kurs, berichtet beispielsweise das Handelsblatt: »Der Bundesvize der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Christian Bäumler, sieht in möglichen Verhandlungen über eine erneute Große Koalition noch Spielraum für Verbesserungen im Sinne der SPD. Wie die Sozialdemokraten plädiert auch Bäumler für die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung im Arbeitsrecht … Der CDA-Vize erinnerte daran, dass sich die CDU in ihrem Wahlprogramm gegen den Missbrauch von befristeten Arbeitsverträgen ausgesprochen habe. Wer keinen unbefristeten Arbeitsvertrag habe, könne kein Wohneigentum erwerben, nicht einmal ein Autokauf auf Kredit komme in Betracht, gab Bäumler zu bedenken. „In der Phase der Familiengründung brauchen junge Menschen Stabilität“, betonte er.« Geht da noch was und wenn ja, ist es auch sinnvoll?
Immerhin etwa 2,8 Mio. Beschäftigte werden nach Daten des IAB befristet beschäftigt. Ihr Anteil an allen abhängig Beschäftigten liegt bei 8 Prozent – wobei sich das alles exakter anhört als es ist, denn die Antwort auf die Frage, wie viele denn nun befristet beschäftigt sind und wo, ist gar nicht so einfach zu geben. Das wurde hier schon in mehreren Beiträgen ausführlich erörtert. So am 11. Dezember 2017 unter der Überschrift Immer mehr befristet Beschäftigte? Kommt (nicht nur) darauf an, wie man zählt. Noch komplizierter wird es bei der Frage, ob und was man tun kann oder am 15. Juni 2017: Nicht nur Gewerkschaften sind gegen sachgrundlos befristete Arbeitsverträge. Zugleich werden sie gerne in Anspruch genommen.
Zwar zeigt sich seit 2011 ein leichter Rückgang des Anteils befristeter Beschäftigung an den abhängig Beschäftigten insgesamt, von einem signifikanten Rückgang kann man aber auch nicht sprechen, zumal die Zahl befristeter Verträge leicht zugenommen hat, was mit dem allgemeinen Anstieg der Beschäftigtenzahlen korrespondiert.
Und so richtig deutlich wird die Bedeutung des Instrumentariums der Befristungen auf dem Arbeitsmarkt, wenn man sich verdeutlicht, dass beispielsweise im ersten Halbjahr 2015 von allen Einstellungen 42 Prozent auf Basis eines befristeten Arbeitsvertrags erfolgten. Wobei man hier unterscheiden muss zwischen Befristungen mit einem gesetzlich zulässigen Sachgrund (beispielsweise einer Elternzeitvertretung) und den derzeit so im Mittelpunkt stehenden sachgrundlosen Befristungen.
Bei diesen darf der Arbeitsvertrag für maximal zwei Jahre befristet werden. In diesem Zeitraum kann der Arbeitgeber den befristeten Vertrag drei Mal verlängern. Es gibt allerdings Ausnahmen: Ein Existenzgründer kann Jobs bis zu vier Jahre befristen. Neue Verträge für Arbeitnehmer, die älter als 52 Jahre sind, dürfen sogar bis zu fünf Jahren befristet werden. Man kann erkennen, dass die Arbeitgeber hier über eine ziemlich ausgeprägte Flexibilität verfügen können. Und man sollte an dieser Stelle einfügen, wann das alles losgegangen ist – im Jahr 1985, mit dem Beschäftigungsförderungesetz des damaligen Bundesarbeitsministers Norbert Blüm (CDU). Bis dahin waren Befristungen, die über die Probezeit hinausgingen, nur zulässig, wenn ein besonderer sachlicher Grund vorlag. Allerdings galt die damals eingeführte sachgrundlose Befristungsoption von bis zu einem Jahr nur für Arbeitslose, man wollte dadurch deren (Wieder-)Einstiegsmöglichkeiten in eine neue Beschäftigung erhöhen. Später wurde das dann auf alle Arbeitnehmer ausgeweitet.
Man sollte sich nichts vormachen: Für die vielen einzelnen Betroffenen ist ein befristeter Arbeitsvertrag oftmals mit erheblichen Belastungen verbunden: So werden sachgrundlose Befristungen in der Privatwirtschaft vor allem als verlängerte Probezeit benutzt, manche werden sagen: missbraucht, denn man verlängert damit die gesetzlich ermöglichte Probezeit von sechs Monaten erheblich. Die mit Befristungen einhergehende Planungsunsicherheit kann sich negativ auf Familiengründung und Gesundheit auswirken, dafür gibt es in der Forschung auch empirische Belege. Manche Arbeitgeber nutzen Befristungen, um den allgemeinen Kündigungsschutz zu umgehen und besonders problematisch aus Arbeitnehmersicht ist sicher der Aspekt, dass sie mit der Befristung über ein Druckmittel gegenüber den Beschäftigten verfügen, vor allem, wenn sie eine spätere Übernahme in Aussicht stellen, selbst wenn sie wissen, dass die eher unwahrscheinlich ist.
Auf der anderen Seite kann man durchaus Argumente ins Feld führen, dass Befristungsmöglichkeiten die Einstiegsoptionen in eine Beschäftigung im Kontext des bestehenden arbeitsrechtlichen Systems erleichtern können. Und nicht wenige anfängliche Befristungen – vor allem in der Privatwirtschaft – münden dann auch in eine unbefristete Anstellung. An dieser Stelle muss auch dem kritischen Einwand Rechnung getragen werden, dass wir es nicht mit einem Nullsummenspiel dergestalt zu tun haben, dass eine Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen vollständig zu unbefristeten Einstellungen führen würde. Man muss, ob einem das gefällt oder nicht, immer an Ausweich- und Umgehungsstrategien der Arbeitgeber denken.
Gerade im sicherheitsorientierten Deutschland entfalten Befristungen bei den Betroffenen, aber auch bei den anderen Beobachtern oftmals eine negativ besetzte Wahrnehmungsspirale. Dabei wird zuweilen aus den Augen verloren, dass eine unbefristete Beschäftigung eben nicht automatisch eine lebenslange Beschäftigung bedeutet, man schaue sich nur die Bewegungen aus unbefristet geschlossenen Arbeitsverträgen in Arbeitslosigkeit oder auch in andere Beschäftigungen an. Und die oftmals zitierten und skandalösen Kettenbefristungen über mehrere Jahre hinweg – die wären durch eine Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen gar nicht tangiert, denn die sind mit den im Regelfall auf zwei Jahre begrenzten sachgrundlosen Befristungen gar nicht möglich. Die über viele Jahre laufenden Befristungsketten werden entweder über aneinandergereihte Befristungen mit Sachgrund oder über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz realisiert – die wären aber von einer Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen gar nicht betroffen und der Befristungswahnsinn gerade im öffentlichen Dienst könnte ohne Einschränkungen weitergehen. Apropos öffentlicher Dienst: Nicht allein an den Hochschulen hangeln sich inzwischen mehr als 90 Prozent der wissenschaftlichen Nachwuchskräfte von einem Zeitvertrag zum nächsten. Ihnen wird maximale Flexibilität abverlangt bei maximaler Unsicherheit und einem sehr überschaubaren Verdienst.
Aber man muss hier ehrlich bleiben: Auf der einen Seite haben wir hier die sichersten und – nicht nur bei Beamten – mit Unkündbarkeit ausgestattete Arbeitsplätze, auf der anderen Seite reagiert das System darauf spiegelbildlich mit der Schaffung einer hochgradig flexibilisierten Schicht an Beschäftigten, wo im starken Maße mit Befristungen gearbeitet wird (und aus Systemsicht gearbeitet werden muss) und in denen der Unsicherheitsfaktor kombiniert wird mit ausgeprägter Perspektivlosigkeit, was Anschlussoptionen angeht. Aus der Sicht der betroffenen Verwaltungen ist das aber irgendwie auch zwingend, denn eine grundsätzlich denkbare unbefristete Einstellung ist deshalb ein „Risiko“, weil der Arbeitgeber den Beschäftigten nicht wieder entlassen kann, wenn beispielsweise keine Mittel mehr zur Verfügung stehen für den besonderen Bereich, in dem die Stelle geschaffen wurde. Im Befristungsrecht gibt es für die öffentlichen Arbeitgeber als einen zulässigen Sachgrund die „Befristung wegen befristeter Haushaltsmittel“. Das wäre von einer Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen gar nicht tangiert.
»Sollte also alles so bleiben, wie es ist? Nein. Denn die Kritiker der derzeitigen Befristungspraxis haben ja ernst zu nehmende Argumente. Befristungen bedeuten in vielen Fällen Unsicherheit und Härte für die betroffenen Arbeitnehmer. Das sollte soweit möglich vermieden werden – mit wirksamen Anreizen.«
Der Mann ist Volkswirt und man kann sich denken, dass er auf der Suche nach Anreizen ist, die dem Denken der Ökonomen mehr entsprechen. Und man liegt genau richtig, wenn man an dieser Stelle den Blick auf die monetäre Dimension erwartet. Und er ist fündig geworden bei seiner Suche:
»Die Ökonomen Christian Hohendanner und Karl Heinz Hausner schlagen vor, die Arbeitgeber für Beschäftigte mit befristeten Verträgen höhere Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zahlen zu lassen. Dafür könnten die Beiträge für unbefristet Beschäftigte sinken. Überzeugend wäre auch folgende Variante: Die Arbeitgeber sollten bei sachgrundlosen Befristungen die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung allein tragen.«
Offensichtlich bezieht er sich dabei auf diesen Beitrag: Karl Heinz Hausner und Christian Hohendanner (2017): Der Flexibilitätsbeitrag in der Arbeitslosenversicherung, in: Wirtschaftsdienst, Heft 6/2017: »Um die Befristung von Arbeitsverträgen einzudämmen, ließen sich flexible Arbeitgeberbeiträge in der Arbeitslosenversicherung einführen. Der Beitragssatz für befristet Beschäftigte würde steigen und im Gegenzug für die Unbefristeten leicht fallen. Vier Varianten werden berechnet: beitragsaufkommensneutral, generelle Beitragssenkung und zwei Varianten ausschließlich für sachgrundlos befristet Beschäftigte. Ein solches Vorgehen berücksichtigt das höhere Risiko zukünftiger Arbeitslosigkeit bei befristet Beschäftigten besser als bisher und schafft monetäre Anreize für die Arbeitgeber, Arbeitnehmer vermehrt unbefristet einzustellen«, so heißt es in ihrer Zusammenfassung.
Übrigens ist eine solche Staffelung der Beiträge nach dem Beitrag zu Schadensfällen der deutschen Sozialversicherung nicht völlig fremd – man nehme nur die oftmals übersehene Gesetzliche Unfallversicherung, die übrigens ausschließlich über Arbeitgeberbeiträge finanziert wird: Wie bei den anderen Sozialversicherungen ist die Beitragshöhe auch bei der gesetzlichen Unfallversicherung von der Lohnsumme der Beschäftigten (Löhne und Gehälter) und den Ausgaben der gesetzlichen Unfallversicherung abhängig. Zusätzlich spielt auch das Unfallrisiko im jeweiligen Gewerbe eine Rolle – ausgedrückt durch die Gefahrklasse. So ist natürlich ein Büroarbeitsplatz weniger risikoträchtig als die Arbeit auf einer Baustelle. Insofern müssen die Unternehmen der Baubranche auch höhere Beiträge leisten.
Würde man ein „experience rating“-Modell in der deutschen Arbeitslosenversicherung einführen, dann hätte das enorme Auswirkungen in der konkreten Beitragslandschaft. Man kann sich das an einem plastischen Beispiel verdeutlichen: Heutzutage zahlen Banken und der öffentliche Dienst für seine Angestellten die gleichen relativen Beiträge an die Bundesagentur für Arbeit wie Unternehmen der Leiharbeitsbranche oder aus der Gastronomie. Bei den letztgenannten sind aber die Entlassungen weitaus häufiger als bei den erstgenannten Branchen.
Wer das genauer wissen möchte, der möge sich diese Studie anschauen: Gesine Stephan (2016): Beschäftigung vor und nach dem Arbeitslosengeldbezug: Die Hälfte der Zugänge und Abgänge entfällt auf acht Branchen. IAB-Kurzbericht Nr. 25/2016, Nürnberg: »Im Jahr 2013 kam die Hälfte aller untersuchten Zugänge (aus Beschäftigung) in den Bezug von Arbeitslosengeld I aus acht Branchen. Diese acht Wirtschaftsabteilungen beschäftigten zusammen knapp ein Drittel aller Arbeitnehmer. Die untersuchten Arbeitslosengeld-I-Bezieher arbeiteten zuvor zu gut drei Vierteln in Vollzeit … Unter allen Vollzeitbeschäftigten lag der Anteil der Geringverdiener im Jahr 2013 mit 20 Prozent deutlich niedriger. Jede fünfte Person, die Arbeitslosengeld I bezog und innerhalb eines Jahres einen neuen Job aufnahm, kehrte zu dem vorherigen Arbeitgeber zurück. Überproportional oft geschah dies in der Branche Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation, sonstiges Ausbaugewerbe sowie in der Gastronomie.«
Wie unter einem Brennglas kann man an den wenigen Zahlen erkennen, welche enormen Umverteilungen es innerhalb bzw. durch die Arbeitslosenversicherung gibt. Eine des Entlassverhalten berücksichtigende Beitragsbemessung würde zu erheblichen Verschiebungen führen – zu massiven Entlastungen für die einen und entsprechenden Belastungen der anderen Unternehmen. Diese Aspekte und die möglichen Folgen wurden in der Vergangenheit immer mal wieder diskutiert, vor allem finden 1990er und Anfang der 2000er Jahre, vgl. dazu nur als ein Beispiel den Beitrag von Joachim Geoosko, Georg Hirte und Reinhard Weber: Quersubventionierung in der Arbeitslosenversicherung, in: Wirtschaftsdienst, Heft 1/1999. Aber den eher akademischen Diskurs hat das „experience rating“ nie verlassen – auch nicht in anderen europäischen Ländern (vgl. dazu nur als ein Beispiel aus dem Jahr 2010 bei der Debatte über eine Reform der Arbeitslosenversicherung in der Schweiz den Beitrag Kostspielige Umverteilung in der Arbeitslosenversicherung von George Sheldon, der für ein solches Modell geworben hat). Ob bewusst oder unbewusst sicher auch wegen den Folgen für ein solidarisch angelegtes Umverteilungssystem wie der Arbeitslosenversicherung. Man bedenke die vielen offenen Anschlussfragen, die sich hier ergeben würden: Beispielsweise die Frage nach den teilweise erheblichen regionalen Umverteilungseffekten der bestehenden Arbeitslosenversicherung (eine Debatte, die sich daran aufgehängt hat, kennen die älteren Semester unter dem Stichwort der „Regionalisierung der Sozialversicherung“). Auch sollte man immer bedenken, ob die – möglichen? – Vorteile einer solchen Systemumstellung die damit verbundenen Kosten bei der bürokratischen Abwicklung des Ansatzes wirklich übersteigen würden.
Davon abgesehen hat Joachim Möller den Hinweis auf den Ansatz eines „Flexibilitätsbeitrags in der Arbeitslosenversicherung“ sogleich und nicht wirklich konsequent begrenzt auf den Aspekt der Zahl der sachgrundlos befristet Beschäftigten, für die dann die Arbeitgeber etwas höhere Beiträge leisten müssten. Nun sind für die Arbeitgeber immer am Ende die Arbeitskosten insgesamt relevant und in deren Kontext spielen die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung eine nun wirklich überschaubare Rolle. Natürlich würden sich die Unternehmen ärgern, wenn sie etwas mehr bezahlen müssten, aber ob das wirklich zu einer deutlichen Begrenzung der sachgrundlosen Befristungen führen würde, beispielsweise bei den Berufsanfängern, die man in einer verlängerten Probeschleife halten möchte? Man darf erhebliche Zweifel haben.
Zugleich öffnet man damit wie angedeutet eine Diskussionslandschaft über strukturelle Fragen der Sozialversicherung, die sich im Nachhinein als fatal erweisen könnten. Man muss an dieser Stelle auf ein anderes Ergebnis aus den Sondierungsgesprächen verweisen, dass ebenfalls sicher gut gemeint daherkommt, sich aber aus systematischer Sicht als hochproblematisch erweisen könnte. Im Ergebnispapier der Sondierer findet man diesen Passus: »Wir wollen die schrittweise Einführung von kostendeckenden Beiträgen zur Gesetzlichen Krankenversicherung aus Steuermitteln für die Bezieher von ALG II.« Schon ein langem wird beklagt, dass der pauschalierte Betrag, der für Hartz IV-Bezieher an die GKV überwiesen wird, zu niedrig dimensioniert sei. Der würde nicht die Kosten decken. Nun muss man aber berücksichtigen, dass eine Kostendeckungsrechnung für einzelne Teilgruppen unter den Versicherten bislang gerade nicht in der GKV vorgenommen wurde und wird. Wenn man bei den Hartz IV-Beziehern nun anfängt, warum dann nicht auch über die Deckungsbeiträge der Raucher, der gelenk- und sonstiges verschleißenden Extremsportler oder angesichts der ungleichen Kostenverteilung über Männer und Frauen sprechen? Wo fängt das an und wo soll das aufhören?
Wenn das nicht wirklich überzeugend ist, dann bleibt die Frage einer möglichen Abschaffung der Möglichkeit einer sachgrundlosen Befristung eben am Ende „nur“ eine primär politische (bzw. eine politpsychologische) Frage. Weil man signalisieren will, wir tun was. Wenn man aber nicht gleichzeitig erhebliche Veränderungen bei den gesetzlich weiter zulässigen Befristungen mit Sachgrund vornimmt, dann wird es erwartbar zahlreiche Ausweichreaktionen eines Teils der Arbeitgeber geben, die man in Rechnung stellen muss. Und natürlich hängen die meist isoliert diskutierten Dinge zusammen, gerade in der Sozialpolitik: Sollte es beispielsweise wirklich ein großzügig ausgestaltetes – und nicht wie derzeit von den Sondierern angedacht ein sehr restriktiv konfiguriertes – Rückkehrrecht für diejenigen Arbeitnehmer geben, die befristet von Vollzeit auf Teilzeit reduzieren, dann müsste es einen starken Anstieg der befristeten Arbeitsverträge (hier mit Sachgrund) geben müssen für die Zeit der Reduktion der Arbeitszeit durch die bisherigen und weiterhin an Bord bleibenden Insider. Worüber sich dann auch wieder viele aufregen werden. Man kann das machen, aber man sollte den Menschen nicht wirklich versprechen, dass dann wirklich etwas substanziell besser werden würde. Für den einen oder anderen möglicherweise und sogar sicher, aber nicht im Gesamtsystem.