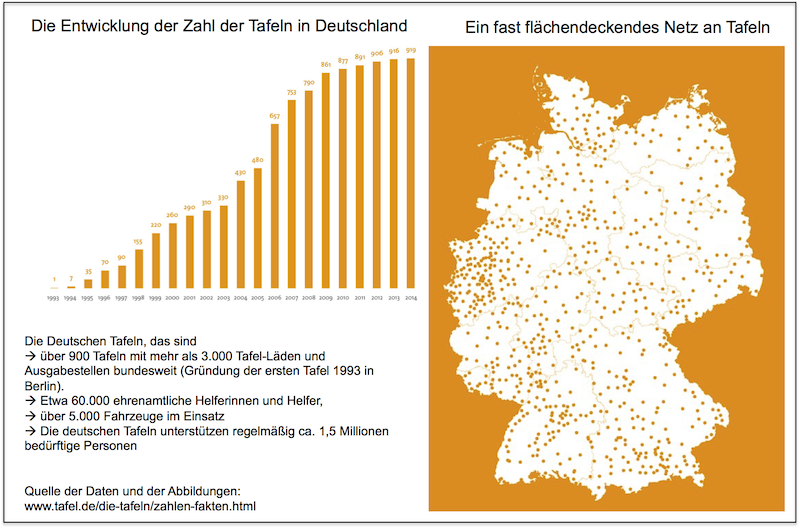Es geht um Berlin und um eine Fallstudie aus der Hauptstadt der Wohnungsnot. Mit fast 10.000 Räumungsklagen pro Jahr sei Berlin die Hauptstadt der Wohnungsnotlagen, kann man einer neuen Untersuchung entnehmen. Zwangsräumungen und die Krise des Hilfesystems, so ist die Studie von Andrej Holm, Laura Berner und Inga Jensen betitelt worden. Die Arbeit untersucht die wohnungswirtschaftlichen Kontexte von Zwangsräumungen und die Funktionsweise des institutionellen Hilfesystems in Berlin. Sie eröffnet einen umfassenden Einblick in die Berliner Situation von Zwangsräumungen und erzwungenen Umzügen. Eine bedeutsame Rolle bei der Arbeit der Stadtsoziologen spielt der Begriff der „Gentrifizierung“. »Der Begriff Gentrifizierung wurde in den 1960er Jahren von der britischen Soziologin Ruth Glass geprägt, die Veränderungen im Londoner Stadtteil Islington untersuchte. Abgeleitet vom englischen Ausdruck „gentry“ (= niederer Adel) wird er seither zur Charakterisierung von Veränderungsprozessen in Stadtvierteln verwendet und beschreibt den Wechsel von einer statusniedrigeren zu einer statushöheren (finanzkräftigeren) Bewohnerschaft, der oft mit einer baulichen Aufwertung, Veränderungen der Eigentümerstruktur und steigenden Mietpreisen einhergeht … Im Zusammenhang mit dem Aufwertungsprozess erfolgt oft die Verdrängung sowohl der alteingesessenen, gering verdienenden Bevölkerung als auch von langansässigen Geschäften, die dem Zuzug der neuen kaufkräftigeren Bevölkerung und deren entsprechend veränderten Nachfrage weichen müssen«, so das Deutsche Institut für Urbanistik (DIFU) in dem Beitrag Was ist eigentlich Gentrifizierung?
In diesem Zusammenhang wird es dann auch verständlich, warum in der Berichterstattung von „schweren Vorwürfen“ gesprochen wird, die von den Wissenschaftlern erhoben werden: »Es sind schwere Vorwürfe, die ein Team von Berliner Soziologen gegen die Jobcenter erhebt: Nach ihren Forschungen gehören die Jobcenter zu den „Motoren von Verdrängung und Zwangsräumung“. Und die Wissenschaftler haben noch einen zweiten Aktivisten der Gentrifizierung ausgemacht«, kann man dem Beitrag Studie: Jobcenter beschleunigen Gentrifizierung entnehmen. Was nun haben die Jobcenter damit zu tun?