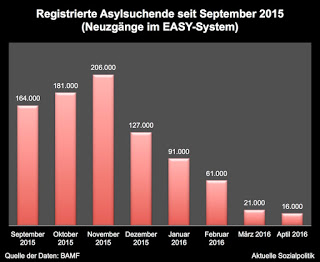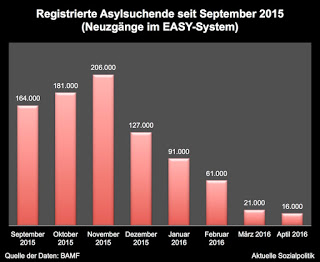In mehreren Beiträgen wurde hier bereits auf eine gefährliche Entwicklungslinie in der Krankenversicherungswelt aufmerksam gemacht: So wurde am 12. Juli 2015 der Beitrag Die Entsolidarisierung kommt auf leisen Sohlen, oftmals unbeachtet, weil so abseitig, dann aber Fahrt aufnehmend und ein ganzes System verändernd. Beispielsweise die Krankenversicherung veröffentlicht. Daran anschließend am 14. August 2015 der Artikel Schöne neue Apple-Welt auf der Sonnenseite der Gesundheitskasse? Ein Update zur schleichenden Entsolidarisierung des Versicherungssystems. Und aus dem laufenden Jahr sei auf diesen Beitrag hingewiesen, in dem auch das „Rutschbahn-Bild“ schon in der Überschrift auftaucht: Das war ja zu erwarten. Krankenkassen wollen Fitnessdaten nutzen. Auf der Rutschbahn in eine Welt, die nur am Anfang nett daherkommen wird vom 9. Februar 2016. Der Kern des kritischen Blicks auf die Entwicklung im Bereich der individuellen Gesundheitsdaten und des (möglichen) Zugriffs der Krankenkassen darauf wurde in diesem Interview mit mir herausgearbeitet: „Eine fundamentale Endsolidarisierung“. Krankheiten sind nicht nur Ausdruck der eigenen Lebensführung. Bezugnehmend auf das wachsende Interesse der Versicherungswirtschaft, künftig auf die mit Fitnessarmbändern, Smartphone oder Smartwatch gewonnenen Gesundheitsdaten der Versicherten zugreifen zu wollen – wobei das gerade am Anfang nur positiv verkauft bzw. verpackt wird, um das (mögliche) eigentliche, langfristige Interesse zu überdecken (vgl. dazu nur als ein Beispiel so ein Artikel: Jeder Vierte läuft mit digitalem Fitness-Helfer: »Digitale Trainingsunterstützung liegt im Trend – und das nicht nur bei der technikaffinen Jugend, sondern auch bei älteren Menschen.
Insbesondere in der Reha könnten Apps & Co. zur Motivation beitragen.« Wer kann was dagegen haben, wenn die Effektivität der Reha-Maßnahmen durch diese neue Instrumente verbessert wird? Das nützt doch den Patienten – sei hier auf mein Hauptargument verwiesen:
»Wir werden auf eine Rutschbahn nach unten gesetzt. Am Ende steht die Verwirklichung einer radikalen Individualisierung der Krankenversicherung, bei der immer passgenauer nach »guten« und »schlechten« Risiken differenziert werden kann. Wobei die Definition von Risiken von übergeordneten, der Schadensökonomie verpflichteten Maßstäben bestimmt sein wird.« Und weiter hinsichtlich des derzeit bei der Verkaufe der neuen Ansätze als positiv daherkommendes eingesetzte Argument, dass das ein positiver Ansatz sei, weil man doch die individuelle Gesundgerhaltung und Vermeidung von Krankheitsfällen fördere: Das setzt voraus, »dass „Gesundheit“ bzw. „Krankheit“ ausschließlich individuell determiniert und dann auch noch durch persönliche Aktivitäten beeinflussbar ist. Aber viele Erkrankungen sind genetisch oder – weitaus komplexer und gefährlicher für die Betroffenen – durch die Lebenslagen bestimmt. Im Ergebnis muss das dazu führen, dass die „guten Risiken“ auch noch finanziell entlastet und die anderen noch stärker belastet oder gar irgendwann einmal ausgeschlossen werden. Der Sozialversicherungscharakter würde so ad absurdum geführt.«
Ein wichtiges Argument, warum die Versicherungswirtschaft so ein Interesse an dieser Entwicklung haben muss, lautet: Es »ist auf alle Fälle versicherungsbetriebswirtschaftlich überaus rational, denn durch die umfassende Preisgabe immer mehr persönlicher Messwerte verlieren die Versicherten ihren »Vorteil«, mehr über sich zu wissen als die Versicherungen – das war und ist bislang das größte Hindernis für eine risikobezogene Differenzierung der Beiträge.«
Wir sind in diesem Fall konfrontiert mit einer echten versicherungsökonomischen Herausforderung, auch bekannt als „asymmetrische Information“ zwischen den Versicherten und den Versicherungsunternehmen, die im Fall der privaten Krankenversicherungen – wenn überhaupt – nur in der Lage sind, wahrscheinlichkeitsstatistisch abgeleitete Aussagen über das Kollektiv oder eine bestimmte Kohorte machen zu können. In diesem Kontext wird dann auch verständlich, warum man so ein großes Interesse an der elektronischen Patientenakte und den dort abgelegten Daten über die individuelle Krankheitsbiografie hat oder haben könnte – und warum es in dieser Systemlogik „wunderbar“ wäre, wenn die individuellen Daten zu dem, was schon passiert ist, verknüpft werden könnten mit Daten zum Lebenswandel, aus denen man individuelle Risikoprofile für die Zukunft ableiten könnte:
»Die eigentliche Herausforderung ist die elektronische Patientenakte: Man muss man verhindern, dass die Krankheitsbiographie – und die Lebensstildaten – hier abgelegt werden. Wenn das erst einmal passiert, dann bekommt man die Verwertungs- und Missbrauchsinteressen kaum noch in den Griff. Es beginnt mit Beitragsvorteilen für die einen und wird in einer fundamentalen Entsolidarisierung der Krankenversicherung enden.«
Offensichtlich stehe ich nicht allein mit dieser für den einen oder anderen gerade in der aktuellen Frühphase der Entwicklung eher übertrieben bis apokalyptisch daherkommenden Sichtweise auf ein Feld, das derzeit doch ganz überwiegend und gestützt von entsprechenden Marketingaktivitäten als eine „schöne neue Welt“ der individuellen Gesundheitsoptimierung gemalt wird.
Nicola Jentzsch vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin hat das Anfang Februar 2016 in ihrem Kommentar Auflösung der Privatsphäre – Ende der Solidarität? aufgegriffen und mit er ökonomischen Diskussion verzahnt:
»Ökonomen kennen die scheinbar freiwillige Offenlegung ökonomisch relevanter Informationen seit den 80er Jahren aus Signalspielen. Sie ist unter dem Namen Unraveling (englisch für Auflösung, Aufdeckung) bekannt. Sobald Akteure einen Anreiz haben, verifizierbare Informationen offenzulegen, werden die „besten Typen“ (jene mit besonders gutem Signal) dies auch tun. Dies wären im Versicherungsbeispiel alle aktiven Sportler. Jeder, der nicht offenlegt, wird mit den „schlechten Typen“ in einen Topf geworfen und muss einen höheren Preis bezahlen. Um dies zu verhindern, werden immer mehr Menschen ihre Daten preisgeben, schon weil sie sich hohe Tarife nicht leisten können oder wollen.«
Und sie verweist auf die großen „Fragen nach Gerechtigkeit, Fairness und Solidarität in Bezug auf Unraveling“, wenn sie schreibt:
»So besteht die Gefahr, dass für manche Versicherten die Preise durch die zunehmende Tarifdifferenzierung steigen. Sollte dies eintreten, wäre zu fragen, wieviel Solidarität und Privatsphäre wir Effizienzgewinnen opfern wollen. Zwei Beispiele hierzu. Eine alleinerziehende, erwerbstätige Mutter mit zwei Kindern wird wohl kaum die Zeit und Energie finden, fünf Mal die Woche zu trainieren. Soll sie statt beim Fitnesstraining bei der Hausarbeit überwacht werden? Ein sehr fitter Sportler, der einen Ermüdungsbruch erleidet und auf ärztlichen Rat hin nicht mehr fünf Mal die Woche trainiert (obwohl er gerne würde und dies in der Vergangenheit nachweislich getan hat), soll der ab jetzt mehr bezahlen? Wie weit soll Personalisierung in diese Lebenssituationen vordringen?
Ist der Unraveling-Prozess einmal in Gang gekommen, ist er nur schwer aufzuhalten, zumal Offenlegung zu einer sozialen Norm werden könnte, sobald das Gegenteil mit Stigma belegt ist.«
Nun wird der eine oder andere einwenden: Alles Theorie und Spekulation. Gibt es denn schon heute Hinweise aus der Realität, die das angesprochene Gefahrenpotenzial belegen können?
Die gibt es, in Form vieler Indizien, die man zitieren kann, wenn man will. Eine kleine Auswahl – mit einem besonderen Blick auf die Problematik, die sich aus einer sukzessive im Ausbau befindlichen zentralen Speicherung individueller Daten ergeben (können), wo die „Lebensstil“-Daten, die über Apps und andere Formen erhoben werden, nur ein Teil der relevanten Datensammlung darstellen:
Die Nachrichtenagentur dpa berichtete am 12. März 216: Datenleck bei der Barmer – Krankenkasse widerspricht:
»Bei Deutschlands zweitgrößter Krankenkasse Barmer GEK gibt es nach einem Bericht der „Rheinischen Post“ ein Datenleck. Unbefugte können demnach durch das Vortäuschen einer falschen Identität mit wenigen Telefonaten und ein paar Mausklicks Details zu Diagnosen, verordneten Arzneien, Klinikaufenthalten und andere intime Informationen abfragen. Einem von der Zeitung beauftragten Tester sei es gelungen, sich über einen Online-Zugang der Kasse in Patientendaten einzuloggen.«
Jeder, der sich mit den modernen Datensystemen etwas intensiver beschäftigt hat, weiß um die Fragwürdigkeit, wenn nach außen Sicherheitsgarantien abgegeben werden, dass man nicht auf personenbezogene Daten zugreifen könne (und damit ist noch nicht einmal das langfristige Risiko angesprochen, dass sich aus solchen Datensammlungen ergeben könnte, wenn denn einmal die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen für die (bisherige Nicht-)Nutzung verschoben werden).
Ein weiteres Beispiel aus der realen Welt: Am 25. Februar konnten man in der Print-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung diesen Artikel von Claus Hulverscheidt lesen: „Plötzlich drogensüchtig. Patientendaten-Klau in den USA zeigt Risiko der Gesundheitskarte“. Zeitgleich erschien in der FAZ dieser Beitrag: „Hacker erbeuten Patientenakten. Schaden von 20 Milliarden Dollar / Der Schwarzmarkt blüht“. Was ist passiert? Dazu Hulverscheidt:
»Der sogenannte Identitätsdiebstahl ist in den USA schon länger einer der am schnellsten wachsenden Kriminalitätsbereiche – nun aber erreicht er eine neue, manchmal lebensgefährliche Dimension: Immer öfter werden die Daten von Krankenversicherten entwendet, die seit Inkrafttreten der großen Gesundheitsreform von 2010 elektronisch gespeichert werden. Weit mehr als 2,3 Millionen Amerikaner sind nach einer Studie des Forschungsinstituts Ponemon von den Diebstählen betroffen. Auch für die deutschen Behörden, die seit Jahren die Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte für die Krankenversicherten vorantreiben, ist das eine alarmierende Nachricht.
„Der Raub medizinischer Identitäten bringt Kriminellen heute erheblich mehr Geld ein als etwa der Klau von Bankdaten“, sagt Ann Patterson von der Verbraucherschutzorganisation Medical Identity Fraud Alliance. Wichtigster Grund: Während sich Scheck- oder Kreditkarten bei einem Betrugsverdacht rasch sperren lassen, fällt der Diebstahl einer medizinischen Identität oft monatelang nicht auf. In dieser Zeit ordern die Diebe in großem Stil rezeptpflichtige Medikamente, die sie weiterverhökern, etwa an Drogensüchtige. Andere verkaufen die Identitäten an Kranke, die sich keine Versicherung leisten können, wieder andere rechnen Leistungen ab, die niemand erhalten hat, oder erschwindeln staatliche Zuschüsse.«
Und das hat heute schon in den USA ganz handfeste Konsequenzen für die davon Betroffenen:
»Erfährt der betroffene Patient von dem Diebstahl, etwa bei der Quartalsmitteilung seines Versicherers, hat er oft größte Mühe, die korrekten und die fälschlich unter seinem Namen abgerechneten Posten wieder voneinander zu trennen. In zwei Dritteln aller Fälle bleibt er auf einem Teil des Schadens sitzen, laut Ponemon-Studie sind es im Schnitt 13500 Dollar. Manche Patienten gelten plötzlich als Drogensüchtige oder als Raucher, doch selbst damit nicht genug: Durch die Vermischung von echten und gefälschten Krankendaten kommt es zu Fehldiagnosen, Behandlungsfehlern und anderen gravierenden Gesundheitsgefahren. „Im schlimmsten Fall erhält jemand bei einem Unfall eine Bluttransfusion der falschen Blutgruppe, weil seine Daten geändert wurden“, sagt Steve Weisgerber, Jura-Professor an der Bentley-Universität in Massachusetts.«
Aber die elektronische Patientenakte bei uns in Deutschland wird sicher ganz sicher sein.
Und auf eine komplementäre Entwicklung hinsichtlich der Individualisierung und einer damit einhergehenden Verhaltens- und Tarifdifferenzierung in „gute“ und „schlechte“ Risiken in einem anderen Zweig der Versicherungswirtschaft muss hier hingewiesen werden – und wir erkennen die gleichen Strukturmuster wie im Bereich der Krankenversicherungen:
Philipp Seibt, Fabian Reinbold und Florian Müller haben ihren Artikel kurz und knapp so überschrieben: Daten her, Geld zurück: »Ob Auto oder Gesundheit: Immer mehr Versicherer bieten Überwachungs-Tarife an. Wer sich ausspähen lässt und brav ist, zahlt weniger.« Immer mehr Versicherungen bieten ihren Kunden Daten-Deals an, bei denen für die Überwachung Rabatte winken. Das könnte letztlich zum Problem werden für die, die ihre Daten nicht preisgeben wollen.
»Nun hat die größte deutsche Versicherung Allianz ihren ersten sogenannten Telematik-Tarif für die Kfz-Versicherung vorgestellt. Dabei geht es um die Kontrolle des Fahrverhaltens und einen Bonus für vorsichtiges Fahren. Es ist ein Zeichen: Nach einigen kleineren Versicherungen setzt nun auch der Marktführer auf die Daten der Kunden. Die Versicherer haben mit ihren Produkten insbesondere eine junge, technikaffine Zielgruppe im Blick. Da ist vom „Spartarif“ die Rede, von „Preisnachlässen“, „Prämien“ und „Belohnungen“. Zur Zielgruppe passt es, dass viele Angebote mit Smartphone-Apps funktionieren.«
Und auch der größte deutsche Autoversicherer – gemessen an der Zahl der Versicherten – hat sich hier positioniert: Am 21.04.2016 konnte man der Print-Ausgabe der FAZ diesen Artikel entnehmen: „HUK-Coburg durchleuchtet Autofahrer“. Für die bedeutet das neue Angebot neben dem Einbau einer kleinen schwarzen Box ins eigene Auto: »Um den Vorteil eines günstigeren Tarifs zu erhalten, müssen sie einwilligen, dass die Black Box rund um die Uhr Daten über den Fahrstil sammelt, dass permanent aufgezeichnet wird, wie stark der Fahrer beschleunigt oder wie rasant er die Kurven nimmt. Aus alledem errechnet die Versicherung einen Punktewert, der in die Versicherungsprämie einfließt.«
Bei der Kfz-Versicherung lassen sich so bis zu 40 Prozent der Versicherungsprämie sparen. Hört sich doch erst einmal nach einem guten Geschäft an, aber: Die Kopplung der Versicherungsprämie an die Herausgabe von Daten kann problematisch werden, »wenn es kein Bonus mehr ist für die, die mit freiwilliger Einwilligung mitmachen, sondern ein Malus für die, die nicht mitmachen wollen«, wird die Datenschutzbeauftragte des Landes NRW, Helga Block, zitiert.
»Zugespitzt formuliert: Wenn alle gesunden, sportlichen Vorzeige-Autofahrer im Daten-Tarif sind, dann bleiben in den normalen Tarifen nur noch die rauchenden Raser übrig – und die, die ihre Daten nicht hergeben wollen. Für die könnte es dann langfristig teurer werden«, so Seibt et al. in ihrem Artikel.
Man könnte diese Liste mühelos verlängern. Zumindest sind das wichtige Hinweise darauf, dass man diesen Entwicklungen, gerade weil sie am Anfang so positiv daherkommen und kommuniziert werden und bei vielen individualisierten Menschen sicher auch auf fruchtbaren Boden fallen, kritisch-reflektierend gegenüber stehen sollte.
Berichte aus der Welt der Privaten Krankenversicherung (PKV) verdeutlichen, wie anschlussfähig das Thema ist hinsichtlich der strategischen Ausrichtung, die dort diskutiert oder vorhergesehen wird. Dazu beispielsweise der Artikel PKV sieht sich als Gesundheitscoach: »Tarife von der Stange? Die wird es in der PKV nach einer Studie künftig nicht mehr geben. Die Branche setzt vielmehr auf individuelle Tarife und Gesundheitscoaching.« Und aus einer Studie zur Zukunft der PKV, erstellt vom Software-Hersteller Adcubum und dem Assekuranz-Dienstleister Versicherungsforen Leipzig, wird das zitiert: »Etwas mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer hält es für wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich, dass sich die Produkte der Krankenversicherer weg von starren Tarifen hin zu personenbezogenen Tarifen bewegen, bei denen die Tarifierung auf den zur Verfügung gestellten Gesundheitsdaten basiert.«
Eine kritische Perspektive taucht auch immer öfter im politischen Raum auf: Unter der Überschrift Geld gegen Gesundheitsdaten berichtet der Deutschlandfunk: »Erste Krankenkassen bieten sie bereits an: Boni-Programme für Kunden, die mit Fitness-Apps jeden Klimmzug vermessen. Nicht nur bei Datenschützern sind die Anwendungen umstritten. Für klare Regeln setzen sich auch Gesundheitsexperten im Bundestag ein.« Und weiter erfahren wir:
»Die Entwicklung ruft Datenschützer wie Gesundheitspolitiker auf den Plan. Experten von Bund und Ländern warnten am Donnerstag auf einer Konferenz in Schwerin vor „Risiken, insbesondere für das Persönlichkeitsrecht“. Zahlreiche Gesundheits-Apps und andere Fitness-Tracker gäben die aufgezeichneten Daten an andere Personen oder Stellen weiter, ohne dass die Nutzer hiervon wüssten, heißt es in einer Erklärung der Datenschutz-Beauftragten.
Auch die gezielte Nutzung solcher Daten durch Krankenkassen stößt bei den Bund-Länder-Experten auf Vorbehalte: Die Konferenzteilnehmer rufen die Politik auf zu prüfen, ob im Zusammenhang mit Fitness-Apps und anderen Geräten zur Selbstvermessung „die Möglichkeit beschränkt werden sollte, materielle Vorteile von der Einwilligung in die Verwendung von Gesundheitsdaten abhängig zu machen“. Im Klartext: Ob das Tauschgeschäft Daten gegen Prämien gesetzlich geregelt werden muss.«
Die in dem Zitat angesprochene Entschließung der Datenschutz-Beauftragten geht zurück auf die 91. Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder am 6./7. April 2016 und ist überschrieben mit: Wearables und Gesundheits-Apps – Sensible Gesundheitsdaten effektiv schützen!
Für die Wissenschaft tun sich hier übrigens ganz neue und spannende Forschungsfragen und damit neue Betätigungsfelder auf: Wie werden die Menschen mit der zunehmenden individualisierenden datentechnischen Abbildung ihres Lebens umgehen, wenn ein Teil von ihnen begriffen hat, in welches Korsett sie hier gelockt worden sind bzw. werden? Wird es Umgehungsstrategien geben, werden sie manipulativ gegenzusteuern versuchen? Was ist mit denen, die sich entziehen (wollen)? Kann sich eine „Meine Daten gehören mir“-Bewegung überhaupt noch geben in Zeiten von Facebook & Co.? Fragen über Fragen.