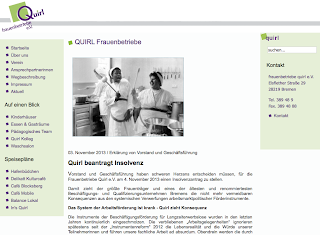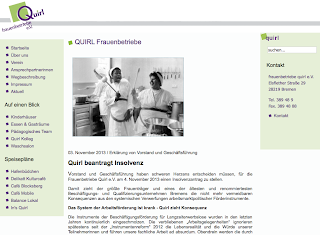Wie jedes Jahr im November haben die so genannten „fünf Wirtschaftsweisen“ ihr voluminöses Jahresgutachten vorgelegt. Eigentlich sollen die ja eine Prognose geben, wie sich die Wirtschaft in den vor uns liegenden Monaten entwickeln wird. Aber sie haben im Laufe der Jahre ihren Auftrag immer weiter ausgedehnt und so nehmen die „weisen Ökonomen“ alles vor die Flinte, was sie für relevant halten. Da kann und darf es nicht überraschen, dass sie sich in diesem Jahr auch dem Mindestlohn „zuwenden“, wobei man das rein als Richtungs-Begriff verstehen sollte, nicht aber so, wie wir umgangssprachlich Zuwendung verstehen würden. Denn – so wird es morgen in allen Zeitungen stehen und so kann man es heute am Tag der Verkündigung auch schon online lesen – der Mindestlohn ist schlecht. So packt beispielsweise die FAZ den ganzen Geist, den das diesjährige Jahresgutachten atmet, in die Artikelüberschrift „Mit Umverteilen und Ausruhen ist es nicht getan„. Das vernichtende Fazit des Sachverständigenrates zu den bisherigen Koalitionsverhandlungen bezieht sich vor allem auf sozialpolitisch relevante Themen. Die Wirtschaftsweisen »nennen die schwarz-roten Pläne „rückwärtsgewandt“ und kritisieren zentrale Vorhaben wie einen gesetzlichen Mindestlohn, eine Mietpreisbremse, die Rentenpläne oder die angestrebte Reform der Ökostromförderung.« Also eigentlich alles. Aber hier interessiert besonders der Mindestlohn.
Das Gutachten kann man als PDF-Datei auf der Website des Sachverständigenrates abrufen:
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: Gegen eine rückwärtsgewandte Wirtschaftspolitik. Jahresgutachten 2013/14. Wiesbaden, November 2013
In dem neuen Jahresgutachten gibt es ein ganzes Kapitel zum Thema „Arbeitsmarkt: Institutionelle Rahmenbedingungen für mehr Flexibilität“ (S. 248 ff.). Darin wird natürlich auch die Frage nach dem Mindestlohn behandelt.
Die weisen Ökonomen beginnen ihre Argumentation mit einer so typischen Feststellung: Ein Mindestlohn können „wesentliche Einschränkung des Lohnbildungsprozesses“ hervorrufen: »Vor allem in einem schwachen konjunkturellen Umfeld können diese als Sperrklinken wirken, indem sie ein Lohnniveau festschreiben, das über der Arbeitsproduktivität vieler Arbeitsuchender liegt. Leidtragende sind dabei vor allem Geringqualifizierte sowie jüngere und ältere Arbeitsuchende.«
Ach, wenn es denn so einfach wäre wie in dieser Modellwelt der Ökonomen. Das Produktivitätsargument wird einem gerade immer um die Ohren gehauen – und geht doch an der Realität vieler Arbeitsplätze vorbei darunter Millionen Menschen, die im Bereich der personenbezogenen Dienstleistungen arbeiten. Ich habe das in einem anderen Blog-Beitrag bereits mal auseinandergenommen: „Mit Gottes Hilfe gegen den gesetzlichen Mindestlohn? Was bleibt, sind immer wieder solche Behauptungen: Die Gefährdung der Tarifautonomie, die angeblich ganz vielen Ungelernten im Niedriglohnsektor und die Produktivitätsfrage„.
Aber weiter im Text. Die Wirtschaftsweisen stehen nun vor dem Problem, dass sie zur Kenntnis nehmen müssen, dass es eben nicht so ist, wie Wirtschaftslobbyisten wie Prof. Hüther vom Institut der deutschen Wirtschaft einfach mal so behaupten, dass ganz viele Studien zeigen, dass der Mindestlohn Jobs kosten würden. Sehr schön, mit welcher Formulierungskunst im Jahresgutachten versucht wird, das zu ummänteln – hier zu der Frage nach den Beschäftigungswirkungen von Mindestlöhnen:
»Die empirische Evidenz ist … uneinheitlich, was unter anderem daran liegt, dass meist keine geeignete kontrafaktische Situation konstruiert werden kann, die als Kontrast zu der beobachteten Einführung oder Erhöhung von Mindestlöhnen dient. Während beispielsweise Entlassungen nach Einführung oder Anhebung eines Mindestlohns direkt beobachtet werden könnten, ist dies im Hinblick auf unterlassene Einstellungen nicht möglich.«
Alles klar? Also wenn keine Entlassungen beobachtet werden können (was schlecht ist für die Mindestlohngegner), dann könnte es ja sein, das ansonsten getätigte Einstellungen vorgenommen worden wären, wenn kein Mindestlohn …
Aber sie geben sich mühe, dass muss man ihnen lassen. Hier z.B.: »Die von Mindestlöhnen geschaffene Lohnrigidität nach unten dürfte seitens der Unternehmen regelmäßig durch geringere Lohnzuwächse in den höheren Lohngruppen ausgeglichen werden … Während also einige Beschäftigte im unteren Bereich der Lohnverteilung Einkommensgewinne erzielen, verlieren andere ihren Arbeitsplatz oder müssen geringere Lohnzuwächse hinnehmen.« Warum eigentlich? Was ist beispielsweise mit dem angeblich enormen Fachkräftemangel in den Bereichen, die oberhalb des Mindestlohns liegen? Der müsste doch nach allen Gesetzen der Ökonomie zur einer Lohnsteigerung führen. Gilt das dann nicht mehr?
Sie weisen dann kurz darauf hin, dass jüngst die Ergebnisse einer groß angelegten Evaluationsstudie über die Wirkungen branchenspezifischer Lohnuntergrenzen veröffentlicht wurden, die insofern ärgerlich sind, weil sie eben keine Jobverluste nachweisen konnten. Deshalb leitet man schnell über zu einer älteren Sache:
»Eine frühere Studie für die deutsche Bauindustrie ergab signifikant negative Beschäftigungseffekte in Ost- und uneinheitliche Effekte in Westdeutschland … Deutlich wird dabei, wie entscheidend die Höhe und damit die Bindungswirkung eines Mindestlohns ist: In Ostdeutschland waren aufgrund des niedrigeren Lohnniveaus wesentlich mehr Arbeitnehmer von der Einführung des Mindestlohns betroffen als in Westdeutschland, folglich fielen die Beschäftigungsverluste dort höher aus.« Nur mal so als Gedanke: Haben die weisen Wirtschaftsweisen vielleicht mal überprüft, dass der gemessene Abbau der Bauarbeiterjobs im Osten unseres Landes vielleicht etwas damit zu tun haben kann, dass in diesem Zeitraum die vorher übermäßig aufgeblasenen Baukapazitäten im Osten wieder runter gefahren werden mussten, weil schlichtweg die Auftragslage zurück ging? Dass also der Abbau so oder so gekommen wäre, auch ohne einen Branchen-Mindestlohn? Das würde die gewünschten Befunde natürlich „verunreinigen“.
Aber das war nur das Vorspiel, denn die eigentliche Positionierung erfolgt dann unter der glasklaren Überschrift „Gegen einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn“ auf Seite 284 ff. des Jahresgutachtens. Warum sind sie gegen einen Mindestlohn?
»Zum einen ist der für Deutschland in Rede stehende Mindestlohn von 8,50 Euro relativ zum Lohngefüge bedeutsamer als in anderen Volkswirtschaften, etwa dem Vereinigten Königreich … Zum anderen ist es widersinnig, derjenigen Volkswirtschaft, deren Arbeitsmarkt aufgrund seiner höheren internen Flexibilität am erfolgreichsten durch die Krise gekommen ist, ein institutionelles Charakteristikum anzuempfehlen, das strukturelle Anpassungen in zukünftigen Krisen deutlich erschweren würde.« Also das zweite Argument muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: Die sind wirklich der Meinung, dass wir deshalb arbeitsmarktlich so gut durch die Krise gekommen, weil wir so viele Niedriglöhner haben. Könnten sich die Wirtschaftsweisen vielleicht vorstellen, dass wir auch und vor allem deshalb so gut durch die Krise gekommen sind, weil wir immer noch und Gott sei Dank über eine starke Industrie und ein starkes Handwerk verfügen, der unmittelbare Kriseneinbruch mit Instrumenten wie der Kurzarbeit (übrigens weitgehend auf Kosten der Beitragszahler und der betroffenen Arbeitnehmer) intelligent überbrückt wurde und die exportlastige deutsche Volkswirtschaft schnell wieder hochgefahren werden konnte, als die Weltkonjunktur bereits 2010 wieder ins Laufen kam, zumindest in den immer wichtiger werdenden Schwellenländern? Und bekanntlich werden in der Industrie und in den größten Bereichen des Handwerks gerade keine Niedrigstlöhne gezahlt.
Die sehr eigene Wahrnehmung der unteren Arbeitsmarktetagen bei den Wirtschaftsweisen wird an dem folgenden Zitat deutlich erkennbar:
»Durch das Sozialversicherungssystem sind in Deutschland angebotsseitig bereits Untergrenzen für die am Markt zu erzielenden Lohneinkommen impliziert. Zudem sind die Arbeitnehmer arbeitsrechtlich bereits in ausreichender Weise vor Lohndumping geschützt.«
Wenn man sich wirklich intensiver beschäftigt mit dem, was da unten los ist, dann bleibt einem das Lachen im Halse stecken angesichts dieser Ignoranz gegen die dort um sich greifenden Wildwest-Methoden.
Kurzum, man lehnt einen Mindestlohn ab. Aber nicht nur den, eigentlich lehnt man alles ab:
»Im deutschen Institutionengeflecht muss ein flächendeckender gesetzlicher Mindest- lohn daher abgelehnt werden, ebenso wie von staatlicher Hand gesetzte sektor- oder regionalspezifische Lohnuntergrenzen. Ebenfalls abzulehnen ist eine Ausweitung von tariflichen Lohnuntergrenzen nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz auf mehr Branchen, wenn dies auf Betreiben der Tarifvertragspartner geschehen würde .« (S. 286)
Das ist mal ein klares Wort.
Aber das war es noch nicht, denn auf der Seite 298 kommt dann die folgende Überschrift daher: „Eine andere Meinung“, von dem Volkswirt Peter Bofinger aus Würzburg. Hier zwei seiner Gegenargumente zur Mehrheitsmeinung des Sachverständigenrates:
- Die von Bofinger zitierten Berechnungen zeigen: Deutschland würde mit einem Mindestlohn von 8,50 Euro keinesfalls auf einem internationalen Spitzenplatz liegen würde. Die aus der Verdienststrukturerhebung abgeleitete Relation von Mindestlohn zu Medianlohn ergibt für Deutschland vielmehr einen Platz im internationalen Mittelfeld.
- Das entscheidende Argument für Bofinger: Für die „große Gefahr“ negativer Beschäftigungseffekte eines Mindestlohns wird von der Mehrheit der Ratsmitglieder keine überzeugende empirische Evidenz vorgelegt. »In der Tat lassen sich in der Literatur sehr viele Studien finden, die zu dem eindeutigen Ergebnis kommen, dass von Mindestlöhnen keine signifikanten negativen Auswirkungen auf die Beschäftigung zu erwarten sind«, so Bofinger. Nach Hinweisen auf die Forschungslage kommt er zu dem Befund: Es »gibt also keine uneindeutige, sondern vielmehr eine eindeutige Evidenz, dass von Mindestlöhnen, wenn sie angemessen ausgestaltet sind, keine signifikanten Beschäftigungsverluste ausgehen.«
Genau so sehen das nicht wenige Arbeitsmarktforscher. Aber in den Meldungen wird überwiegend nur zu lesen sein: Die Wirtschaftsweisen üben harte Kritik an Mindestlohn-Plänen. Der Mindestlohn kostet viele Jobs.
Für die wichtige abweichende Meinung wird dann der Platz fehlen. Und außerdem ist das ja auch irgendwie komplizierter als wenn man sagen kann „die“ Wirtschaftsweisen oder „die“ Wirtschaftsforschungsinstitute oder „die“ Experten. Es ist aber wie in der Medizin. Nicht selten sind Zweit- oder Drittmeinungen gehaltvoller.