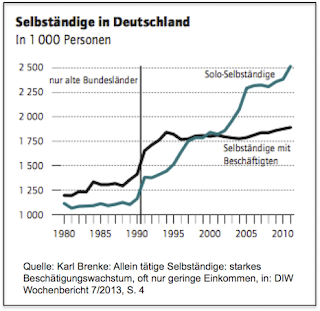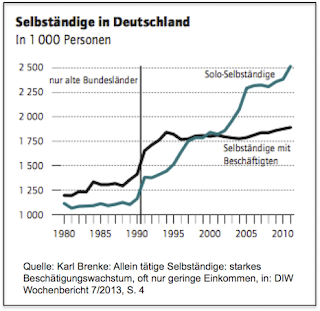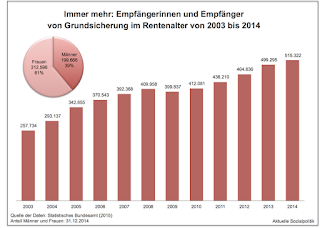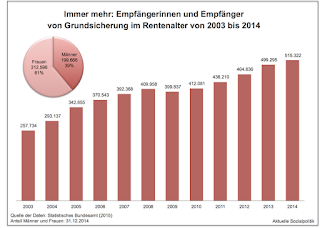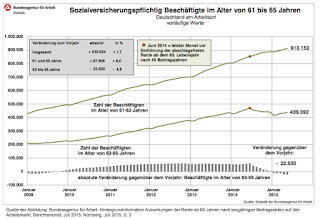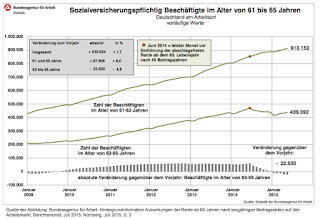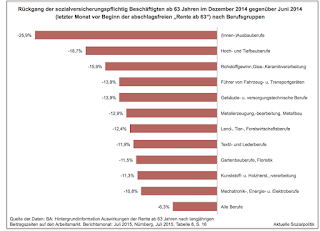Man muss sich das mal klar machen: Da nehmen viele Menschen, die 45 Beitragsjahre nachweisen können, derzeit die von der Bundesregierung geschaffene abschlagsfreie „Rente ab 63“ in Anspruch. Und das wird an vielen Stellen bitter beklagt, ein „Aderlass“ für die deutsche Wirtschaft sei das, eine zusätzliche „Besserstellung“ der „glücklichsten“ Rentner-Generation, die es bislang gab und die es so nicht wieder geben wird. Gleichzeitig wird aber der Pfad in Richtung auf die „Rente ab 67“ keineswegs grundsätzlich verlassen, sondern die Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters schreitet weiter voran, so dass die 67 für den Geburtsjahrgang 1964 gelten werden. Und man beklagt von interessierter Seite, dass die vorübergehende Ermöglichung einer abschlagsfreien Rente bereits ab dem 63. Lebensjahr – unter bestimmten, restriktiven Voraussetzungen – die beobachtbare Verlängerung des tatsächlichen Renteneintrittsalters nach oben nunmehr aufhält und bei den Arbeitnehmern falsche Erwartungen geweckt werden. Das gesetzliche Renteneintrittsalter gewinnt seine besondere Bedeutung dadurch, dass es auch die Grenze definiert, deren Unterschreitung beim Renteneintritt, der weiterhin auch vor dieser Grenze möglich ist, zu teilweise erheblichen lebenslangen Abschlägen bei den ausgezahlten Renten führt. Insofern ist es ja auch verständlich, dass viele Arbeitnehmer versuchen müssen, so lange wie nur irgendwie möglich durchzuhalten, damit sie dem Damoklesschwert der Abschläge von den zugleich im Sinkflug befindlichen Renten vor allem seit der Rentenreform der rot-grünen Bundesregierung Anfang des neuen Jahrtausends zu entgehen. Wenn dann die Bundesregierung eine Option anbietet, auch ohne Abschläge in den Rentenbezug zu wechseln, dann darf man sich nicht wirklich wundern, wenn das auch viele machen, die die Voraussetzungen erfüllen (vgl. dazu auch den Beitrag Und tschüss!? Zur Inanspruchnahme der „Rente ab 63“ und ihren Arbeitsmarktauswirkungen vom 7. August 2015).
Rentenversicherung
Einige Solo-Selbständige in Deutschland proben den Aufstand gegen die Rentenversicherung und andere möchten gerne rein
Also früher war die Welt irgendwie noch einfacher – jedenfalls aus der heutigen Perspektive, die natürlich immer auch eine verzerrte sein muss. Da gab es die große Masse der abhängig Beschäftigten, in Arbeiter und Angestellte sortiert und auf der anderen Seite der Medaille die Selbständigen. Bei den Selbständigen hatte man zum einen die vielen kleinen Kümmerexistenzen, die mit ihrem Laden mehr schlecht als recht über die Runden gekommen sind. Zum anderen die „normalen“ Selbständigen, die ein Unternehmen betrieben, in dem wiederum andere Menschen eine abhängige Beschäftigung gefunden haben. Und weil man normalerweise davon ausgehen konnte, dass so ein Selbständiger – von manchen politischen Kräften auch Kapitalist genannt – genügend Einkommen aus der Verwertung der Arbeitskraft seiner Arbeiter und Angestellten ziehen konnte, wurde unterstellt, dass hier keine „soziale Schutzbedürftigkeit“ gegeben sei, die eine Einbeziehung in die gesetzliche Sozialversicherung, die ja eine Arbeitnehmerversicherung ist, begründen könnte. Also hat man folgerichtig argumentiert, dass diese Selbständigen alleine in der Lage sind, für ihre Absicherung im Krankheitsfall zu sorgen und für eine eigene Alterssicherung beispielsweise in Form einer Lebensversicherung oder anderer Modelle vorzusorgen.
Es gab dann im Laufe der Zeit eine gewisse notwendige „Übergriffigkeit“ seitens der Sozialpolitik, die auch selbständige Existenzen wie Handwerker unter bestimmten Bedingungen unter das weite Dach der sozialen Sicherung zog, weil man hier eine offensichtliche „Schutzbedürftigkeit“ erkannt hat. Aber die meisten Selbständigen blieben weiter außerhalb des Systems und auf eigene Strategien der Absicherung angewiesen, was sie natürlich auch von einer entsprechenden Beitragszahlung befreit hat.
Nun gibt es seit vielen Jahren einen Trend, der quer zu der klassischen Vorstellung von einem Selbständigen mit einem Unternehmen und mehreren Beschäftigten liegt – gemeint ist der Trend hin zu den Solo-Selbständige, also Selbständige, die nur über sich selbst verfügen und keine weiteren Mitarbeiter beschäftigen. Und da gibt es – wie immer im Leben – echte Erfolgsgeschichten, aber auch viel Schatten.
So veröffentlichte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin 2013 einen Beitrag von Karl Brenke unter der Überschrift Allein tätige Selbständige: starkes Beschäftigungswachstum, oft nur geringe Einkommen:
»In den vergangenen beiden Jahrzehnten ist die Zahl der Selbständigen in Deutschland kräftig gestiegen. Dies ist fast ausschließlich auf die Entwicklung bei allein tätigen Selbständigen (Solo-Selbständigen) zurückzuführen. Besonders stark hat sich dabei die Zahl selbständiger Frauen erhöht. Auch wenn ein Teil der Solo-Selbständigen hohe Einkünfte erzielt, liegt das mittlere Einkommen dieser Erwerbstätigengruppe unter dem der Arbeitnehmer. Viele kommen über Einkünfte, wie sie Arbeitnehmer im Niedriglohnsektor beziehen, nicht hinaus. Der Anteil der Geringverdiener unter den Solo-Selbständigen ist zwar seit Mitte der letzten Dekade gesunken, er liegt aber immer noch bei knapp einem Drittel oder etwa 800 000 Personen.«
Schon hier gibt es Hinweise, dass für einen Teil dieser überaus heterogenen Gruppe der Solo-Selbständigen eine offensichtliche Schutzbedürftigkeit konstatiert werden muss, die dann nicht annähernd adäquat bearbeitet wird, wenn man sie zusammenwürfelt mit den anderen, die es auch gibt und die gut leben (und vorsorgen) können von ihrer Selbständigkeit. Das Problem ist eben die doch sehr große Streuung zwischen oben und unten (vgl. dazu auch den Beitrag Diesseits und jenseits der Kümmerexistenz. Arme und reiche (Solo)Selbständige, die vielen dazwischen und die Frage, was sich denn wie lohnt vom 11. Februar 2015).
Die Frage der individuellen Schutzbedürftigkeit einer selbständigen Existenz ist das eine. Das vermischt sich aber mit einem weiteren Problem, das unter dem Begriff der „Scheinselbständigkeit“ bekannt und kritisch diskutiert wird. Dahinter verbirgt sich ein recht einfaches Grundproblem: Wenn die gesamte Architektur des Systems der sozialen Sicherung in Form der verpflichtenden Sozialversicherung am Tatbestand der abhängigen Beschäftigung aufgehängt wird, mit den daraus resultierenden Abgabenfolgen für die Arbeitgeber (neben den weiteren Pflichten, die aus einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis resultieren, wie beispielsweise Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Kündigungsschutzbestimmungen usw.), dann leuchtet es unmittelbar ein, dass aus der Tatsache, dass Selbständige auf eigenes Risiko arbeiten (müssen) und keine solche Bindungswirkung beim Arbeitgeber entfalten, da sie immer nur als Auftragnehmer tätig sind und sein können, die auf Rechnung arbeiten (müssen), ein gewisser Anreiz entsteht, bisher von eigenen Mitarbeitern durchgeführte Arbeiten zu substituieren durch selbständige Auftragnehmer.
Ein klassisches Beispiel aus der Vergangenheit waren dann solche Fälle wie die aus der Unternehmens-Logistik, wo bislang angestellte Fahrer von Lastkraftwagen „outgesourct“ wurden und sich selbständig machen „durften“, in dem sie den LKW gekauft und als selbstständige Fahrer betrieben haben – und dann das gleiche gemacht haben wir vorher, allerdings in einem ganz anderen Beschäftigungsstatus und für die Auftraggeber zu deutlich besseren Konditionen, hat man sich doch der „Last“ der eigenen Beschäftigten entledigt. Zugleich waren alle unternehmerischen Risiken ausgelagert auf den Solo-Selbständigen und oftmals befand sich dieser in der überaus unangenehmen Situation, dass er nur einen Auftraggeber hatte bzw. hat, den solche Fälle gibt es auch heute, so dass er diesem Auftraggeber natürlich auch bedingungslos ausgeliefert war und ist.
Der Gesetzgeber hat versucht, diese höchst problematische Entwicklung einzudämmen, in dem er den Tatbestand der „Scheinselbständigkeit“ mit für den Auftraggeber empfindlichen Sanktionen belegt hat – also eigentlich. Denn wie immer tobt sich der Teufel aus im Detail und das ist hier die Frage, wann denn der Tatbestand der „Scheinselbständigkeit“ erfüllt ist, aus der dann beispielsweise die teure Folge einer Nachzahlung vorenthaltener Sozialversicherungsbeiträge resultieren kann.
Dazu schauen wir bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) nach, die versucht, uns das zu erläutern, denn die prüft ja auch in der Praxis, ob eine Scheinselbständigkeit vorliegt oder nicht. Als Merkmale für eine Scheinselbstständigkeit werden uns diese Kriterien serviert:
– die uneingeschränkte Verpflichtung, allen Weisungen des Auftraggebers Folge zu leisten
– die Verpflichtung, bestimmte Arbeitszeiten einzuhalten
– die Verpflichtung, dem Auftraggeber regelmäßig in kurzen Abständen detaillierte Berichte zukommen zu lassen
– die Verpflichtung, in den Räumen des Auftraggebers oder an von ihm bestimmten Orten zu arbeiten
– die Verpflichtung, bestimmte Hard- und Software zu benutzen, sofern damit insbesondere Kontrollmöglichkeiten des Auftraggebers verbunden sind,
denn, so die DRV, derartige »Verpflichtungen eröffnen dem Auftraggeber Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten, denen sich ein echter Selbstständiger nicht unterwerfen muss.«
Diese Kriterien hören sich klarer an als sie erscheinen. Und genau hier setzt eine aktuelle Protestbewegung an, die sich gegen eine Subsumtion unter einer derart verstandene „Schein“-Selbständigkeit wehrt, denn man sieht sich auch bei Erfüllung einiger dieser Kriterien dennoch als selbständig bzw. als freiberuflich tätig an.
Und wie immer in Deutschland gibt es einen eigenen Verband für diese Angelegenheiten: Der Verband der Gründer und Selbstständigen (VGSD). Und dieser Verband hat eine Petition ins Leben gerufen, die mittlerweile von mehr als 10.000 Personen unterzeichnet worden ist. Über diese Petition
»fordert (der Verband) einen „Schluss der Hexenjagd“ der Deutschen Rentenversicherung gegen vermeintlich „Scheinselbstständige“. „Auch wer fair bezahlt wird und gut fürs Alter vorsorgt, dem unterstellt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) mittlerweile Scheinselbstständigkeit“, so Verbandsgründer Andreas Lutz, Diplom-Kaufmann und Solo-Selbstständiger in München. Der Verband fordert „klare Kriterien“ für Selbstständigkeit, die sich auch an den Arbeitsbedingungen seiner Klientel, vor allem Wissensarbeitern, orientieren müssten«, berichtet Barbara Dribbusch in ihrem Artikel Solisten gegen die Sozialgesetze.
Das Problem sind die zitierten Kriterien, die für eine Schein-Selbständigkeit sprechen (sollen). »Viele selbstständige Softwareentwickler, Coaches und Datenkaufleute, die für ein bestimmtes Projekt und einen bestimmten Zeitraum von einer Firma eingekauft werden, erfüllen diese Kriterien, ohne sich allerdings als „Scheinselbstständige“ brandmarken lassen zu wollen.« Dribbusch zitiert in ihrem Artikel als Beispiel den selbständigen IT-Berater Alexander Kriegisch.
Er »arbeitet als Projektmanagement-Coach in Firmen vor Ort, sein Tageshonorar liegt bei 1.000 Euro und höher. Als er mit vielen anderen Freiberuflern an einem Auftrag der Telekom arbeitete, ließ das Bonner Unternehmen die Auftragsverhältnisse durch Juristen prüfen – und kam zu dem Schluss, dass die Selbstständigen in den Augen der Deutschen Rentenversicherung als „Scheinselbstständige“ gelten könnten, was hohe Nachzahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen nach sich gezogen hätte.
In der Folge verloren einige der Leute den Auftrag, andere wiederum mussten sich über eine Zeitarbeitsfirma zu schlechteren Konditionen anstellen lassen, um dann wieder für die Telekom arbeiten zu können. Kriegisch verließ das Projekt. „Ich wollte kein Scheinangestellter sein“, sagt er.«
Aber es ist nicht nur die IT-Branche, aus der diese Probleme berichtet werden. Selbst in der Pflege wird man damit konfrontiert, wie Barbara Dribbusch an einem Beispiel berichtet:
»Auch Marten Wiersma, Krankenpfleger mit Intensivpflegeausbildung und 61 Jahre alt, möchte lieber als Freiberufler in Kliniken eingesetzt werden und nicht festangestellt sein, erst recht nicht bei einer Zeitarbeitsfirma. Als Freiberufler käme er auf 8.000 Euro Bruttohonorar im Monat, als Angestellter einer Zeitarbeitsfirma hingegen nur auf 4.000 Euro brutto, berichtet Wiersma.
Der Krankenpfleger arbeitete unter anderem auch an einer Klinik in Duisburg als Selbstständiger. In einer Betriebsprüfung wurde dort Scheinselbstständigkeit festgestellt, die Klinik trennte sich von den Leuten. Es sei daraufhin schwieriger geworden, als Freiberufler zu arbeiten, erzählt Wiersma.«
Aber wo die Sonne ist (oder angeblich scheint), da gibt es auch Schatten: »Im schlecht zahlenden Kulturbereich etwa arbeiten viele selbstständige Publizisten, Lektoren und Musiktherapeuten auf Honorarbasis und sehnen eine Festanstellung mit Kündigungsschutz und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall herbei – während die Situation der hochbezahlten Spezialisten im wirtschaftsnahen IT-Bereich ganz anders ist.«
Oder man denke – gerade vor dem aktuellen und absehbar anhaltenden Hintergrund der massiven Zuwanderung von Flüchtlingen nach Deutschland – an die Situation der ebenfalls meistens als selbständige Existenzen arbeitenden Lehrkräfte für Integrations- und Sprachkurse, die mit Hungerhonoraren abgegolten werden.
Das Thema bewegt die Politik mal wieder. Thomas Öchsner berichtet in seinem Artikel Rente für alle über aktuelle Vorstöße des Sozialflügels der CDU: »Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA) will eine Pflicht zur betrieblichen Altersvorsorge einführen. Dies geht aus dem Entwurf der CDA für ihr neues Grundsatzprogramm hervor, das die Parteigruppe im November bei ihrer Bundestagung verabschieden will.« Und die CDA bleibt nicht stehen beim Thema betriebliche Altersvorsorge, sondern erweitert das:
»Für Selbständige will der Arbeitnehmerflügel der CDU daher eine „verpflichtende Basisabsicherung“ in der Rentenversicherung einführen, „damit niemand im Alter der Grundsicherung und damit dem Steuerzahler anheimfällt“. Die frühere Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen war mit ähnlichen Plänen gescheitert. Damals gab es einen Proteststurm von Selbständigen, die sich gegen ein solche „Zwangsabsicherung“ wehrten.«
Das ist das Dilemma: Die Freiberufler und Solo-Selbständigen, die genügend verdienen, können sich tatsächlich selbst absichern und viele tun das natürlich auch. Aber die Hungerleider unter diesem Dach können das gar nicht, auch wenn sie es wollten. Und wenn man jetzt eine Zwangsabsicherung für die angesprochene Basisabsicherung in der Rentenversicherung einführen würde, dann bedeutet das natürlich: Beitragszahlung. Aber genau auf den Verzicht auf eine solche basiert das heutige Geschäftsmodell vieler armer Schlucker, die als Solo-Selbständige versuchen, den Kopf über dem Wasser zu halten. Denn nur dann können sie Aufträge und damit Einnahmen generieren, von denen sie die laufenden Ausgaben halbwegs bestreiten können – aber eben nicht die zusätzlichen Ausgaben, die mit einer entsprechenden Absicherung, ob sie nun privat oder eben gesetzlich erfolgt, verbunden wären. Also werden die aus purer Not Amok laufen müssen, während die anderen, auf der Sonnenseite der Selbständigkeit befindlichen Personen ebenfalls Sturm laufen, weil es ihre persönlichen Einnahmen belasten würde.
Wie erwähnt, bereits Ursula von der Leyen (CDU) ist als Arbeitsministerin an dieser Frage gescheitert. Wir dürfen mit Interesse verfolgen, ob die durch Mindestlohn und Rentenpaket schon reichlich angeschossene gegenwärtige Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) noch Kraft und Ideen haben wird, diesen gordischen Knoten zu durchschlagen. Wetten würde ich darauf nicht, obgleich der Klärungsbedarf mehr als auf der Hand liegt.
Diesseits und jenseits der Grundsicherung im Alter: Die Legende von der massenhaften Rentner-Armut. Das ist (nicht) richtig
Das Statistische Bundesamt hat neue Zahlen zur Inanspruchnahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung veröffentlicht: »Neben den rund 512.000 Empfängerinnen und Empfängern von Grundsicherung im Rentenalter gab es im März 2015 deutschlandweit rund 483.000 Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung wegen dauerhaft voller Erwerbsminderung«, berichten uns die Statistiker. Hier interessiert besonders der Blick auf die älteren Menschen. Immer mehr Menschen sind auf Grundsicherung im Alter angewiesen. Die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger dieser Leistung bei Bedürftigkeit ist auf über eine halbe Million Betroffene am Jahresende 2014 angestiegen. 61 Prozent der Bezieher sind Frauen. Am stärksten betroffen vom Grundsicherungsbezug sind Frauen im Rentenalter in Westdeutschland – eine Folge der Konstruktionsprinzipien der klassischen gesetzlichen Rentenversicherung mit ihrer Orientierung am Modell einer möglichst lange und ohne Unterbrechungen absolvierten Erwerbsarbeit mit Beitragszahlungen und die in Vollzeit. Bei vielen westdeutschen Frauen „rächt“ sich aus dieser Systemlogik der in früheren Jahren übliche sehr lange Ausstieg aus der Erwerbsarbeit und wenn dann wieder eine aufgenommen wurde, dann zumeist in Teilzeit oder gar geringfügiger Beschäftigung, oft gekoppelt mit einer sehr niedrigen Vergütung mit entsprechend niedrigen bis gar keinen (bei der geringfügigen Beschäftigung) Rentenansprüchen.
Die Abbildung verdeutlicht, dass in den Jahren seit Einführung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 2003 die Zahl der Empfänger/innen angestiegen ist auf nunmehr eine halbe Million Menschen. Die Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes weist zwar für März 2015 als aktuelle Zahl 511.915 Menschen über 65 Jahre im Grundsicherungsbezug aus, ein Wert, der dem vom Ende 2014 entspricht, der in der Abbildung als letzter Wert ausgewiesen wurde – allerdings erwähnen die Statistiker, dass die aktuelle Zahl für März 2015 mit einem Erhebungsfehler verunreinigt ist:
»Die Grundsicherungsstatistik nach dem SGB XII wurde mit dem 1. Berichtsquartal 2015 neu konzipiert. Die Zahl der Empfänger/innen bezieht sich dabei immer auf den letzten Monat des Berichtsquartals. Bei der erstmaligen Erhebung kam es zur Untererfassung in verschiedenen Ländern. Für Deutschland insgesamt beträgt die Untererfassung im März 2015 schätzungsweise 10 000 bis 15 000 Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung gemäß SGB XII, der größte Teil davon in Berlin (schätzungsweise 10 000 Leistungsberechtigte).«
Interessant ist vor dem Hintergrund der seit Jahren ansteigenden Zahl an Grundsicherungsempfänger/innen im Alter dann der Artikel Die Legende von der massenhaften Rentner-Armut von Karl Doemens. Das sitzt erst einmal. Offensichtlich hat sich Herr Doemens aufgeregt. Dazu erfahren wir von ihm:
»Auf die Empörungswelle ist Verlass. Kaum lagen am Donnerstag die neuen Zahlen des Statistischen Bundesamtes über die Entwicklung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vor, meldeten sich die üblichen Bedenkenträger zu Wort: „Es rollt eine Lawine der Altersarmut auf uns zu“, schlug Ulrich Schneider, der Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, routiniert Alarm. Und Ulrike Mascher, die Chefin des Sozialverbandes SdK, sprach von „alarmierenden“ Nachrichten für die Senioren. Mit diesem Tenor griffen auch die Nachrichtenagenturen die Meldung auf. Spiegel Online und viele Tageszeitungen am Freitag folgten. „Immer mehr alte Menschen auf Grundsicherung angewiesen“, lautet der beunruhigende Tenor.«
Doemens meint sicher nicht SdK, wie im Artikel notiert, sondern eigentlich den VdK. Der hat am gleichen Tag eine Pressemitteilung veröffentlicht unter der Überschrift VdK: Armut nimmt weiter zu. Genau hier setzt Doemens Widerspruch an. Er bezieht sich dabei auf den vom Statistischen Bundesamt ebenfalls ausgewiesenen relativen Wert, also den Anteil der Bezieher staatlicher Hilfe an der Gesamtheit der Senioren:
»2013 betrug er 3,0 Prozent. 2014 waren es 2,9 Prozent. Der Anteil der Armen ist also nicht etwa gestiegen, sondern leicht gesunken! … Den Rentnern geht es im Schnitt unverändert – vielleicht sogar ein bisschen besser.«
Nehmt das, ihr „Armutslobbyisten“! Wobei Doemens selbst einen anderen Schmäh-Begriff präferiert: „Senioren-Lobby“. Aber seine Argumentation ist erst einmal durchaus gewichtig:
»… entblößt eine weitere Zahl endgültig die Einseitigkeit der Senioren-Lobby. Niemand hat sich nämlich die Mühe gemacht, die Quote der Senioren-Stütze-Empfänger mit dem Anteil der Hilfsbedürftigen im Rest der Gesellschaft zu vergleichen. Auch das kann man auf der Homepage des Statistischen Bundesamtes leicht tun: „7,38 Millionen Empfänger von Mindestsicherung“, meldete das Amt im Dezember 2014. Demnach beziehen 9,1 Prozent der Gesamtbevölkerung Hartz IV, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter oder Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder der Kriegsopferfürsorge. Alleine sechs Millionen Frauen und Männer sind auf Hartz IV und eine weitere Million auf Sozialhilfe angewiesen. Mit anderen Worten: Im Schnitt benötigt jeder elfte Deutsche staatliche Unterstützung. Bei den Senioren ist es jeder Vierunddreißigste.«
Sein Punkt: »2,9 Prozent bei den Senioren, aber 9,1 Prozent der Gesamtbevölkerung – das lässt vermuten, wo die wirklichen Probleme liegen.«
Ihm ist zuzustimmen, dass diese Daten prima facie offensichtlich nicht geeignet sind, Altersarmut als irgendwie relevantes Problem herauszustellen, insofern könnte man sich seinem Vorwurf, hier werde seitens der Sozialverbände völlig überzogen, anschließend.
Aber wie immer lohnt es sich, vorher noch einmal genauer hinzuschauen.
Zum einen wäre das Problem der „verdeckten Armut“ zu berücksichtigen (vgl. dazu bereits meinen Blog-Beitrag aus dem November 2014: Sie wächst und wird weiter wachsen – die Altersarmut. Neue bedrückende Zahlen am Anfang einer bitteren Wegstrecke). Die Verteilungsforscherin Irene Becker hat dazu 2012 einen Beitrag publiziert, in dem sie die Ergebnisse einer Untersuchung vorgestellt hat, die der Frage nachgegangen ist, wie sich die verdeckte Armut unter Älteren seit der 2003 erfolgten Einführung der „Grundsicherung im Alter“ entwickelt hat (vgl. Irene Becker: Finanzielle Mindestsicherung und Bedürftigkeit im Alter. In: Zeitschrift für Sozialreform, Heft 2, 2012, S. 123-148). Die Ergebnisse ihrer Studie bezogen sich auf das Jahr 2007: Von gut einer Million Menschen ab 65 Jahren, denen damals Grundsicherung zustand, bezogen nur 340.000 tatsächlich Leistungen. Die „Quote der Nichtinanspruchnahme“, so der technische Begriff für die Dunkelziffer der Armut, betrug 68 Prozent.
Nun haben sich die Verhältnisse – möglicherweise – seit damals geändert. Wir wissen darüber aber nichts genaues und es ist durchaus plausibel, immer noch von einer nicht unerheblichen Dunkelziffer auszugehen, gerade bei den älteren Menschen, bei denen beispielsweise Scham-Faktoren hinsichtlich der Inanspruchnahme einer bedürftigkeitsabhängigen Sozialleistung eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Hinzuweisen wäre auch auf den Tatbestand, dass die EInkommens- und vor allem die Vermögensanrechnung im SGB XII, wo die Grundsicherung im Alter normiert ist, restriktiver erfolgt als im SGB II, also im „normalen“ Hartz IV-System.
Auf alle Fälle sollte nicht vergessen werden, dass die – auch jetzt wieder – in der öffentlichen Wahrnehmung stehende Zahl an Grundsicherungsempfängern bei den Älteren nur als eine Untergrenze für das weite Feld der „Altersarmut“ anzusehen ist.
Dazu muss man einen vertiefenden Blick werfen auf das, was man eigentlich unter „Altersarmut“ versteht (vgl. beispielsweise die Infoplattform „Altersarmut“ des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mit einer hilfreichen Materialsammlung zu diesem Themenfeld).
Ein Zusammenfassung der Diskussion über die Messung von „Altersarmut“ findet sich auch in der von Johannes Geyer vom DIW verfassten und im April 2015 veröffentlichten Publikation Grundsicherungsbezug und Armutsrisikoquote als Indikatoren von Altersarmut. Darin finden sich interessante Hinweise.
Ein zentrales Argument von Doemens ist ja der Hinweis auf die mit 2,9 Prozent deutlich niedrigere Quote an Grundsicherungsempfänger/innen als die 9,1 Prozent der Gesamtbevölkerung. Hier erweitert Geyer den Horizont und kommt zu einer interessanten Annäherung:
»Betrachtet man die Armutsrisikoquote – nach dieser gelten Personen als armutsgefährdet, wenn ihr bedarfsgewichtetes verfügbares Einkommen weniger als 60% des Medianeinkommens beträgt, mehr dazu unten – ergibt sich auf der Basis der Europäischen Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) für das Jahr 2013, dass 14,9% aller Personen ab 65 Jahren als armutsgefährdet galten, in der jüngeren Bevölkerung lag der Wert mit 16,4% nur unwesentlich höher. Bei den Älteren liegt die Armutsrisikoquote also fünfmal so hoch wie die Grundsicherungsquote.«
Fazit: Man sollte sich nicht darauf begrenzen (lassen), die offizielle Zahl und Quote der Empfänger/innen von Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII als Indikator für „Altersarmut“ zu verwenden, dass verkürzt die tatsächlich davon betroffene Grundgesamtheit ganz erheblich.
Vor allem sollt man sich aber immer auch darüber bewusst sein, dass zwar derzeit auf der Ebene der Zahlen kein gravierendes Problem mit (Einkommens)Altersarmut bestehen mag, sich dies aber ohne tiefgreifende Reformen des sozialen Sicherungssystems in den vor uns liegenden Jahren mit Sicherheit erheblich ändern wird, denn heute profitieren wir immer noch von der – ansonsten von den interessierten Kreisen gerne geschmähten – gesetzlichen Rentenversicherung und ihrem Erfolg, was die Absicherung angeht. Aber das lässt sich aus der Vergangenheit eben nicht einfach fortschreiben in die Zukunft. Denn, so Johannes Geyer in der 2014 veröffentlichten Publikation Zukünftige Altersarmut:
»Das Einkommen im Alter hängt von der Erwerbshistorie, den politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und vom Haushaltskontext ab. Die langfristige Abschätzung von Einkommensrisiken im Alter ist schwierig. Bereits heute zeichnen sich allerdings bestimmte Risikogruppen ab. Langzeitarbeitslosigkeit oder Niedriglohnbeschäftigung, die schon in der Erwerbsphase ein Armutsrisiko darstellen, wirken kumuliert im Ruhestand fort. Zugleich werden die Einkommen aus der GRV nicht mehr ausreichen, um das Einkommensniveau im Ruhestand zu erhalten.« (S. 8)
»Millionen heutiger und künftiger Rentnerinnen und Rentner bezahlen für den zur Jahrhundertwende vorgenommenen Paradigmenwechsel in der Alterssicherung mit einem stetig sinkenden Versorgungsniveau«, so der ausgewiesene Rentenexperte Johannes Steffen im November des vergangenen Jahres vor dem Hintergrund des damals veröffentlichten Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung (»Drei-Säulen-Modell« der Alterssicherung ist gescheitert. Trotz geförderter Privatvorsorge keine Lebensstandardsicherung).
Ceteris paribus – also ohne fundamentale Reformen der sozialen Sicherungssysteme – werden wir in den vor uns liegenden Jahren noch eine Rentner-Armut zu sehen bekommen, deren Zwangsläufigkeit angesichts der politisch gewollten und gemachten Ausrichtung der Systeme die „Jetzt-Betrachter“ scheinbar nicht erkennen können (oder wollen). Ceteris paribus bedeutet bekanntlich „unter sonst gleich bleibenden Bedingungen“. Das nun wieder verweist darauf, dass wir es mit Sozialpolitik zu tun haben und die ist nun mal nicht „alternativlos“, wie manche gerne behaupten (müssen), um vom eigenen Nichtstun abzulenken. Sondern politische Entscheidungen können so oder anders ausfallen. Diese grundsätzliche Option lässt hoffen, dass wir dann nicht das zu sehen bekommen, was c.p. ansonsten zu erwarten wäre.
Und tschüss!? Zur Inanspruchnahme der „Rente ab 63“ und ihren Arbeitsmarktauswirkungen
Die „Rente ab 63“ hat im Vorfeld ihrer gesetzgeberischen Einführung polarisiert und sie polarisiert auch nach ihrer Inkraftsetzung. Vor allem in der Wirtschaft läuft man weiter Sturm gegen diesen gerade für die SPD neben dem allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn so zentralen sozialpolitischen Baustein der Regierungsarbeit, während man sich im Gewerkschaftslager natürlich eher freut, allerdings zugleich den vorübergehenden Charakter dieser Möglichkeit, früher als bislang ohne Abschläge aus dem Erwerbsleben zu scheiden, beklagt. Im Mittelpunkt der kritisch-ablehnenden Bewertung der „Rente ab 63“ stehen zwei Aspekte: Zum einen wird darauf hingewiesen, dass die langjährige Entwicklung in Richtung auf ein späteres Ausscheiden aus dem Erwerbsleben im Sinne einer Annäherung des tatsächlichen Übergangs in die Altersrente an die (frühere) Regelaltersgrenze von 65 durch Maßnahmen wie Abbau der Frühverrentungsmöglichkeiten und die Verschärfung der Abschlagsregelungen bei vorzeitigem Renteneintritt durch die schrittweise Verlängerung des gesetzlichen Renteneintrittsalters („Rente mit 67“) durch die – temporäre, weil auf nur einige wenige Jahrgänge begrenzte – Sonderregelung der „Rente ab 63“ durchbrochen wird und damit die trendmäßige Anpassung des tatsächlichen Renteneintrittsalters nach oben aufgehalten und je nach Inanspruchnahme wieder umgekehrt wird (vgl. zum Austritt aus dem Erwerbsleben in den Altersrentenbezug Martin Brussig und Mirko Ribbat (2014): Entwicklung des Erwerbsaustrittsalters: Anstieg und Differenzierung. Der Unterschied zwischen Erwerbsaustrittsalter und Renteneintrittsalter ist nicht trivial, denn: »Nur in etwa einem Drittel der Rentenzugänge eines Jahres erfolgt der Rentenbeginn aus einer unmittelbar vorhergehenden stabilen versicherungspflichtigen Beschäftigung; Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Nichterwerbstätigkeit vor Rentenbeginn sind weit verbreitet.« Und mit dem hier interessierenden Blick auf die Arbeitsmarktauswirkungen ist das Erwerbsaustrittsalter besonders relevant).
Zum anderen wird beklagt, dass der arbeitsmarktliche „Aderlass“ durch die Inanspruchnahme der abschlagsfreien „Rente ab 63“ nicht gleichverteilt, sondern aufgrund der Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, teilweise hoch konzentriert ist auf bestimmte Branchen und Berufe, die – so die Stimmen aus der Wirtschaft – bereits heute angeblich durch einen spezifischen und zunehmenden Fachkräftemangel gekennzeichnet seien. Hier führt die befristete Öffnung eines vorzeitigen Austritts aufgrund der Anreizwirkungen zu einer starken Inanspruchnahme, die viele Betriebe vorzeitig ihrer erfahrenen Fachkräfte berauben würde. Insofern ist es vor diesem Hintergrund natürlich interessant, nicht nur die allgemeine Inanspruchnahme der „Rente ab 63“ zu betrachten, sondern einen genaueren Blick auf die spezifische Nutzung vor allem hinsichtlich der Branchen und Berufe zu werfen.
Genau das versucht die Bundesagentur für Arbeit (BA) und aus deren neuesten Daten resultieren dann solche Artikel: Maurer und Fliesenleger nutzen Rente ab 63 am häufigsten, so die FAZ: »Vor allem Berufstätige auf dem Bau nutzen die im vergangenen Sommer eingeführte Rente ab 63.«
Datengrundlage sind die Auswertungen der BA:
Bundesagentur für Arbeit: Hintergrundinformation Auswirkungen der Rente ab 63 Jahren nach langjährigen Beitragszeiten auf den Arbeitsmarkt. Berichtsmonat: Juli 2015, Nürnberg, Juli 2015
Zum 1. Juli 2014 trat das Gesetz über Leistungsverbesserung in der Rentenversicherung in Kraft. Das Gesetz ermöglicht langjährig Versicherten, die das 63. Lebensjahr vollendet haben und mindestens 45 Beitragsjahre vorweisen können, abschlagsfrei in Altersrente zu gehen. Bei der deutschen Rentenversicherung sind bis Ende April etwa 320.000 Anträge eingegangen – wobei man darauf hinweisen muss, dass das eine „Brutto-Zahl“ ist, also man nicht argumentieren kann, die 320.000 hätten ansonsten weitergearbeitet bzw. wären im Erwerbsleben geblieben. Für den „Netto-Effekt“ müsste man diejenigen abziehen, die von der möglichen, allerdings mit Abschlägen versehenen, vorzeitigen Inanspruchnahme der Altersrente Gebrauch gemacht hätten. Außerdem – der Vollständigkeit halber sei das hier auch erwähnt – handelt es sich um gestellte Anträge, die zuerst hinsichtlich der Erfüllung der notwendigen Voraussetzungen geprüft und bewilligt werden müssen, so dass die tatsächliche Zahl der „Rente ab 63“-Fälle niedriger ausfallen kann (und wird).
Zuerst zu den allgemeinen Auswirkungen der „Rente ab 63“ auf die Beschäftigung von älteren Arbeitnehmern, hier gemessen an der wichtigen Zahl der „sozialversicherungspflichtig Beschäftigten“ in der Altersgruppe 61 bis 65. Die am Anfang des Beitrags stehende Abbildung der BA zeigt deren Entwicklung von Anfang 2009 bis an den aktuellen Rand. Man erkennt die deutliche Zunahme der Beschäftigtenzahlen in dieser Altersgruppe bis zum Juni 2014, dem letzten Monat vor Einführung der abschlagsfreien Rente ab dem 63. Lebensjahr.
»Seit 2009 ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten über 63 Jahren kontinuierlich gestiegen … Nach der Einführung der Rente ab 63 Jahren im Juli 2014 hat sich die Beschäftigtenzahl verringert, und zwar von Juni 2014 bis Mai 2015 um 31.300 oder 7 Prozent auf 439.400. m Vorjahr hatte die Beschäftigung in dieser Altersgruppe von Juni 2013 bis Mai 2014 um 53.600 oder 13 Prozent zugenommen.«
Man erkennt den – nennen wir das mal so – „Nahles-Einbruch“ ja auch in der Abbildung.
Interessant ist natürlich wie bereits angesprochen ein differenzierter Blick auf die unterschiedliche Inanspruchnahme nach Branchen und Berufen vor dem Hintergrund der Ausgangsthese, dass das hoch konzentriert und nicht gleichverteilt abläuft. Auch dazu liefern die Hintergrundinformationen der BA einige interessante Daten, vor allem, was die Berufsgruppen angeht, bei denen man einen überdurchschnittlichen Rückgang der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Alter ab 63 Jahren feststellen kann bzw. muss. In der zweiten Abbildung habe ich die Berufsgruppen herausgegriffen, bei denen sechs Monate nach dem Inkrafttreten der „Rente ab 63“ im Juli 2014 überdurchschnittlich starke Rückgänge bei der relevanten, also sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ab 63 Jahren zu beobachten sind. Man lasse die aufgeführten Berufsgruppen einen Moment auf sich wirken.
Unschwer zu erkennen: Eine besonders intensive Inanspruchnahme gibt es tatsächlich in bestimmten Berufsgruppen. Dazu der FAZ-Artikel:
»Handwerker wie Maurer, Estrich- und Fliesenleger nutzen die im vergangenen Sommer eingeführte Rente ab 63 offenbar am intensivsten. In diesen sogenannten Innenausbauberufen sank die Zahl der Beschäftigten ab 63 Jahren bis Ende 2014 um 25,9 Prozent … auch die Zahl der ab 63-Jährigen im Hoch-und Tiefbau (ging) bei einem Minus von 18,7 Prozent deutlich zurück.«
Auch die anderen Berufe zeichnen sich in einer Gesamtschau dadurch aus, dass es sich im Regelfall um körperlich durchaus belastende und vernutzende Tätigkeiten handelt.
Anders ausgedrückt: In vielen dieser Berufe ist die Inanspruchnahme der abschlagsfreien Rente ab 63 durchaus verständlich und nachvollziehbar – und genau diese Differenzierung wird bzw. wurde viel zu wenig gemacht bei der generalisierenden Debatte über „die“ Rente mit 63 und vor allem der Kritik an dieser Regelung, denn ob bewusst oder unbewusst haben viele Beteiligte oftmals Berufe vor Augen, die heute im Bewusstsein eher dominant sind, also Schreibtischjobs beispielsweise. Doch bei denen, das zeigen die detaillierten Auswertungen der BA ebenfalls, ist die Inanspruchnahme der „Rente ab 63“ unterdurchschnittlich.
Fazit: Wir müssen unterscheiden zwischen den (vor allem den nach Branchen und Berufen differenzierten) Arbeitsmarktauswirkungen und den rentenversicherungssystematischen Fragen einer „Rente ab 63“.
Zuerst zu den Arbeitsmarktauswirkungen: Eine ausgeprägte Nachfrage nach der Rente ab 63 gibt es bei (überwiegend bis ausschließlich männlichen) Handwerkern und Industriefacharbeitern, die diese Option ziehen und auch oftmals gute Gründe haben, so schnell wir möglich aus dem heutigen Erwerbsleben auszuscheiden, so lange es keine Kultur und zugleich keine adäquate finanzielle Ausgestaltung eines realisierbaren flexiblen, schrittweisen Rückzugs aus dem Erwerbsleben gibt. Das hat natürlich in diesen Branchen gewichtige negative Auswirkungen, die auch dadurch zustande kommen, dass man gerade in den hier relevanten Berufsgruppen heute die Folgen der in der Vergangenheit immer beklagten Ausbildungsdefizite, dass also zu wenig Nachwuchskräfte ausgebildet wurden, als es noch eine ausreichende Zahl an jungen Ausbildungslatzsuchenden gab.
Das ist ein generelles und den tatsächlich gerade bei Handwerkern und Industriefacharbeitern derzeit entstehenden und deutlich zunehmenden allgemeinen Fachkräftemangel beförderndes Problem, das jetzt übergangsweise durch den „Sonderausstieg“ eines Teils der älteren Fachkräfte gleichsam „verdoppelt“ wird. Insofern ist es verständlich und auch begründet, wenn das in diesen Bereichen als echtes Problem wahrgenommen wird, wenngleich auch das Inanspruchnahmeverhalten der älteren Beschäftigten in diesen Berufen nachvollziehbar ist.
Etwas anders gelagert ist die rentenversicherungssystematische Einordnung zu behandeln. Oftmals eine mehr oder weniger subtile Botschaft transportierend sind die Formulierungen, die man wählt. In dem bereits zitierten FAZ-Artikel Maurer und Fliesenleger nutzen Rente ab 63 am häufigsten heißt es in der Unterüberschrift gleich am Anfang: »Die abschlagsfreie Frührente ist gefragt.«
Wieso „Frührente“? Es handelt sich um eine abschlagsfreie Inanspruchnahme der Altersrente ab dem 63 (statt bisher 65), wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Und die wichtigste, an der dann auch viele Beschäftigten, vor allem Frauen, scheitern müssen, lautet: 45 Beitragsjahre (dazu und was darauf – nicht – angerechnet werden kann, vgl. die Informationen der DRV).
Man muss sich klar machen, um welchen Normalfall es hier geht: Es handelt sich um Arbeitnehmer, der sehr früh in ihrem Leben eine Ausbildung als Handwerker oder Facharbeiter gemacht haben und seitdem im Grunde ununterbrochen über Jahrzehnte gearbeitet haben – nicht selten, wie ja auch die jetzt vorliegende Inanspruchnahmestatistik aufzeigen kann – in Berufen, die körperlich durchaus mit erheblichen Belastungen verbunden sind. Ist der Bezug einer Altersrente nach 45 Beitragsjahren eine „Frührente“? Genau darüber kann man begründet diskutieren und hier sind wir auch an einer systematischen Unwucht der „Rente ab 63“ angelangt, denn man muss bei der ganzen Diskussion berücksichtigen: Entgegen der darüber transportierten Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist die derzeitige und so kontrovers diskutierte Regelung eine Art „Ausrutscher“ in einem ansonsten in eine andere Richtung angelegten Trend. Denn die „Rente ab 63“ schließt aufgrund der 45 Jahre-Anforderung nicht nur zahlreiche, vor allem weibliche Beschäftigte aus, sie wird ja auch mit ihrer Einführung gleich wieder sukzessive abgeschafft und dünnt sich aus, denn die generelle Verlängerung des gesetzlichen Renteneintrittsalters auf 67 Jahre, die dann erstmals vollständig erreicht wird für den Jahrgang 1964, nicht zufälligerweise der geburtenstärkste Jahrgang in Deutschland, wurde ja nicht aufgehoben, sondern läuft weiter. Für die Rente ab 63 bedeutet das konkret: Ab Jahrgang 1953 steigt diese Altersgrenze für die abschlagsfreie Rente wieder schrittweise an. Für alle 1964 oder später Geborenen liegt sie wieder wie bislang bei 65 Jahren.
Hier offenbart sich ein zentrales Problem: Offensichtlich hat die SPD in den Koalitionsverhandlungen eine zeitlich sehr begrenzte Öffnung des Renteneintrittsalters nach unten für ganz bestimmte Arbeitnehmer, die man zu dem Kernklientel der Industriegewerkschaften zählen kann und muss, durchsetzen können, ohne den allgemeinen Pfad einer Anhebung des Renteneintrittsalter damit aufgeben zu müssen. Das lässt das dann ja auch so unsystematisch wirken.
Auf der anderen Seite ist es eben gerade nicht gelungen, eine systematische Regelung zu finden, die einen „flexiblen“ Übertritt in den Ruhestand in Abhängigkeit von den individuell erbrachten Beitragsjahren zu ermöglichen, denn eine solche Regelung würde nicht nach einem kalendarischen Lebensalter fragen, sondern nach der Leistungszeit des Arbeitnehmers in der Gesetzlichen Rentenversicherung. Und wenn man in der Logik des bestehenden Rentenversicherungssystems bleibt, das ja auch differenziert bei der Rentenhöhe nach der Höhe der vorher eingezahlten Beiträge, dann wäre es durchaus gerechtfertigt, jemanden auch (vom Lebensalter her gesehen) „früher“ in Rente gehen zu lassen, wenn er oder sie beispielsweise 45 Beitragsjahre auf dem Buckel hat. Andere, beispielsweise Akademiker, die erst wesentlich später ins Erwerbsleben eingetreten sind, müssten dann eben „länger“ erwerbsarbeiten. Dafür kann man gute Argumente finden, man kann das natürlich auch kritisieren. Aber diese systematische Diskussion wurde und wird gar nicht geführt. Insofern bleibt der Befund: Die heutige „Rente ab 63“ ist ein Fremdkörper, der aufgrund seiner unterschiedlichen Auswirkungen in den einzelnen Wirtschaftszweigen durchaus als Problem wahrgenommen und erlebt wird, sie ist aber auch insofern ein rentenrechtlicher Fremdkörper, als das ihre Auflösung bereits mit dem Inkrafttreten begonnen hat und die Menschen eher verwirrt, die fälschlicherweise glauben, so was wie eine abschlagsfreie „Rente mit 63“ wird es auf Dauer geben.
Syndikusanwälte: Flucht auf die doppelte Sonnenseite. Raus aus der Rentenversicherung für das niedere Volk, aber auch aus der Haftung der richtigen Freiberufler
Was war das für eine Aufregung: Rund 40.000 Anwälte sollen wie gewöhnliche Arbeitnehmer in die Rentenversicherung einzahlen. Das war die Botschaft einer Entscheidung des Bundessozialgerichts, über die hier im April in dem Beitrag Wie „gewöhnliche“ Arbeitnehmer in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen? Von der Sonnenseite berufsständischer Versorgungswerke in das Schattenreich der „Staatsrente“? berichtet worden ist. Damals war die Aufregung groß, denn: »Das Bundessozialgericht (BSG) hat entschieden, dass sich Syndikus-Anwälte trotz Zulassung als Rechtsanwalt nicht mehr von der gesetzlichen Rentenversicherung befreien lassen können, um sich in einem berufsständischem Versorgungswerk zu versichern. Durch die Entscheidung des BSG droht im schlimmsten Fall auch vielen anderen Angestellten der Wegfall des Versorgungswerks«, so Christian Rolf und Jochen Riechwald in ihrem Artikel Wegfall des Versorgungswerks droht. Die Deutsche Rentenversicherung hatte argumentiert, dass die Tätigkeit in einem Arbeitsverhältnis mit einem nichtanwaltlichen Arbeitgeber generell keine befreiungsfähige Rechtsanwaltstätigkeit sei. Dem hat sich das BSG nun angeschlossen, denn »nach gefestigter verfassungsrechtlicher und berufsrechtlicher Rechtsprechung zum Tätigkeitsbild des Rechtsanwalts … wird derjenige, der als ständiger Rechtsberater in einem festen Dienst- oder Anstellungsverhältnis zu einem bestimmten Arbeitgeber steht (Syndikus), in dieser Eigenschaft nicht als Rechtsanwalt tätig … Unabhängiges Organ der Rechtspflege und damit Rechtsanwalt ist der Syndikus nur in seiner freiberuflichen, versicherungsfreien Tätigkeit außerhalb seines Dienstverhältnisses (sog Doppel- oder Zweiberufe-Theorie).«, so die Richter des BSG in ihrer Entscheidung. Aber bekanntlich kann man alles korrigieren, wenn man über die entsprechenden Mittel, Wege und Unterstützer verfügt. Und flugs wurde der parlamentarische Raum aktiviert, die möglichen Folgen des Urteils zu verhindern.
Und die Parlamentarier ließen sich nicht lange bitten, wer will es sich schon mit zehntausenden Juristen verscherzen, die zudem noch für viele Unternehmen arbeiten. Und so kann berichtet werden, dass sich der Bundestag in erster Lesung zu einem Gesetzentwurf von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) bekannt hat, nach dem sich diese Juristen künftig wieder von der Beitragspflicht in der gesetzlichen Rentenkasse befreien lassen können. Alles andere wäre ja auch noch schöner. Immerhin geht es hier um die nicht triviale Frage eines Zugangs zu einem Sonder-Alterssicherungssystem in Deutschland, den berufsständischen Versorgungswerken, die es für viele Freiberufler gibt, beispielsweise Ärzte und Zahnärzte, Architekten, Steuerberater oder eben Rechtsanwälte, wenn sie denn als freiberufliche Anwälte arbeiten. Bei Anwälten ist die Mitgliedschaft im Versorgungswerk durch die Zulassung als Rechtsanwalt bedingt. Das Versorgungswerk verspricht eine deutlich höhere Rente als die gesetzliche Rentenversicherung und ist daher attraktiv. Unternehmen können damit ihren Syndikus-Anwälten eine gute Altersversorgung anbieten, indem sie die Anwaltszulassung erlauben. Genau das wurde ja auch jetzt zu einem Problem im Gefolge der Entscheidung des Bundessozialgerichts. Aber dem will man durch die Gesetzesänderung jetzt Abhilfe verschaffen. Das ging schnell.
Aber wie immer liegen die Tücken im Detail. Oder sagen wir: In der Logik der Sache. Also mal ganz einfach formuliert: Wenn die Syndikusanwälte, die angestellt sind bei Unternehmen oder Organisationen und von denen auch als Arbeitnehmer bezahlt werden, aus der Gesetzlichen Rentenversicherung befreit werden, weil die Argumentation so geht, dass sie ja wie ein „normaler“ Anwalt vor Gericht tätig werden (können) und man sie deshalb bei der Frage der Zuordnung Gesetzliche Rentenversicherung versus berufsständisches Versorgungswerk den freiberuflich, also selbständig tätigen Anwälten gleichstellt, dann könnte man aus logischen Überlegungen durchaus zu dem naheliegenden Ergebnis kommen, dass das dann aber auch für andere Dinge, die mit der Existenz eines freiberuflich tätigen Anwalts verbunden sind, gilt. Beispielsweise für die Haftungsanforderungen. Und genau auf diesen plausiblen Schluss sind auch noch andere gekommen, was jetzt unmittelbar eine neue Schnappatmung auf Seiten der Syndikusanwälte und der sie vertretenden Verbände geführt hat.
Darüber berichtet Jakob Jahn in seinem Artikel Syndikusanwälte fürchten strenge Haftung. Und er bringt die beeindruckende Pirouette auf den Punkt: »Bislang haben Syndikusanwälte für eine möglichst weitgehende Gleichstellung mit niedergelassen Rechtsberatern gekämpft. Nun wollen sie plötzlich doch keine „richtigen“ Anwälte sein.«
Also man muss genauer sagen: Hinsichtlich der Befreiung von der Pflicht zur Teilnahme an der plebejischen Rentenversicherung der normalen Arbeitnehmer möchte man mit den niedergelassenen Rechtsanwälten gleichgestellt werden, aber bei den aus diesem Status abgeleiteten Haftungsverpflichtungen möchte man das genaue Gegenteil, dass man also wieder als stinknormaler Arbeitnehmer behandelt wird. Alles klar?
Bei der Anhörung zu den beabsichtigten gesetzgeberischen Veränderungen zugunsten der Syndikusanwälte wurde das „Problem“ (bzw. eigentlich die logische Konsequenz) so vorgetragen:
»Allen voran hatte Solms Wittig, Chefjurist der Linde AG und Präsident des Bundesverbands der Unternehmensjuristen (BUJ), die Abgeordneten gedrängt, einen Syndikusanwalt nicht so streng haften zu lassen wie niedergelassene Anwälte gegenüber ihren Mandanten. „Seine Haftung ergibt sich allein aus dem Anstellungsvertrag“, sagte Wittig. „Der Arbeitgeber als Mandant ist nicht in vergleichbarem Maße schützenswert wie das allgemeine rechtsuchende Publikum.“«
Dazu Jakob Jahn in seinem Artikel folgerichtig und zugleich noch weitere Begünstigungswünsche der Syndikusanwälte aufzeigend:
»Eine bemerkenswerte Argumentation, weil die Syndizi sonst gerade mit der „Einheit der Anwaltschaft“ argumentieren, wenn sie die Befreiung von der Rentenpflicht fordern. Zumal sie am liebsten auch noch die Erlaubnis bekämen, für ihren eigenen Arbeitgeber vor Gericht aufzutreten, und vor einer Beschlagnahme ihrer Akten geschützt wären. Beide Rechte stehen nur externen Kanzleien zu, weil die Politik bloß diese für unabhängig genug hält.«
Auch die Unternehmensverbände trommeln jetzt für die Beibehaltung der Arbeitnehmerhaftung bei den in der Rentenversicherung allerdings wie selbständige Freiberufler zu behandelnden anwaltschaftlichen Mischwesen. Warum, das liegt auf der Hand und man macht auch hier keinen Fehler, wenn man vermutet, dass das irgendwas mit den Kosten zu tun haben könnte.
In dem Artikel von Jahn wird Cord Meyer von der Deutschen Bahn AG zitiert, wonach bei einer unbeschränkten Haftung sich Probleme bei der Gewinnung geeigneter Mitarbeiter abzeichnen. Nach vorsichtigen Schätzungen könne die erforderliche Versicherung 3000 Euro jährlich kosten: „Dies entspräche dann in vielen Fällen bereits einem Netto-Monatseinkommen.“
Hier nur am Rande – eigentlich aber im thematischen Zentrum stehend – sei die Anmerkung erlaubt, dass wir dieses ganze Durcheinander nicht hätten, wenn eines der zunehmend immer stärker an Gewicht gewinnenden Strukturprobleme der Gesetzlichen Rentenversicherung, also ihre Begrenzung auf den „klassischen“ Typus des sozialversicherungspflichtig abhängig Beschäftigten, durch eine Erweiterung der umlagefinanzierten Rentenversicherung auf alle Erwerbstätige gelöst, zumindest aber deutlich verringert worden wäre. Aber da würden dann ja die Flüchtlinge aus der großen Solidargemeinschaft der Gesetzlichen Rentenversicherung in das kleine, überschaubare und mit vielen „guten Risiken“ besetzte Kollektiv der berufsständischen Versorgungswerke Abstriche machen müssen an den bislang in diesen Sondersystemen erzielbaren Renten machen müssen.